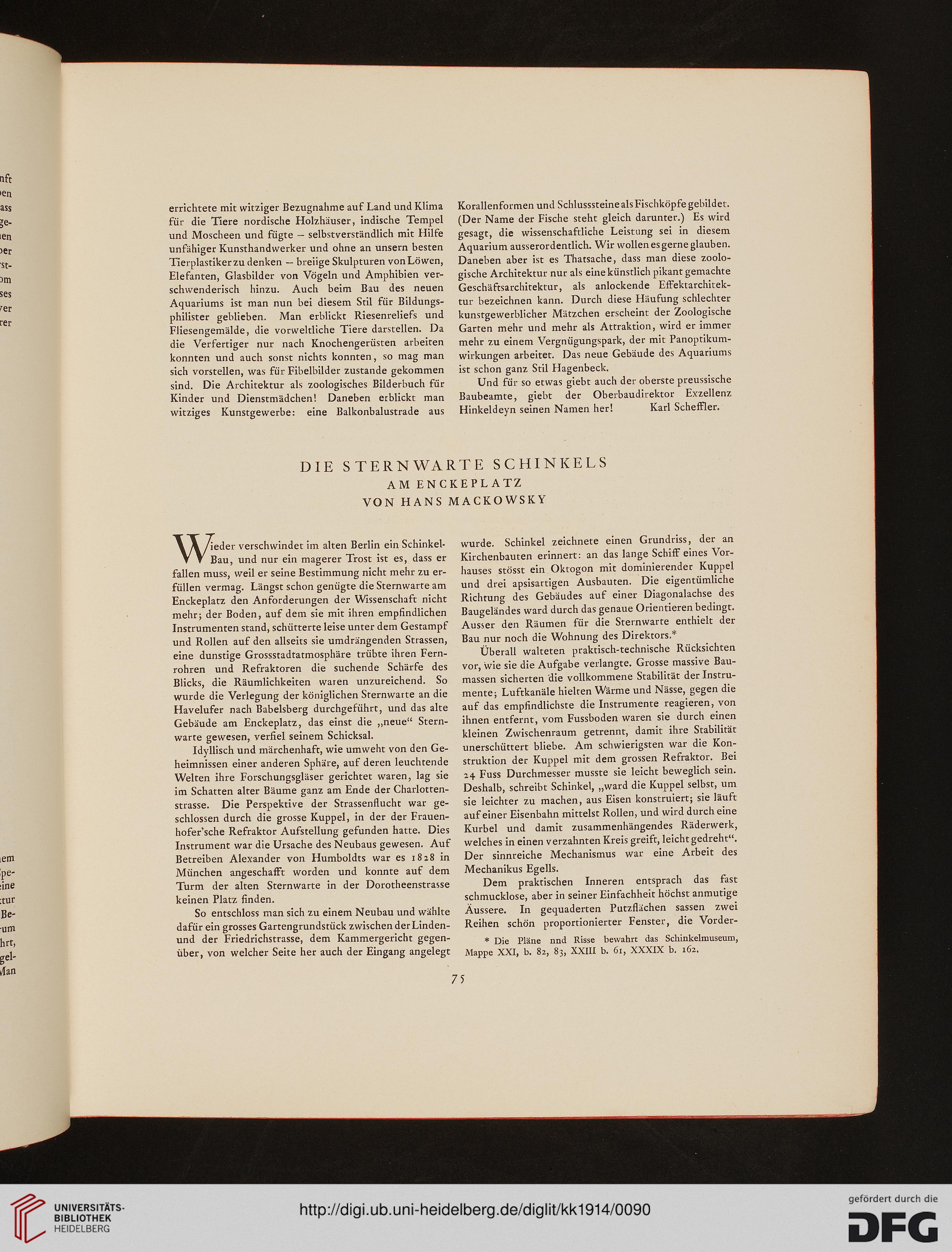errichtete mit witziger Bezugnahme auf Land und Klima
für die Tiere nordische Holzhäuser, indische Tempel
und Moscheen und fügte — selbstverständlich mit Hilfe
unfähiger Kunsthandwerker und ohne an unsern besten
Tierplastiker zu denken — breiige Skulpturen von Löwen,
Elefanten, Glasbilder von Vögeln und Amphibien ver-
schwenderisch hinzu. Auch beim Bau des neuen
Aquariums ist man nun bei diesem Stil für Bildungs-
philister geblieben. Man erblickt Riesenreliefs und
Fliesengemälde, die vorweltliche Tiere darstellen. Da
die Verfertiger nur nach Knochengerüsten arbeiten
konnten und auch sonst nichts konnten, so mag man
sich vorstellen, was für Fibelbilder zustande gekommen
sind. Die Architektur als zoologisches Bilderbuch für
Kinder und Dienstmädchen! Daneben erblickt man
witziges Kunstgewerbe: eine Balkonbalustrade aus
Korallenformen und Schlusssteine als Fischköpfe gebildet.
(Der Name der Fische steht gleich darunter.) Es wird
gesagt, die wissenschaftliche Leistung sei in diesem
Aquarium ausserordentlich. Wir wollen es gerne glauben.
Daneben aber ist es Thatsache, dass man diese zoolo-
gische Architektur nur als eine künstlich pikant gemachte
Geschäftsarchitektur, als anlockende EfFektarchitek-
tur bezeichnen kann. Durch diese Häufung schlechter
kunstgewerblicher Mätzchen erscheint der Zoologische
Garten mehr und mehr als Attraktion, wird er immer
mehr zu einem Vergnügungspark, der mit Panoptikum-
wirkungen arbeitet. Das neue Gebäude des Aquariums
ist schon ganz Stil Hagenbeck.
Und für so etwas giebt auch der oberste preussische
Baubeamte, giebt der Oberbaudirektor Exzellenz
Hinkeldeyn seinen Namen her! Karl Scheffler.
DIE STERNWARTE SCHINKELS
AM ENCKEPLATZ
VON HANS MACKOWSKY
Wieder verschwindet im alten Berlin ein Schinkel-
Bau, und nur ein magerer Trost ist es, dass er
fallen muss, weil er seine Bestimmung nicht mehr zu er-
füllen vermag. Längst schon genügte die Sternwarte am
Enckeplatz den Anforderungen der Wissenschaft nicht
mehr; der Boden, auf dem sie mit ihren empfindlichen
Instrumenten stand, schulterte leise unter dem Gestampf
und Rollen auf den allseits sie umdrängenden Strassen,
eine dunstige Grossstadtatmosphäre trübte ihren Fern-
rohren und Refraktoren die suchende Schärfe des
Blicks, die Räumlichkeiten waren unzureichend. So
wurde die Verlegung der königlichen Sternwarte an die
Havelufer nach Babelsberg durchgeführt, und das alte
Gebäude am Enckeplatz, das einst die „neue" Stern-
warte gewesen, verfiel seinem Schicksal.
Idyllisch und märchenhaft, wie umweht von den Ge-
heimnissen einer anderen Sphäre, auf deren leuchtende
Welten ihre Forschungsgläser gerichtet waren, lag sie
im Schatten alter Bäume ganz am Ende der Charlotten-
strasse. Die Perspektive der Strassenflucht war ge-
schlossen durch die grosse Kuppel, in der der Frauen-
hofer'sche Refraktor Aufstellung gefunden hatte. Dies
Instrument war die Ursache des Neubaus gewesen. Auf
Betreiben Alexander von Humboldts war es 1828 in
München angeschafft worden und konnte auf dem
Turm der alten Sternwarte in der Dorotheenstrasse
keinen Platz finden.
So entschloss man sich zu einem Neubau und wählte
dafür ein grosses Gartengrundstück zwischen derLinden-
und der Friedrichstrasse, dem Kammergericht gegen-
über, von welcher Seite her auch der Eingang angelegt
wurde. Schinkel zeichnete einen Grundriss, der an
Kirchenbauten erinnert: an das lange Schiff eines Vor-
hauses stösst ein Oktogon mit dominierender Kuppel
und drei apsisartigen Ausbauten. Die eigentümliche
Richtung des Gebäudes auf einer Diagonalachse des
Baugeländes ward durch das genaue Orientieren bedingt.
Ausser den Räumen für die Sternwarte enthielt der
Bau nur noch die Wohnung des Direktors.*
Überall walteten praktisch-technische Rücksichten
vor, wie sie die Aufgabe verlangte. Grosse massive Bau-
massen sicherten die vollkommene Stabilität der Instru-
mente; Luftkanäle hielten Wärme und Nässe, gegen die
auf das empfindlichste die Instrumente reagieren, von
ihnen entfernt, vom Fussboden waren sie durch einen
kleinen Zwischenraum getrennt, damit ihre Stabilität
unerschüttert bliebe. Am schwierigsten war die Kon-
struktion der Kuppel mit dem grossen Refraktor. Bei
24 Fuss Durchmesser musste sie leicht beweglich sein.
Deshalb, schreibt Schinkel, „ward die Kuppel selbst, um
sie leichter zu machen, aus Eisen konstruiert; sie läuft
auf einer Eisenbahn mittelst Rollen, und wird durch eine
Kurbel und damit zusammenhängendes Räderwerk,
welches in einen verzahnten Kreis greift, leicht gedreht".
Der sinnreiche Mechanismus war eine Arbeit des
Mechanikus Egells.
Dem praktischen Inneren entsprach das fast
schmucklose, aber in seiner Einfachheit höchst anmutige
Äussere. In gequaderten Putzflächen sassen zwei
Reihen schön proportionierter Fenster, die Vorder-
* Die Pläne nnd Risse bewahrt das Schinkelmuseum,
Mappe XXI, b. 82, 83, XXIII b. 61, XXXIX b. 162.
75
für die Tiere nordische Holzhäuser, indische Tempel
und Moscheen und fügte — selbstverständlich mit Hilfe
unfähiger Kunsthandwerker und ohne an unsern besten
Tierplastiker zu denken — breiige Skulpturen von Löwen,
Elefanten, Glasbilder von Vögeln und Amphibien ver-
schwenderisch hinzu. Auch beim Bau des neuen
Aquariums ist man nun bei diesem Stil für Bildungs-
philister geblieben. Man erblickt Riesenreliefs und
Fliesengemälde, die vorweltliche Tiere darstellen. Da
die Verfertiger nur nach Knochengerüsten arbeiten
konnten und auch sonst nichts konnten, so mag man
sich vorstellen, was für Fibelbilder zustande gekommen
sind. Die Architektur als zoologisches Bilderbuch für
Kinder und Dienstmädchen! Daneben erblickt man
witziges Kunstgewerbe: eine Balkonbalustrade aus
Korallenformen und Schlusssteine als Fischköpfe gebildet.
(Der Name der Fische steht gleich darunter.) Es wird
gesagt, die wissenschaftliche Leistung sei in diesem
Aquarium ausserordentlich. Wir wollen es gerne glauben.
Daneben aber ist es Thatsache, dass man diese zoolo-
gische Architektur nur als eine künstlich pikant gemachte
Geschäftsarchitektur, als anlockende EfFektarchitek-
tur bezeichnen kann. Durch diese Häufung schlechter
kunstgewerblicher Mätzchen erscheint der Zoologische
Garten mehr und mehr als Attraktion, wird er immer
mehr zu einem Vergnügungspark, der mit Panoptikum-
wirkungen arbeitet. Das neue Gebäude des Aquariums
ist schon ganz Stil Hagenbeck.
Und für so etwas giebt auch der oberste preussische
Baubeamte, giebt der Oberbaudirektor Exzellenz
Hinkeldeyn seinen Namen her! Karl Scheffler.
DIE STERNWARTE SCHINKELS
AM ENCKEPLATZ
VON HANS MACKOWSKY
Wieder verschwindet im alten Berlin ein Schinkel-
Bau, und nur ein magerer Trost ist es, dass er
fallen muss, weil er seine Bestimmung nicht mehr zu er-
füllen vermag. Längst schon genügte die Sternwarte am
Enckeplatz den Anforderungen der Wissenschaft nicht
mehr; der Boden, auf dem sie mit ihren empfindlichen
Instrumenten stand, schulterte leise unter dem Gestampf
und Rollen auf den allseits sie umdrängenden Strassen,
eine dunstige Grossstadtatmosphäre trübte ihren Fern-
rohren und Refraktoren die suchende Schärfe des
Blicks, die Räumlichkeiten waren unzureichend. So
wurde die Verlegung der königlichen Sternwarte an die
Havelufer nach Babelsberg durchgeführt, und das alte
Gebäude am Enckeplatz, das einst die „neue" Stern-
warte gewesen, verfiel seinem Schicksal.
Idyllisch und märchenhaft, wie umweht von den Ge-
heimnissen einer anderen Sphäre, auf deren leuchtende
Welten ihre Forschungsgläser gerichtet waren, lag sie
im Schatten alter Bäume ganz am Ende der Charlotten-
strasse. Die Perspektive der Strassenflucht war ge-
schlossen durch die grosse Kuppel, in der der Frauen-
hofer'sche Refraktor Aufstellung gefunden hatte. Dies
Instrument war die Ursache des Neubaus gewesen. Auf
Betreiben Alexander von Humboldts war es 1828 in
München angeschafft worden und konnte auf dem
Turm der alten Sternwarte in der Dorotheenstrasse
keinen Platz finden.
So entschloss man sich zu einem Neubau und wählte
dafür ein grosses Gartengrundstück zwischen derLinden-
und der Friedrichstrasse, dem Kammergericht gegen-
über, von welcher Seite her auch der Eingang angelegt
wurde. Schinkel zeichnete einen Grundriss, der an
Kirchenbauten erinnert: an das lange Schiff eines Vor-
hauses stösst ein Oktogon mit dominierender Kuppel
und drei apsisartigen Ausbauten. Die eigentümliche
Richtung des Gebäudes auf einer Diagonalachse des
Baugeländes ward durch das genaue Orientieren bedingt.
Ausser den Räumen für die Sternwarte enthielt der
Bau nur noch die Wohnung des Direktors.*
Überall walteten praktisch-technische Rücksichten
vor, wie sie die Aufgabe verlangte. Grosse massive Bau-
massen sicherten die vollkommene Stabilität der Instru-
mente; Luftkanäle hielten Wärme und Nässe, gegen die
auf das empfindlichste die Instrumente reagieren, von
ihnen entfernt, vom Fussboden waren sie durch einen
kleinen Zwischenraum getrennt, damit ihre Stabilität
unerschüttert bliebe. Am schwierigsten war die Kon-
struktion der Kuppel mit dem grossen Refraktor. Bei
24 Fuss Durchmesser musste sie leicht beweglich sein.
Deshalb, schreibt Schinkel, „ward die Kuppel selbst, um
sie leichter zu machen, aus Eisen konstruiert; sie läuft
auf einer Eisenbahn mittelst Rollen, und wird durch eine
Kurbel und damit zusammenhängendes Räderwerk,
welches in einen verzahnten Kreis greift, leicht gedreht".
Der sinnreiche Mechanismus war eine Arbeit des
Mechanikus Egells.
Dem praktischen Inneren entsprach das fast
schmucklose, aber in seiner Einfachheit höchst anmutige
Äussere. In gequaderten Putzflächen sassen zwei
Reihen schön proportionierter Fenster, die Vorder-
* Die Pläne nnd Risse bewahrt das Schinkelmuseum,
Mappe XXI, b. 82, 83, XXIII b. 61, XXXIX b. 162.
75