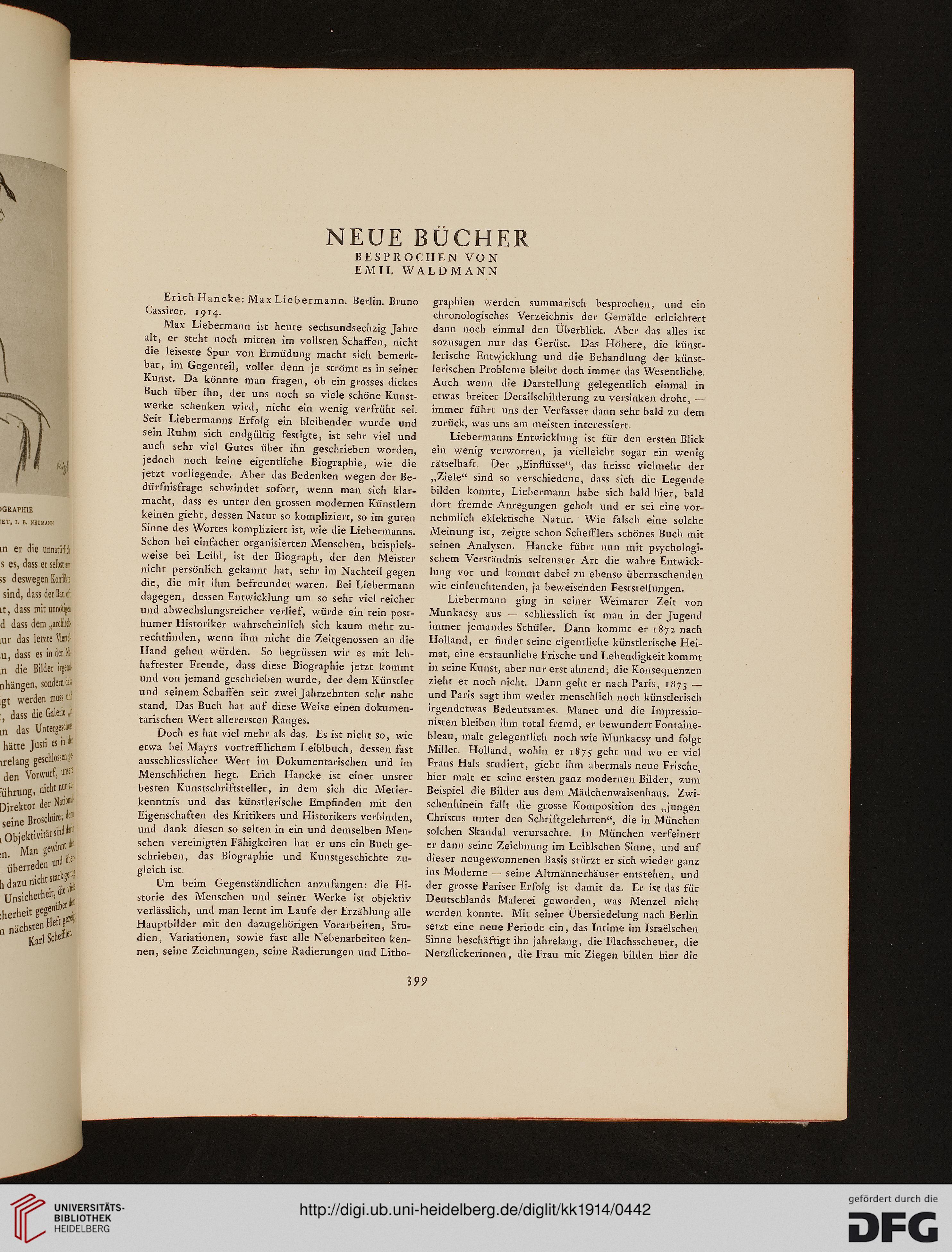NEUE BÜCHER
BESPROCHEN VON
EMIL WALDMANN
IGRAPHIE
■ET, I. B, MUHAHS
in er die unnatiirM
s es, dass er selbst n
;s deswegen Konflikte
sind, dass der Harnt
Lt, dass mit unnöcige:.
d dass dem „arcbittt
mr das letzte Vieittl
u, dass es in der &
,n die Bildet irgend-
nhängen, sondernd«
gt werden muss ■)
■f dass die Galerie-r
in das Untergeschoß
hätte Justi es in fc
,relang geschlossen je-
den Vorwurf, «*
Ehrung, nicht»«";
Direktor der *•*
seine Broschüre, t
.Objektivität^
überredend*
hdazu nif-S
BnachSsd^
Erich Hancke: Max Liebermann. Berlin. Bruno
Cassirer. 1914.
Max Liebermann ist heute Sechsundsechzig Jahre
alt, er steht noch mitten im vollsten Scharfen, nicht
die leiseste Spur von Ermüdung macht sich bemerk-
bar, im Gegenteil, voller denn je strömt es in seiner
Kunst. Da könnte man fragen, ob ein grosses dickes
Buch über ihn, der uns noch so viele schöne Kunst-
werke schenken wird, nicht ein wenig verfrüht sei.
Seit Liebermanns Erfolg ein bleibender wurde und
sein Ruhm sich endgültig festigte, ist sehr viel und
auch sehr viel Gutes über ihn geschrieben worden,
jedoch noch keine eigentliche Biographie, wie die
jetzt vorliegende. Aber das Bedenken wegen der Be-
dürfnisfrage schwindet sofort, wenn man sich klar-
macht, dass es unter den grossen modernen Künstlern
keinen giebt, dessen Natur so kompliziert, so im guten
Sinne des Wortes kompliziert ist, wie die Liebermanns.
Schon bei einfacher organisierten Menschen, beispiels-
weise bei Leibl, ist der Biograph, der den Meister
nicht persönlich gekannt hat, sehr im Nachteil gegen
die, die mit ihm befreundet waren. Bei Liebermann
dagegen, dessen Entwicklung um so sehr viel reicher
und abwechslungsreicher verlief, würde ein rein post-
humer Historiker wahrscheinlich sich kaum mehr zu-
rechtfinden, wenn ihm nicht die Zeitgenossen an die
Hand gehen würden. So begrüssen wir es mit leb-
haftester Freude, dass diese Biographie jetzt kommt
und von jemand geschrieben wurde, der dem Künstler
und seinem Schaffen seit zwei Jahrzehnten sehr nahe
stand. Das Buch hat auf diese Weise einen dokumen-
tarischen Wert allerersten Ranges.
Doch es hat viel mehr als das. Es ist nicht so, wie
etwa bei Mayrs vortrefflichem Leiblbuch, dessen fast
ausschliesslicher Wert im Dokumentarischen und im
Menschlichen liegt. Erich Hancke ist einer unsrer
besten Kunstschriftsteller, in dem sich die Metier-
kenntnis und das künstlerische Empfinden mit den
Eigenschaften des Kritikers und Historikers verbinden,
und dank diesen so selten in ein und demselben Men-
schen vereinigten Fähigkeiten hat er uns ein Buch ge-
schrieben, das Biographie und Kunstgeschichte zu-
gleich ist.
Um beim Gegenständlichen anzufangen: die Hi-
storie des Menschen und seiner Werke ist objektiv
verlässlich, und man lernt im Laufe der Erzählung alle
Hauptbilder mit den dazugehörigen Vorarbeiten, Stu-
dien, Variationen, sowie fast alle Nebenarbeiten ken-
nen, seine Zeichnungen, seine Radierungen und Litho-
graphien werden summarisch besprochen, und ein
chronologisches Verzeichnis der Gemälde erleichtert
dann noch einmal den Überblick. Aber das alles ist
sozusagen nur das Gerüst. Das Höhere, die künst-
lerische Entwicklung und die Behandlung der künst-
lerischen Probleme bleibt doch immer das Wesentliche.
Auch wenn die Darstellung gelegentlich einmal in
etwas breiter Detailschilderung zu versinken droht, —
immer führt uns der Verfasser dann sehr bald zu dem
zurück, was uns am meisten interessiert.
Liebermanns Entwicklung ist für den ersten Blick
ein wenig verworren, ja vielleicht sogar ein wenig
rätselhaft. Der „Einflüsse", das heisst vielmehr der
„Ziele" sind so verschiedene, dass sich die Legende
bilden konnte, Liebermann habe sich bald hier, bald
dort fremde Anregungen geholt und er sei eine vor-
nehmlich eklektische Natur. Wie falsch eine solche
Meinung ist, zeigte schon Schefflers schönes Buch mit
seinen Analysen. Hancke führt nun mit psychologi-
schem Verständnis seltenster Art die wahre Entwick-
lung vor und kommt dabei zu ebenso überraschenden
wie einleuchtenden, ja beweisenden Feststellungen.
Liebermann ging in seiner Weimarer Zeit von
Munkacsy aus — schliesslich ist man in der Jugend
immer jemandes Schüler. Dann kommt er 1872 nach
Holland, er findet seine eigentliche künstlerische Hei-
mat, eine erstaunliche Frische und Lebendigkeit kommt
in seine Kunst, aber nur erst ahnend; die Konsequenzen
zieht er noch nicht. Dann geht er nach Paris, 1873 —
und Paris sagt ihm weder menschlich noch künstlerisch
irgendetwas Bedeutsames. Manet und die Impressio-
nisten bleiben ihm total fremd, er bewundert Fontaine-
bleau, malt gelegentlich noch wie Munkacsy und folgt
Millet. Holland, wohin er 1875; geht und wo er viel
Frans Hals studiert, giebt ihm abermals neue Frische,
hier malt er seine ersten ganz modernen Bilder, zum
Beispiel die Bilder aus dem Mädchenwaisenhaus. Zwi-
schenhinein fällt die grosse Komposition des „jungen
Christus unter den Schriftgelehrten", die in München
solchen Skandal verursachte. In München verfeinert
er dann seine Zeichnung im Leibischen Sinne, und auf
dieser neugewonnenen Basis stürzt er sich wieder ganz
ins Moderne — seine Altmännerhäuser entstehen, und
der grosse Pariser Erfolg ist damit da. Er ist das für
Deutschlands Malerei geworden, was Menzel nicht
werden konnte. Mit seiner Übersiedelung nach Berlin
setzt eine neue Periode ein, das Intime im Israelschen
Sinne beschäftigt ihn jahrelang, die Flachsscheuer, die
Netzflickerinnen, die Frau mit Ziegen bilden hier die
199
BESPROCHEN VON
EMIL WALDMANN
IGRAPHIE
■ET, I. B, MUHAHS
in er die unnatiirM
s es, dass er selbst n
;s deswegen Konflikte
sind, dass der Harnt
Lt, dass mit unnöcige:.
d dass dem „arcbittt
mr das letzte Vieittl
u, dass es in der &
,n die Bildet irgend-
nhängen, sondernd«
gt werden muss ■)
■f dass die Galerie-r
in das Untergeschoß
hätte Justi es in fc
,relang geschlossen je-
den Vorwurf, «*
Ehrung, nicht»«";
Direktor der *•*
seine Broschüre, t
.Objektivität^
überredend*
hdazu nif-S
BnachSsd^
Erich Hancke: Max Liebermann. Berlin. Bruno
Cassirer. 1914.
Max Liebermann ist heute Sechsundsechzig Jahre
alt, er steht noch mitten im vollsten Scharfen, nicht
die leiseste Spur von Ermüdung macht sich bemerk-
bar, im Gegenteil, voller denn je strömt es in seiner
Kunst. Da könnte man fragen, ob ein grosses dickes
Buch über ihn, der uns noch so viele schöne Kunst-
werke schenken wird, nicht ein wenig verfrüht sei.
Seit Liebermanns Erfolg ein bleibender wurde und
sein Ruhm sich endgültig festigte, ist sehr viel und
auch sehr viel Gutes über ihn geschrieben worden,
jedoch noch keine eigentliche Biographie, wie die
jetzt vorliegende. Aber das Bedenken wegen der Be-
dürfnisfrage schwindet sofort, wenn man sich klar-
macht, dass es unter den grossen modernen Künstlern
keinen giebt, dessen Natur so kompliziert, so im guten
Sinne des Wortes kompliziert ist, wie die Liebermanns.
Schon bei einfacher organisierten Menschen, beispiels-
weise bei Leibl, ist der Biograph, der den Meister
nicht persönlich gekannt hat, sehr im Nachteil gegen
die, die mit ihm befreundet waren. Bei Liebermann
dagegen, dessen Entwicklung um so sehr viel reicher
und abwechslungsreicher verlief, würde ein rein post-
humer Historiker wahrscheinlich sich kaum mehr zu-
rechtfinden, wenn ihm nicht die Zeitgenossen an die
Hand gehen würden. So begrüssen wir es mit leb-
haftester Freude, dass diese Biographie jetzt kommt
und von jemand geschrieben wurde, der dem Künstler
und seinem Schaffen seit zwei Jahrzehnten sehr nahe
stand. Das Buch hat auf diese Weise einen dokumen-
tarischen Wert allerersten Ranges.
Doch es hat viel mehr als das. Es ist nicht so, wie
etwa bei Mayrs vortrefflichem Leiblbuch, dessen fast
ausschliesslicher Wert im Dokumentarischen und im
Menschlichen liegt. Erich Hancke ist einer unsrer
besten Kunstschriftsteller, in dem sich die Metier-
kenntnis und das künstlerische Empfinden mit den
Eigenschaften des Kritikers und Historikers verbinden,
und dank diesen so selten in ein und demselben Men-
schen vereinigten Fähigkeiten hat er uns ein Buch ge-
schrieben, das Biographie und Kunstgeschichte zu-
gleich ist.
Um beim Gegenständlichen anzufangen: die Hi-
storie des Menschen und seiner Werke ist objektiv
verlässlich, und man lernt im Laufe der Erzählung alle
Hauptbilder mit den dazugehörigen Vorarbeiten, Stu-
dien, Variationen, sowie fast alle Nebenarbeiten ken-
nen, seine Zeichnungen, seine Radierungen und Litho-
graphien werden summarisch besprochen, und ein
chronologisches Verzeichnis der Gemälde erleichtert
dann noch einmal den Überblick. Aber das alles ist
sozusagen nur das Gerüst. Das Höhere, die künst-
lerische Entwicklung und die Behandlung der künst-
lerischen Probleme bleibt doch immer das Wesentliche.
Auch wenn die Darstellung gelegentlich einmal in
etwas breiter Detailschilderung zu versinken droht, —
immer führt uns der Verfasser dann sehr bald zu dem
zurück, was uns am meisten interessiert.
Liebermanns Entwicklung ist für den ersten Blick
ein wenig verworren, ja vielleicht sogar ein wenig
rätselhaft. Der „Einflüsse", das heisst vielmehr der
„Ziele" sind so verschiedene, dass sich die Legende
bilden konnte, Liebermann habe sich bald hier, bald
dort fremde Anregungen geholt und er sei eine vor-
nehmlich eklektische Natur. Wie falsch eine solche
Meinung ist, zeigte schon Schefflers schönes Buch mit
seinen Analysen. Hancke führt nun mit psychologi-
schem Verständnis seltenster Art die wahre Entwick-
lung vor und kommt dabei zu ebenso überraschenden
wie einleuchtenden, ja beweisenden Feststellungen.
Liebermann ging in seiner Weimarer Zeit von
Munkacsy aus — schliesslich ist man in der Jugend
immer jemandes Schüler. Dann kommt er 1872 nach
Holland, er findet seine eigentliche künstlerische Hei-
mat, eine erstaunliche Frische und Lebendigkeit kommt
in seine Kunst, aber nur erst ahnend; die Konsequenzen
zieht er noch nicht. Dann geht er nach Paris, 1873 —
und Paris sagt ihm weder menschlich noch künstlerisch
irgendetwas Bedeutsames. Manet und die Impressio-
nisten bleiben ihm total fremd, er bewundert Fontaine-
bleau, malt gelegentlich noch wie Munkacsy und folgt
Millet. Holland, wohin er 1875; geht und wo er viel
Frans Hals studiert, giebt ihm abermals neue Frische,
hier malt er seine ersten ganz modernen Bilder, zum
Beispiel die Bilder aus dem Mädchenwaisenhaus. Zwi-
schenhinein fällt die grosse Komposition des „jungen
Christus unter den Schriftgelehrten", die in München
solchen Skandal verursachte. In München verfeinert
er dann seine Zeichnung im Leibischen Sinne, und auf
dieser neugewonnenen Basis stürzt er sich wieder ganz
ins Moderne — seine Altmännerhäuser entstehen, und
der grosse Pariser Erfolg ist damit da. Er ist das für
Deutschlands Malerei geworden, was Menzel nicht
werden konnte. Mit seiner Übersiedelung nach Berlin
setzt eine neue Periode ein, das Intime im Israelschen
Sinne beschäftigt ihn jahrelang, die Flachsscheuer, die
Netzflickerinnen, die Frau mit Ziegen bilden hier die
199