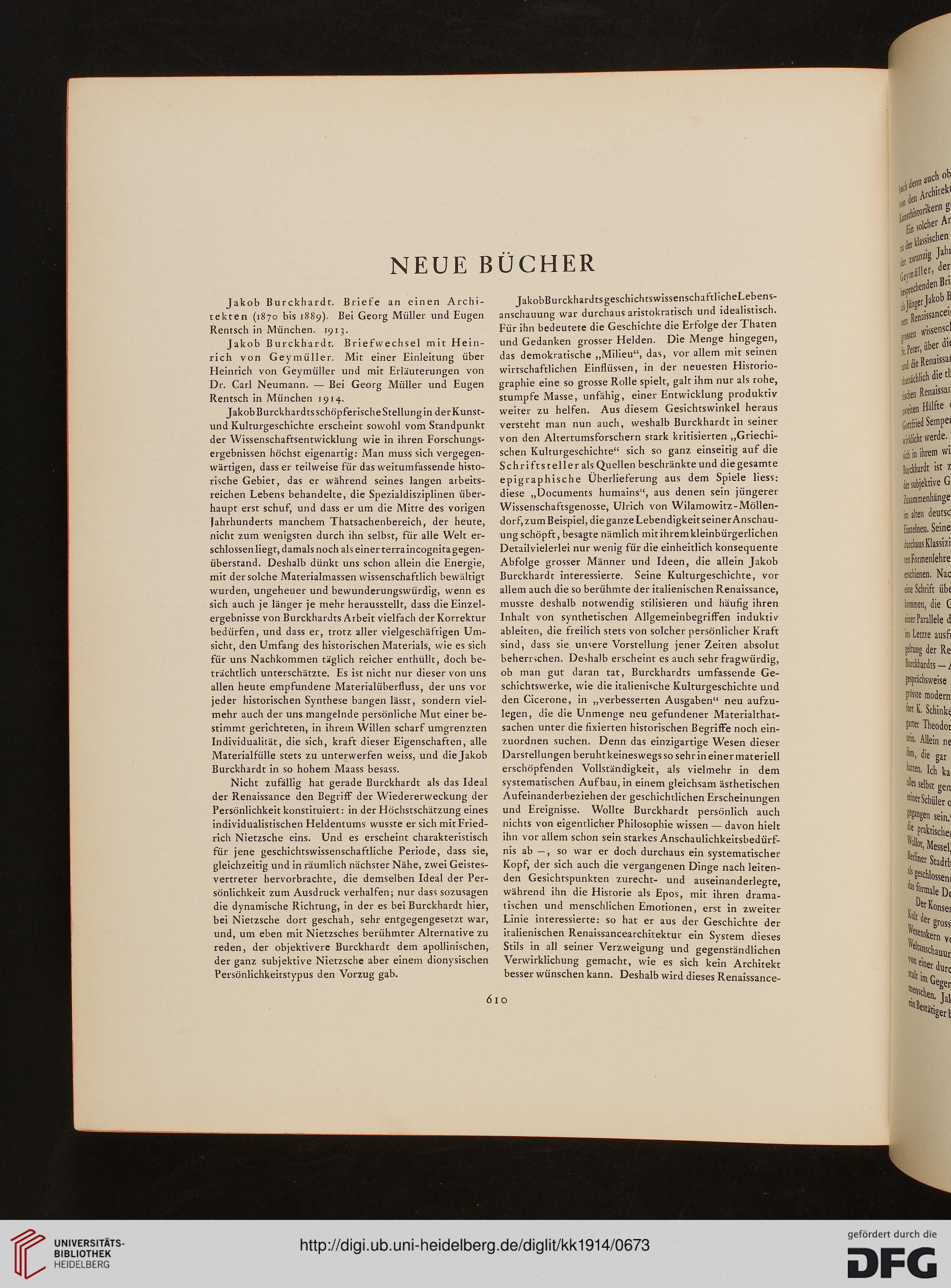NEUE BÜCHER
Jakob Burckhardt. Briefe an einen Archi-
tekten (1870 bis 1889). Bei Georg Müller und Eugen
Rentsch in München. 1913.
Jakob Burckhardt. Briefwechsel mit Hein-
rich von Geymüller. Mit einer Einleitung über
Heinrich von Geymüller und mit Erläuterungen von
Dr. Carl Neumann. — Bei Georg Müller und Eugen
Rentsch in München 1914.
JakobBurckhardts schöpferische Stellung in der Kunst-
und Kulturgeschichte erscheint sowohl vom Standpunkt
der Wissenschaftsentwicklung wie in ihren Forschungs-
ergebnissen höchst eigenartig: Man muss sich vergegen-
wärtigen, dass er teilweise für das weitumfassende histo-
rische Gebiet, das er während seines langen arbeits-
reichen Lebens behandelte, die Spezialdisziplinen über-
haupt erst schuf, und dass er um die Mitte des vorigen
Jahrhunderts manchem Thatsachenbereich, der heute,
nicht zum wenigsten durch ihn selbst, für alle Welt er-
schlossen liegt, damals noch als einer terraincognitagegen-
überstand. Deshalb dünkt uns schon allein die Energie,
mit der solche Materialmassen wissenschaftlich bewältigt
wurden, ungeheuer und bewunderungswürdig, wenn es
sich auch je länger je mehr herausstellt, dass die Einzel-
ergebnisse von Burckhardts Arbeit vielfach der Korrektur
bedürfen, und dass er, trotz aller vielgeschäftigen Um-
sicht, den Umfang des historischen Materials, wie es sich
für uns Nachkommen täglich reicher enthüllt, doch be-
trächtlich unterschätzte. Es ist nicht nur dieser von uns
allen heute empfundene Materialüberfluss, der uns vor
jeder historischen Synthese bangen lässt, sondern viel-
mehr auch der uns mangelnde persönliche Mut einer be-
stimmt gerichteten, in ihrem Willen scharf umgrenzten
Individualität, die sich, kraft dieser Eigenschaften, alle
Materialfülle stets zu unterwerfen weiss, und die Jakob
Burckhardt in so hohem Maass besass.
Nicht zufällig hat gerade Burckhardt als das Ideal
der Renaissance den Begriff der Wiedererweckung der
Persönlichkeit konstituiert: in der Höchstschätzung eines
individualistischen Heldentums wusste er sich mit Fried-
rich Nietzsche eins. Und es erscheint charakteristisch
für jene geschichtswissenschaftliche Feriode, dass sie,
gleichzeitig und in räumlich nächster Nähe, zwei Geistes-
vertreter hervorbrachte, die demselben Ideal der Per-
sönlichkeit zum Ausdruck verhalfen; nur dass sozusagen
die dynamische Richtung, in der es bei Burckhardt hier,
bei Nietzsche dort geschah, sehr entgegengesetzt war,
und, um eben mit Nietzsches berühmter Alternative zu
reden, der objektivere Burckhardt dem apollinischen,
der ganz subjektive Nietzsche aber einem dionysischen
Persönlichkeitstypus den Vorzug gab.
JakobBurckhardts geschichtswissenschaftlicheLebens-
anschauung war durchaus aristokratisch und idealistisch.
Für ihn bedeutete die Geschichte die Erfolge derThaten
und Gedanken grosser Helden. Die Menge hingegen,
das demokratische „Milieu", das, vor allem mit seinen
wirtschaftlichen Einflüssen, in der neuesten Historio-
graphie eine so grosse Rolle spielt, galt ihm nur als rohe,
stumpfe Masse, unfähig, einer Entwicklung produktiv
weiter zu helfen. Aus diesem Gesichtswinkel heraus
versteht man nun auch, weshalb Burckhardt in seiner
von den Altertumsforschern stark kritisierten „Griechi-
schen Kulturgeschichte" sich so ganz einseitig auf die
S c h r i f t s t eil e r als Quellen beschränkte und die gesamte
epigraphische Überlieferung aus dem Spiele Hess:
diese „Documents humains", aus denen sein jüngerer
Wissenschaftsgenosse, Ulrich von Wilamowitz-Möllen-
dorf,zumBeispiel, die ganze Lebendigkeit seiner Anschau-
ung schöpft, besagte nämlich mitihremkleinbürgerlichen
Detailvielerlei nur wenig für die einheitlich konsequente
Abfolge grosser Männer und Ideen, die allein Jakob
Burckhardt interessierte. Seine Kulturgeschichte, vor
allem auch die so berühmte der italienischen Renaissance,
musste deshalb notwendig stilisieren und häufig ihren
Inhalt von synthetischen AllgemeinbegrifFen induktiv
ableiten, die freilich stets von solcher persönlicher Kraft
sind, dass sie unsere Vorstellung jener Zeiten absolut
beherrschen. Deshalb erscheint es auch sehr fragwürdig,
ob man gut daran tat, Burckhardts umfassende Ge-
schichtswerke, wie die italienische Kulturgeschichte und
den Cicerone, in „verbesserten Ausgaben" neu aufzu-
legen, die die Unmenge neu gefundener Materialthat-
sachen unter die fixierten historischen BegrifFe noch ein-
zuordnen suchen. Denn das einzigartige Wesen dieser
Darstellungen beruhtkeineswegs so sehrin einer materiell
erschöpfenden Vollständigkeit, als vielmehr in dem
systematischen Aufbau, in einem gleichsam ästhetischen
Aufeinanderbeziehen der geschichtlichen Erscheinungen
und Ereignisse. Wollte Burckhardt persönlich auch
nichts von eigentlicher Philosophie wissen — davon hielt
ihn vor allem schon sein starkes Anschaulichkeitsbedürf-
nis ab -, so war er doch durchaus ein systematischer
Kopf, der sich auch die vergangenen Dinge nach leiten-
den Gesichtspunkten zurecht- und auseinanderlegte,
während ihn die Historie als Epos, mit ihren drama-
tischen und menschlichen Emotionen, erst in zweiter
Linie interessierte: so hat er aus der Geschichte der
italienischen Renaissancearchitektur ein System dieses
Stils in all seiner Verzweigung und gegenständlichen
Verwirklichung gemacht, wie es sich kein Architekt
besser wünschen kann. Deshalb wird dieses Renaissance-
DttKons
Nern
timGe
610
Jakob Burckhardt. Briefe an einen Archi-
tekten (1870 bis 1889). Bei Georg Müller und Eugen
Rentsch in München. 1913.
Jakob Burckhardt. Briefwechsel mit Hein-
rich von Geymüller. Mit einer Einleitung über
Heinrich von Geymüller und mit Erläuterungen von
Dr. Carl Neumann. — Bei Georg Müller und Eugen
Rentsch in München 1914.
JakobBurckhardts schöpferische Stellung in der Kunst-
und Kulturgeschichte erscheint sowohl vom Standpunkt
der Wissenschaftsentwicklung wie in ihren Forschungs-
ergebnissen höchst eigenartig: Man muss sich vergegen-
wärtigen, dass er teilweise für das weitumfassende histo-
rische Gebiet, das er während seines langen arbeits-
reichen Lebens behandelte, die Spezialdisziplinen über-
haupt erst schuf, und dass er um die Mitte des vorigen
Jahrhunderts manchem Thatsachenbereich, der heute,
nicht zum wenigsten durch ihn selbst, für alle Welt er-
schlossen liegt, damals noch als einer terraincognitagegen-
überstand. Deshalb dünkt uns schon allein die Energie,
mit der solche Materialmassen wissenschaftlich bewältigt
wurden, ungeheuer und bewunderungswürdig, wenn es
sich auch je länger je mehr herausstellt, dass die Einzel-
ergebnisse von Burckhardts Arbeit vielfach der Korrektur
bedürfen, und dass er, trotz aller vielgeschäftigen Um-
sicht, den Umfang des historischen Materials, wie es sich
für uns Nachkommen täglich reicher enthüllt, doch be-
trächtlich unterschätzte. Es ist nicht nur dieser von uns
allen heute empfundene Materialüberfluss, der uns vor
jeder historischen Synthese bangen lässt, sondern viel-
mehr auch der uns mangelnde persönliche Mut einer be-
stimmt gerichteten, in ihrem Willen scharf umgrenzten
Individualität, die sich, kraft dieser Eigenschaften, alle
Materialfülle stets zu unterwerfen weiss, und die Jakob
Burckhardt in so hohem Maass besass.
Nicht zufällig hat gerade Burckhardt als das Ideal
der Renaissance den Begriff der Wiedererweckung der
Persönlichkeit konstituiert: in der Höchstschätzung eines
individualistischen Heldentums wusste er sich mit Fried-
rich Nietzsche eins. Und es erscheint charakteristisch
für jene geschichtswissenschaftliche Feriode, dass sie,
gleichzeitig und in räumlich nächster Nähe, zwei Geistes-
vertreter hervorbrachte, die demselben Ideal der Per-
sönlichkeit zum Ausdruck verhalfen; nur dass sozusagen
die dynamische Richtung, in der es bei Burckhardt hier,
bei Nietzsche dort geschah, sehr entgegengesetzt war,
und, um eben mit Nietzsches berühmter Alternative zu
reden, der objektivere Burckhardt dem apollinischen,
der ganz subjektive Nietzsche aber einem dionysischen
Persönlichkeitstypus den Vorzug gab.
JakobBurckhardts geschichtswissenschaftlicheLebens-
anschauung war durchaus aristokratisch und idealistisch.
Für ihn bedeutete die Geschichte die Erfolge derThaten
und Gedanken grosser Helden. Die Menge hingegen,
das demokratische „Milieu", das, vor allem mit seinen
wirtschaftlichen Einflüssen, in der neuesten Historio-
graphie eine so grosse Rolle spielt, galt ihm nur als rohe,
stumpfe Masse, unfähig, einer Entwicklung produktiv
weiter zu helfen. Aus diesem Gesichtswinkel heraus
versteht man nun auch, weshalb Burckhardt in seiner
von den Altertumsforschern stark kritisierten „Griechi-
schen Kulturgeschichte" sich so ganz einseitig auf die
S c h r i f t s t eil e r als Quellen beschränkte und die gesamte
epigraphische Überlieferung aus dem Spiele Hess:
diese „Documents humains", aus denen sein jüngerer
Wissenschaftsgenosse, Ulrich von Wilamowitz-Möllen-
dorf,zumBeispiel, die ganze Lebendigkeit seiner Anschau-
ung schöpft, besagte nämlich mitihremkleinbürgerlichen
Detailvielerlei nur wenig für die einheitlich konsequente
Abfolge grosser Männer und Ideen, die allein Jakob
Burckhardt interessierte. Seine Kulturgeschichte, vor
allem auch die so berühmte der italienischen Renaissance,
musste deshalb notwendig stilisieren und häufig ihren
Inhalt von synthetischen AllgemeinbegrifFen induktiv
ableiten, die freilich stets von solcher persönlicher Kraft
sind, dass sie unsere Vorstellung jener Zeiten absolut
beherrschen. Deshalb erscheint es auch sehr fragwürdig,
ob man gut daran tat, Burckhardts umfassende Ge-
schichtswerke, wie die italienische Kulturgeschichte und
den Cicerone, in „verbesserten Ausgaben" neu aufzu-
legen, die die Unmenge neu gefundener Materialthat-
sachen unter die fixierten historischen BegrifFe noch ein-
zuordnen suchen. Denn das einzigartige Wesen dieser
Darstellungen beruhtkeineswegs so sehrin einer materiell
erschöpfenden Vollständigkeit, als vielmehr in dem
systematischen Aufbau, in einem gleichsam ästhetischen
Aufeinanderbeziehen der geschichtlichen Erscheinungen
und Ereignisse. Wollte Burckhardt persönlich auch
nichts von eigentlicher Philosophie wissen — davon hielt
ihn vor allem schon sein starkes Anschaulichkeitsbedürf-
nis ab -, so war er doch durchaus ein systematischer
Kopf, der sich auch die vergangenen Dinge nach leiten-
den Gesichtspunkten zurecht- und auseinanderlegte,
während ihn die Historie als Epos, mit ihren drama-
tischen und menschlichen Emotionen, erst in zweiter
Linie interessierte: so hat er aus der Geschichte der
italienischen Renaissancearchitektur ein System dieses
Stils in all seiner Verzweigung und gegenständlichen
Verwirklichung gemacht, wie es sich kein Architekt
besser wünschen kann. Deshalb wird dieses Renaissance-
DttKons
Nern
timGe
610