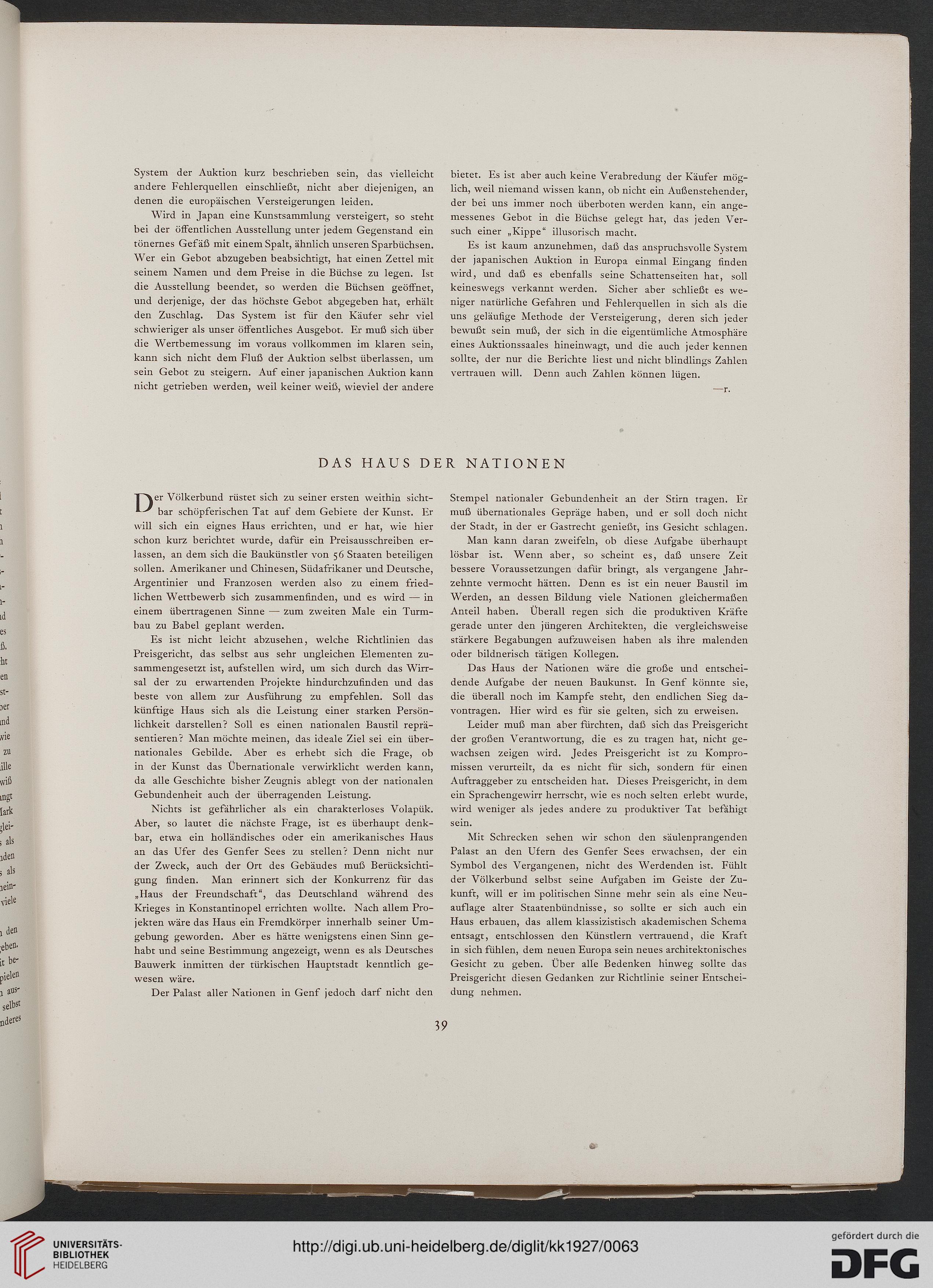System der Auktion kurz beschrieben sein, das vielleicht
andere Fehlerquellen einschließt, nicht aber diejenigen, an
denen die europäischen Versteigerungen leiden.
Wird in Japan eine Kunstsammlung versteigert, so steht
bei der öffentlichen Ausstellung unter jedem Gegenstand ein
tönernes Gefäß mit einem Spalt, ähnlich unseren Sparbüchsen.
Wer ein Gebot abzugeben beabsichtigt, hat einen Zettel mit
seinem Namen und dem Preise in die Büchse zu legen. Ist
die Ausstellung beendet, so werden die Büchsen geöffnet,
und derjenige, der das höchste Gebot abgegeben hat, erhält
den Zuschlag. Das System ist für den Käufer sehr viel
schwieriger als unser öffentliches Ausgebot. Er muß sich über
die Wertbemessung im voraus vollkommen im klaren sein,
kann sich nicht dem Fluß der Auktion selbst überlassen, um
sein Gebot zu steigern. Auf einer japanischen Auktion kann
nicht getrieben werden, weil keiner weiß, wieviel der andere
bietet. Es ist aber auch keine Verabredung der Käufer mög-
lich, weil niemand wissen kann, ob nicht ein Außenstehender,
der bei uns immer noch überboten werden kann, ein ange-
messenes Gebot in die Büchse gelegt hat, das jeden Ver-
such einer „Kippe" illusorisch macht.
Es ist kaum anzunehmen, daß das anspruchsvolle System
der japanischen Auktion in Europa einmal Eingang finden
wird, und daß es ebenfalls seine Schattenseiten hat, soll
keineswegs verkannt werden. Sicher aber schließt es we-
niger natürliche Gefahren und Fehlerquellen in sich als die
uns geläufige Methode der Versteigerung, deren sich jeder
bewußt sein muß, der sich in die eigentümliche Atmosphäre
eines Auktionssaales hineinwagt, und die auch jeder kennen
sollte, der nur die Berichte liest und nicht blindlings Zahlen
vertrauen will. Denn auch Zahlen können lügen.
—r.
DAS HAUS DER NATIONEN
T~\er Völkerbund rüstet sich zu seiner ersten weithin sicht-
bar schöpferischen Tat auf dem Gebiete der Kunst. Er
will sich ein eignes Haus errichten, und er hat, wie hier
schon kurz berichtet wurde, dafür ein Preisausschreiben er-
lassen, an dem sich die Baukünstler von 56 Staaten beteiligen
sollen. Amerikaner und Chinesen, Südafrikaner und Deutsche,
Argentinier und Franzosen werden also zu einem fried-
lichen Wettbewerb sich zusammenfinden, und es wird — in
einem übertragenen Sinne — zum zweiten Male ein Turm-
bau zu Babel geplant werden.
Es ist nicht leicht abzusehen, welche Richtlinien das
Preisgericht, das selbst aus sehr ungleichen Elementen zu-
sammengesetzt ist, aufstellen wird, um sich durch das Wirr-
sal der zu erwartenden Projekte hindurchzufinden und das
beste von allem zur Ausführung zu empfehlen. Soll das
künftige Haus sich als die Leistung einer starken Persön-
lichkeit darstellen? Soll es einen nationalen Baustil reprä-
sentieren? Man möchte meinen, das ideale Ziel sei ein über-
nationales Gebilde. Aber es erhebt sich die Frage, ob
in der Kunst das Übernationale verwirklicht werden kann,
da alle Geschichte bisher Zeugnis ablegt von der nationalen
Gebundenheit auch der überragenden Leistung.
Nichts ist gefährlicher als ein charakterloses Volapük.
Aber, so lautet die nächste Frage, ist es überhaupt denk-
bar, etwa ein holländisches oder ein amerikanisches Haus
an das Ufer des Genfer Sees zu stellen? Denn nicht nur
der Zweck, auch der Ort des Gebäudes muß Berücksichti-
gung finden. Man erinnert sich der Konkurrenz für das
„Haus der Freundschaft", das Deutschland während des
Krieges in Konstantinopel errichten wollte. Nach allem Pro-
jekten wäre das Haus ein Fremdkörper innerhalb seiner Um-
gebung geworden. Aber es hätte wenigstens einen Sinn ge-
habt und seine Bestimmung angezeigt, wenn es als Deutsches
Bauwerk inmitten der türkischen Hauptstadt kenntlich ge-
wesen wäre.
Der Palast aller Nationen in Genf jedoch darf nicht den
Stempel nationaler Gebundenheit an der Stirn tragen. Er
muß übernationales Gepräge haben, und er soll doch nicht
der Stadt, in der er Gastrecht genießt, ins Gesicht schlagen.
Man kann daran zweifeln, ob diese Aufgabe überhaupt
lösbar ist. Wenn aber, so scheint es, daß unsere Zeit
bessere Voraussetzungen dafür bringt, als vergangene Jahr-
zehnte vermocht hätten. Denn es ist ein neuer Baustil im
Werden, an dessen Bildung viele Nationen gleichermaßen
Anteil haben. Überall regen sich die produktiven Kräfte
gerade unter den jüngeren Architekten, die vergleichsweise
stärkere Begabungen aufzuweisen haben als ihre malenden
oder bildnerisch tätigen Kollegen.
Das Haus der Nationen wäre die große und entschei-
dende Aufgabe der neuen Baukunst. In Genf könnte sie,
die überall noch im Kampfe steht, den endlichen Sieg da-
vontragen. Hier wird es für sie gelten, sich zu erweisen.
Leider muß man aber fürchten, daß sich das Preisgericht
der großen Verantwortung, die es zu tragen hat, nicht ge-
wachsen zeigen wird. Jedes Preisgericht ist zu Kompro-
missen verurteilt, da es nicht für sich, sondern für einen
Auftraggeber zu entscheiden hat. Dieses Preisgericht, in dem
ein Sprachengewirr herrscht, wie es noch selten erlebt wurde,
wird weniger als jedes andere zu produktiver Tat befähigt
sein.
Mit Schrecken sehen wir schon den säulenprangenden
Palast an den Ufern des Genfer Sees erwachsen, der ein
Symbol des Vergangenen, nicht des Werdenden ist. Fühlt
der Völkerbund selbst seine Aufgaben im Geiste der Zu-
kunft, will er im politischen Sinne mehr sein als eine Neu-
auflage alter Staatenbündnisse, so sollte er sich auch ein
Haus erbauen, das allem klassizistisch akademischen Schema
entsagt, entschlossen den Künstlern vertrauend, die Kraft
in sich fühlen, dem neuen Europa sein neues architektonisches
Gesicht zu geben. Über alle Bedenken hinweg sollte das
Preisgericht diesen Gedanken zur Richtlinie seiner Entschei-
dung nehmen.
39
andere Fehlerquellen einschließt, nicht aber diejenigen, an
denen die europäischen Versteigerungen leiden.
Wird in Japan eine Kunstsammlung versteigert, so steht
bei der öffentlichen Ausstellung unter jedem Gegenstand ein
tönernes Gefäß mit einem Spalt, ähnlich unseren Sparbüchsen.
Wer ein Gebot abzugeben beabsichtigt, hat einen Zettel mit
seinem Namen und dem Preise in die Büchse zu legen. Ist
die Ausstellung beendet, so werden die Büchsen geöffnet,
und derjenige, der das höchste Gebot abgegeben hat, erhält
den Zuschlag. Das System ist für den Käufer sehr viel
schwieriger als unser öffentliches Ausgebot. Er muß sich über
die Wertbemessung im voraus vollkommen im klaren sein,
kann sich nicht dem Fluß der Auktion selbst überlassen, um
sein Gebot zu steigern. Auf einer japanischen Auktion kann
nicht getrieben werden, weil keiner weiß, wieviel der andere
bietet. Es ist aber auch keine Verabredung der Käufer mög-
lich, weil niemand wissen kann, ob nicht ein Außenstehender,
der bei uns immer noch überboten werden kann, ein ange-
messenes Gebot in die Büchse gelegt hat, das jeden Ver-
such einer „Kippe" illusorisch macht.
Es ist kaum anzunehmen, daß das anspruchsvolle System
der japanischen Auktion in Europa einmal Eingang finden
wird, und daß es ebenfalls seine Schattenseiten hat, soll
keineswegs verkannt werden. Sicher aber schließt es we-
niger natürliche Gefahren und Fehlerquellen in sich als die
uns geläufige Methode der Versteigerung, deren sich jeder
bewußt sein muß, der sich in die eigentümliche Atmosphäre
eines Auktionssaales hineinwagt, und die auch jeder kennen
sollte, der nur die Berichte liest und nicht blindlings Zahlen
vertrauen will. Denn auch Zahlen können lügen.
—r.
DAS HAUS DER NATIONEN
T~\er Völkerbund rüstet sich zu seiner ersten weithin sicht-
bar schöpferischen Tat auf dem Gebiete der Kunst. Er
will sich ein eignes Haus errichten, und er hat, wie hier
schon kurz berichtet wurde, dafür ein Preisausschreiben er-
lassen, an dem sich die Baukünstler von 56 Staaten beteiligen
sollen. Amerikaner und Chinesen, Südafrikaner und Deutsche,
Argentinier und Franzosen werden also zu einem fried-
lichen Wettbewerb sich zusammenfinden, und es wird — in
einem übertragenen Sinne — zum zweiten Male ein Turm-
bau zu Babel geplant werden.
Es ist nicht leicht abzusehen, welche Richtlinien das
Preisgericht, das selbst aus sehr ungleichen Elementen zu-
sammengesetzt ist, aufstellen wird, um sich durch das Wirr-
sal der zu erwartenden Projekte hindurchzufinden und das
beste von allem zur Ausführung zu empfehlen. Soll das
künftige Haus sich als die Leistung einer starken Persön-
lichkeit darstellen? Soll es einen nationalen Baustil reprä-
sentieren? Man möchte meinen, das ideale Ziel sei ein über-
nationales Gebilde. Aber es erhebt sich die Frage, ob
in der Kunst das Übernationale verwirklicht werden kann,
da alle Geschichte bisher Zeugnis ablegt von der nationalen
Gebundenheit auch der überragenden Leistung.
Nichts ist gefährlicher als ein charakterloses Volapük.
Aber, so lautet die nächste Frage, ist es überhaupt denk-
bar, etwa ein holländisches oder ein amerikanisches Haus
an das Ufer des Genfer Sees zu stellen? Denn nicht nur
der Zweck, auch der Ort des Gebäudes muß Berücksichti-
gung finden. Man erinnert sich der Konkurrenz für das
„Haus der Freundschaft", das Deutschland während des
Krieges in Konstantinopel errichten wollte. Nach allem Pro-
jekten wäre das Haus ein Fremdkörper innerhalb seiner Um-
gebung geworden. Aber es hätte wenigstens einen Sinn ge-
habt und seine Bestimmung angezeigt, wenn es als Deutsches
Bauwerk inmitten der türkischen Hauptstadt kenntlich ge-
wesen wäre.
Der Palast aller Nationen in Genf jedoch darf nicht den
Stempel nationaler Gebundenheit an der Stirn tragen. Er
muß übernationales Gepräge haben, und er soll doch nicht
der Stadt, in der er Gastrecht genießt, ins Gesicht schlagen.
Man kann daran zweifeln, ob diese Aufgabe überhaupt
lösbar ist. Wenn aber, so scheint es, daß unsere Zeit
bessere Voraussetzungen dafür bringt, als vergangene Jahr-
zehnte vermocht hätten. Denn es ist ein neuer Baustil im
Werden, an dessen Bildung viele Nationen gleichermaßen
Anteil haben. Überall regen sich die produktiven Kräfte
gerade unter den jüngeren Architekten, die vergleichsweise
stärkere Begabungen aufzuweisen haben als ihre malenden
oder bildnerisch tätigen Kollegen.
Das Haus der Nationen wäre die große und entschei-
dende Aufgabe der neuen Baukunst. In Genf könnte sie,
die überall noch im Kampfe steht, den endlichen Sieg da-
vontragen. Hier wird es für sie gelten, sich zu erweisen.
Leider muß man aber fürchten, daß sich das Preisgericht
der großen Verantwortung, die es zu tragen hat, nicht ge-
wachsen zeigen wird. Jedes Preisgericht ist zu Kompro-
missen verurteilt, da es nicht für sich, sondern für einen
Auftraggeber zu entscheiden hat. Dieses Preisgericht, in dem
ein Sprachengewirr herrscht, wie es noch selten erlebt wurde,
wird weniger als jedes andere zu produktiver Tat befähigt
sein.
Mit Schrecken sehen wir schon den säulenprangenden
Palast an den Ufern des Genfer Sees erwachsen, der ein
Symbol des Vergangenen, nicht des Werdenden ist. Fühlt
der Völkerbund selbst seine Aufgaben im Geiste der Zu-
kunft, will er im politischen Sinne mehr sein als eine Neu-
auflage alter Staatenbündnisse, so sollte er sich auch ein
Haus erbauen, das allem klassizistisch akademischen Schema
entsagt, entschlossen den Künstlern vertrauend, die Kraft
in sich fühlen, dem neuen Europa sein neues architektonisches
Gesicht zu geben. Über alle Bedenken hinweg sollte das
Preisgericht diesen Gedanken zur Richtlinie seiner Entschei-
dung nehmen.
39