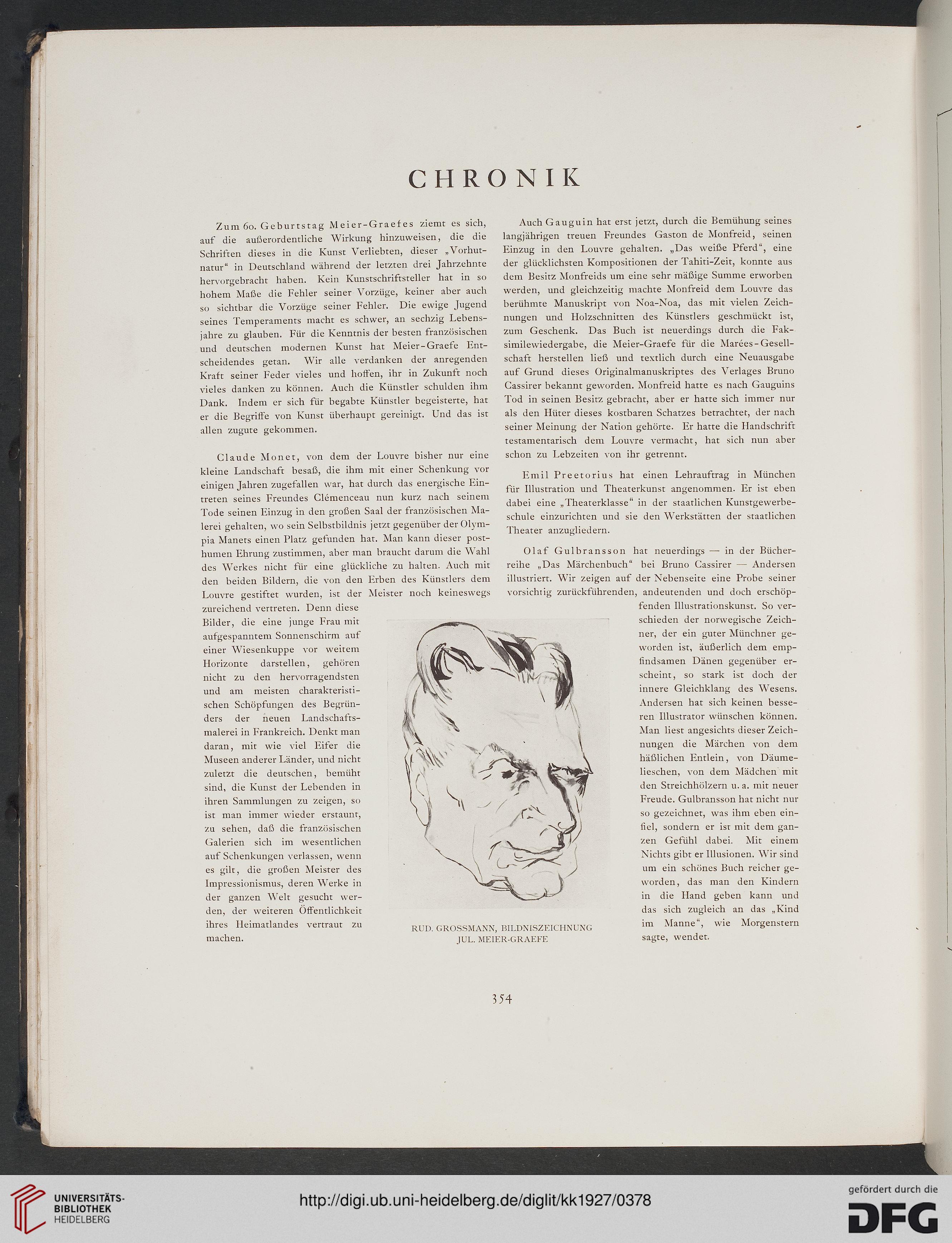CHRONIK
Zum 60. Geburtstag Meier-Graefes ziemt es sich,
auf die außerordentliche Wirkung hinzuweisen, die die
Schriften dieses in die Kunst Verliebten, dieser „Vorhut-
natur" in Deutschland während der letzten drei Jahrzehnte
hervorgebracht haben. Kein Kunstschriftsteller hat in so
hohem Maße die Fehler seiner Vorzüge, keiner aber auch
so sichtbar die Vorzüge seiner Fehler. Die ewige Jugend
seines Temperaments macht es schwer, an sechzig Lebens-
jahre zu glauben. Für die Kenntnis der besten französischen
und deutschen modernen Kunst hat Meier-Graefe Ent-
scheidendes getan. Wir alle verdanken der anregenden
Kraft seiner Feder vieles und hoffen, ihr in Zukunft noch
vieles danken zu können. Auch die Künstler schulden ihm
Dank. Indem er sich für begabte Künstler begeisterte, hat
er die Begriffe von Kunst überhaupt gereinigt. Und das ist
allen zugute gekommen.
Claude Monet, von dem der Louvre bisher nur eine
kleine Landschaft besaß, die ihm mit einer Schenkung vor
einigen Jahren zugefallen war, hat durch das energische Ein-
treten seines Freundes Clemenceau nun kurz nach seinem
Tode seinen Einzug in den großen Saal der französischen Ma-
lerei gehalten, wo sein Selbstbildnis jetzt gegenüber der Olym-
pia Manets einen Platz gefunden hat. Man kann dieser post-
humen Ehrung zustimmen, aber man braucht darum die Wahl
des Werkes nicht für eine glückliche zu halten. Auch mit
den beiden Bildern, die von den Erben des Künstlers dem
Louvre gestiftet wurden, ist der Meister noch keineswegs
zureichend vertreten. Denn diese
Bilder, die eine junge Frau mit
aufgespanntem Sonnenschirm auf
einer Wiesenkuppe vor weitem
Horizonte darstellen, gehören
nicht zu den hervorragendsten
und am meisten charakteristi-
schen Schöpfungen des Begrün-
ders der neuen Landschafts-
malerei in Frankreich. Denkt man
daran, mir wie viel Eifer die
Museen anderer Länder, und nicht
zuletzt die deutschen, bemüht
sind, die Kunst der Lebenden in
ihren Sammlungen zu zeigen, so
ist man immer wieder erstaunt,
zu sehen, daß die französischen
Galerien sich im wesentlichen
auf Schenkungen verlassen, wenn
es gilt, die großen Meister des
Impressionismus, deren Werke in
der ganzen Welt gesucht wer-
den, der weiteren Öffentlichkeit
ihres Heimatlandes vertraut zu
machen.
RUD. GROSSMANN, BILDNISZEICHNUNG
JUL. MEIER-GRAEFE
Auch Gauguin hat erst jetzt, durch die Bemühung seines
langjährigen treuen Freundes Gaston de Monfreid, seinen
Einzug in den Louvre gehalten. „Das weiße Pferd", eine
der glücklichsten Kompositionen der Tahiti-Zeit, konnte aus
dem Besitz Monfreids um eine sehr mäßige Summe erworben
werden, und gleichzeitig machte Monfreid dem Louvre das
berühmte Manuskript von Noa-Noa, das mit vielen Zeich-
nungen und Holzschnitten des Künstlers geschmückt ist,
zum Geschenk. Das Buch ist neuerdings durch die Fak-
similewiedergabe, die Meier-Graefe für die Marees-Gesell-
schaft herstellen ließ und textlich durch eine Neuausgabe
auf Grund dieses Originalmanuskriptes des Verlages Bruno
Cassirer bekannt geworden. Monfreid hatte es nach Gauguins
Tod in seinen Besitz gebracht, aber er hatte sich immer nur
als den Hüter dieses kostbaren Schatzes betrachtet, der nach
seiner Meinung der Nation gehörte. Er hatte die Handschrift
testamentarisch dem Louvre vermacht, hat sich nun aber
schon zu Lebzeiten von ihr getrennt.
Emil Preetorius hat einen Lehrauftrag in München
für Illustration und Theaterkunst angenommen. Er ist eben
dabei eine „Theaterklasse" in der staatlichen Kunstgewerbe-
schule einzurichten und sie den Werkstätten der staatlichen
Theater anzugliedern.
Olaf Gulbransson hat neuerdings — in der Bücher-
reihe „Das Märchenbuch" bei Bruno Cassirer — Andersen
illustriert. Wir zeigen auf der Nebenseite eine Probe seiner
vorsichtig zurückführenden, andeutenden und doch erschöp-
fenden Illustrationskunst. So ver-
schieden der norwegische Zeich-
ner, der ein guter Münchner ge-
worden ist, äußerlich dem emp-
findsamen Dänen gegenüber er-
scheint, so stark ist doch der
innere Gleichklang des Wesens.
Andersen hat sich keinen besse-
ren Illustrator wünschen können.
Man liest angesichts dieser Zeich-
nungen die Märchen von dem
häßlichen Entlein, von Däume-
lieschen, von dem Mädchen mit
den Streichhölzern u. a. mit neuer
Freude. Gulbransson hat nicht nur
so gezeichnet, was ihm eben ein-
fiel, sondern er ist mit dem gan-
zen Gefühl dabei. Mit einem
Nichts gibt er Illusionen. Wir sind
um ein schönes Buch reicher ge-
worden, das man den Kindern
in die Hand geben kann und
das sich zugleich an das „Kind
im Manne", wie Morgenstern
sagte, wendet.
354
Zum 60. Geburtstag Meier-Graefes ziemt es sich,
auf die außerordentliche Wirkung hinzuweisen, die die
Schriften dieses in die Kunst Verliebten, dieser „Vorhut-
natur" in Deutschland während der letzten drei Jahrzehnte
hervorgebracht haben. Kein Kunstschriftsteller hat in so
hohem Maße die Fehler seiner Vorzüge, keiner aber auch
so sichtbar die Vorzüge seiner Fehler. Die ewige Jugend
seines Temperaments macht es schwer, an sechzig Lebens-
jahre zu glauben. Für die Kenntnis der besten französischen
und deutschen modernen Kunst hat Meier-Graefe Ent-
scheidendes getan. Wir alle verdanken der anregenden
Kraft seiner Feder vieles und hoffen, ihr in Zukunft noch
vieles danken zu können. Auch die Künstler schulden ihm
Dank. Indem er sich für begabte Künstler begeisterte, hat
er die Begriffe von Kunst überhaupt gereinigt. Und das ist
allen zugute gekommen.
Claude Monet, von dem der Louvre bisher nur eine
kleine Landschaft besaß, die ihm mit einer Schenkung vor
einigen Jahren zugefallen war, hat durch das energische Ein-
treten seines Freundes Clemenceau nun kurz nach seinem
Tode seinen Einzug in den großen Saal der französischen Ma-
lerei gehalten, wo sein Selbstbildnis jetzt gegenüber der Olym-
pia Manets einen Platz gefunden hat. Man kann dieser post-
humen Ehrung zustimmen, aber man braucht darum die Wahl
des Werkes nicht für eine glückliche zu halten. Auch mit
den beiden Bildern, die von den Erben des Künstlers dem
Louvre gestiftet wurden, ist der Meister noch keineswegs
zureichend vertreten. Denn diese
Bilder, die eine junge Frau mit
aufgespanntem Sonnenschirm auf
einer Wiesenkuppe vor weitem
Horizonte darstellen, gehören
nicht zu den hervorragendsten
und am meisten charakteristi-
schen Schöpfungen des Begrün-
ders der neuen Landschafts-
malerei in Frankreich. Denkt man
daran, mir wie viel Eifer die
Museen anderer Länder, und nicht
zuletzt die deutschen, bemüht
sind, die Kunst der Lebenden in
ihren Sammlungen zu zeigen, so
ist man immer wieder erstaunt,
zu sehen, daß die französischen
Galerien sich im wesentlichen
auf Schenkungen verlassen, wenn
es gilt, die großen Meister des
Impressionismus, deren Werke in
der ganzen Welt gesucht wer-
den, der weiteren Öffentlichkeit
ihres Heimatlandes vertraut zu
machen.
RUD. GROSSMANN, BILDNISZEICHNUNG
JUL. MEIER-GRAEFE
Auch Gauguin hat erst jetzt, durch die Bemühung seines
langjährigen treuen Freundes Gaston de Monfreid, seinen
Einzug in den Louvre gehalten. „Das weiße Pferd", eine
der glücklichsten Kompositionen der Tahiti-Zeit, konnte aus
dem Besitz Monfreids um eine sehr mäßige Summe erworben
werden, und gleichzeitig machte Monfreid dem Louvre das
berühmte Manuskript von Noa-Noa, das mit vielen Zeich-
nungen und Holzschnitten des Künstlers geschmückt ist,
zum Geschenk. Das Buch ist neuerdings durch die Fak-
similewiedergabe, die Meier-Graefe für die Marees-Gesell-
schaft herstellen ließ und textlich durch eine Neuausgabe
auf Grund dieses Originalmanuskriptes des Verlages Bruno
Cassirer bekannt geworden. Monfreid hatte es nach Gauguins
Tod in seinen Besitz gebracht, aber er hatte sich immer nur
als den Hüter dieses kostbaren Schatzes betrachtet, der nach
seiner Meinung der Nation gehörte. Er hatte die Handschrift
testamentarisch dem Louvre vermacht, hat sich nun aber
schon zu Lebzeiten von ihr getrennt.
Emil Preetorius hat einen Lehrauftrag in München
für Illustration und Theaterkunst angenommen. Er ist eben
dabei eine „Theaterklasse" in der staatlichen Kunstgewerbe-
schule einzurichten und sie den Werkstätten der staatlichen
Theater anzugliedern.
Olaf Gulbransson hat neuerdings — in der Bücher-
reihe „Das Märchenbuch" bei Bruno Cassirer — Andersen
illustriert. Wir zeigen auf der Nebenseite eine Probe seiner
vorsichtig zurückführenden, andeutenden und doch erschöp-
fenden Illustrationskunst. So ver-
schieden der norwegische Zeich-
ner, der ein guter Münchner ge-
worden ist, äußerlich dem emp-
findsamen Dänen gegenüber er-
scheint, so stark ist doch der
innere Gleichklang des Wesens.
Andersen hat sich keinen besse-
ren Illustrator wünschen können.
Man liest angesichts dieser Zeich-
nungen die Märchen von dem
häßlichen Entlein, von Däume-
lieschen, von dem Mädchen mit
den Streichhölzern u. a. mit neuer
Freude. Gulbransson hat nicht nur
so gezeichnet, was ihm eben ein-
fiel, sondern er ist mit dem gan-
zen Gefühl dabei. Mit einem
Nichts gibt er Illusionen. Wir sind
um ein schönes Buch reicher ge-
worden, das man den Kindern
in die Hand geben kann und
das sich zugleich an das „Kind
im Manne", wie Morgenstern
sagte, wendet.
354