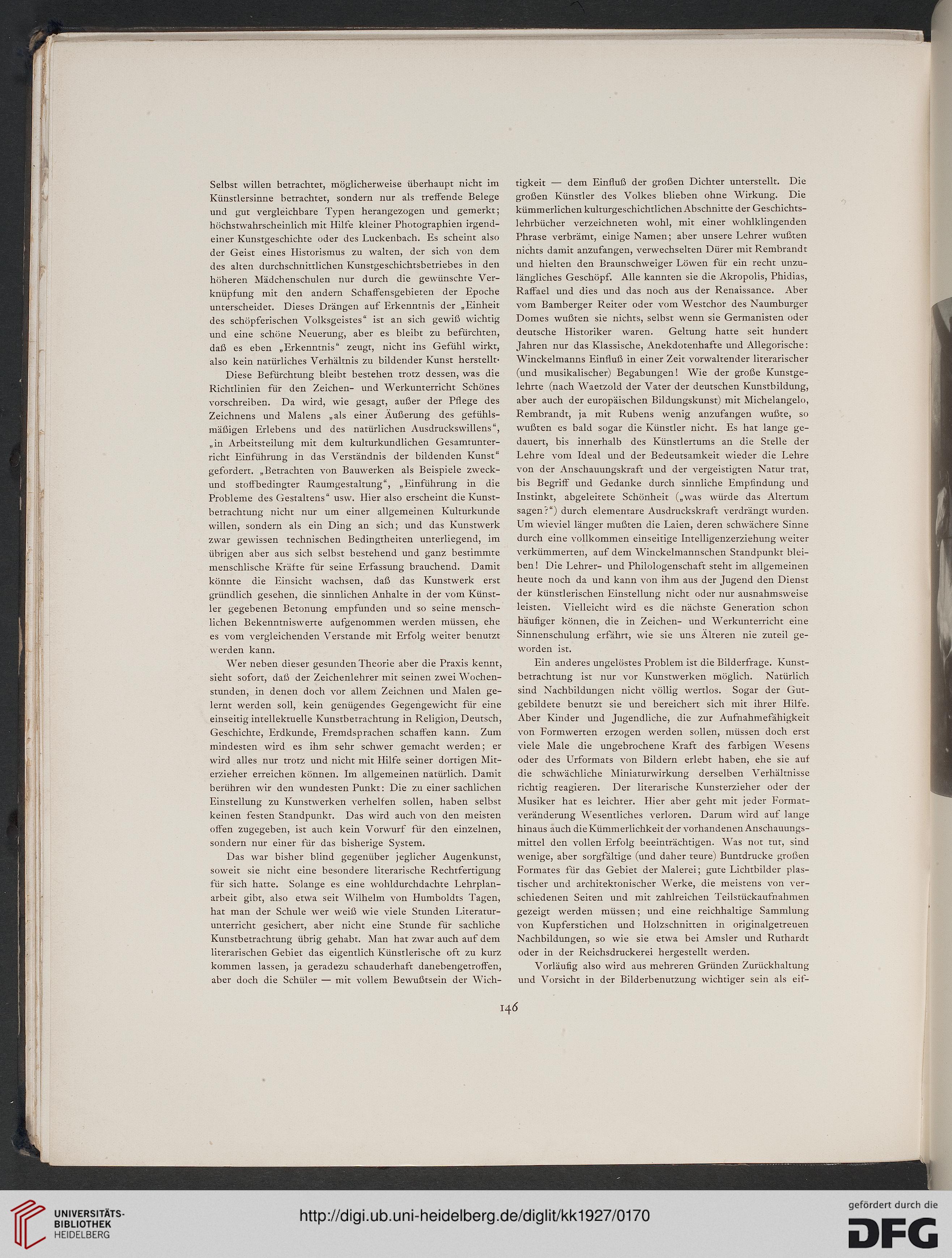Selbst willen betrachtet, möglicherweise überhaupt nicht im
Künstlersinne betrachtet, sondern nur als treffende Belege
und gut vergleichbare Typen herangezogen und gemerkt;
höchstwahrscheinlich mit Hilfe kleiner Photographien irgend-
einer Kunstgeschichte oder des Luckenbach. Es scheint also
der Geist eines Historismus zu walten, der sich von dem
des alten durchschnittlichen Kunstgeschichtsbetriebes in den
höheren Mädchenschulen nur durch die gewünschte Ver-
knüpfung mit den andern Schaffensgebieten der Epoche
unterscheidet. Dieses Drängen auf Erkenntnis der „Einheit
des schöpferischen Volksgeistes" ist an sich gewiß wichtig
und eine schöne Neuerung, aber es bleibt zu befürchten,
daß es eben „Erkenntnis" zeugt, nicht ins Gefühl wirkt,
also kein natürliches Verhältnis zu bildender Kunst herstellt-
Diese Befürchtung bleibt bestehen trotz dessen, was die
Richtlinien für den Zeichen- und Werkunterricht Schönes
vorschreiben. Da wird, wie gesagt, außer der Pflege des
Zeichnens und Malens „als einer Äußerung des gefühls-
mäßigen Erlebens und des natürlichen Ausdrucks willens",
„in Arbeitsteilung mit dem kulturkundlichen Gesamtunter-
richt Einführung in das Verständnis der bildenden Kunst"
gefordert. „Betrachten von Bauwerken als Beispiele zweck-
und stoffbedingter Raumgestaltung", „Einführung in die
Probleme des Gestaltens" usw. Hier also erscheint die Kunst-
betrachtung nicht nur um einer allgemeinen Kulturkunde
willen, sondern als ein Ding an sich; und das Kunstwerk
zwar gewissen technischen Bedingtheiten unterliegend, im
übrigen aber aus sich selbst bestehend und ganz bestimmte
menschlische Kräfte für seine Erfassung brauchend. Damit
könnte die Einsicht wachsen, daß das Kunstwerk erst
gründlich gesehen, die sinnlichen Anhalte in der vom Künst-
ler gegebenen Betonung empfunden und so seine mensch-
lichen Bekenntniswerte aufgenommen werden müssen, ehe
es vom vergleichenden Verstände mit Erfolg weiter benutzt
werden kann.
Wer neben dieser gesunden Theorie aber die Praxis kennt,
sieht sofort, daß der Zeichenlehrer mit seinen zwei Wochen-
stunden, in denen doch vor allem Zeichnen und Malen ge-
lernt werden soll, kein genügendes Gegengewicht für eine
einseitig intellektuelle Kunstbetrachtung in Religion, Deutsch,
Geschichte, Erdkunde, Fremdsprachen schaffen kann. Zum
mindesten wird es ihm sehr schwer gemacht werden; er
wird alles nur trotz und nicht mit Hilfe seiner dortigen Mit-
erzieher erreichen können. Im allgemeinen natürlich. Damit
berühren wir den wundesten Punkt: Die zu einer sachlichen
Einstellung zu Kunstwerken verhelfen sollen, haben selbst
keinen festen Standpunkt. Das wird auch von den meisten
offen zugegeben, ist auch kein Vorwurf für den einzelnen,
sondern nur einer für das bisherige System.
Das war bisher blind gegenüber jeglicher Augenkunst,
soweit sie nicht eine besondere literarische Rechtfertigung
für sich hatte. Solange es eine wohldurchdachte Lehrplan-
arbeit gibt, also etwa seit Wilhelm von Humboldts Tagen,
hat man der Schule wer weiß wie viele Stunden Literatur-
unterricht gesichert, aber nicht eine Stunde für sachliche
Kunstbetrachtung übrig gehabt. Man hat zwar auch auf dem
literarischen Gebiet das eigentlich Künstlerische oft zu kurz
kommen lassen, ja geradezu schauderhaft danebengetroffen,
aber doch die Schüler — mit vollem Bewußtsein der Wich-
tigkeit — dem Einfluß der großen Dichter unterstellt. Die
großen Künstler des Volkes blieben ohne Wirkung. Die
kümmerlichen kulturgeschichtlichenAbschnitte der Geschichts-
lehrbücher verzeichneten wohl, mit einer wohlklingenden
Phrase verbrämt, einige Namen; aber unsere Lehrer wußten
nichts damit anzufangen, verwechselten Dürer mit Rembrandt
und hielten den Braunschweiger Löwen für ein recht unzu-
längliches Geschöpf. Alle kannten sie die Akropolis, Phidias,
Raffael und dies und das noch aus der Renaissance. Aber
vom Bamberger Reiter oder vom Westchor des Naumburger
Domes wußten sie nichts, selbst wenn sie Germanisten oder
deutsche Historiker waren. Geltung hatte seit hundert
Jahren nur das Klassische, Anekdotenhafte und Allegorische:
Winckelmanns Einfluß in einer Zeit vorwaltender literarischer
(und musikalischer) Begabungen! Wie der große Kunstge-
lehrte (nach Waetzold der Vater der deutschen Kunstbildung,
aber auch der europäischen Bildungskunst) mit Michelangelo,
Rembrandt, ja mit Rubens wenig anzufangen wußte, so
wußten es bald sogar die Künstler nicht. Es hat lange ge-
dauert, bis innerhalb des Künstlertums an die Stelle der
Lehre vom Ideal und der Bedeutsamkeit wieder die Lehre
von der Anschauungskraft und der vergeistigten Natur trat,
bis Begriff und Gedanke durch sinnliche Emplindung und
Instinkt, abgeleitete Schönheit („was würde das Altertum
sagen?") durch elementare Ausdruckskraft verdrängt wurden.
Um wieviel länger mußten die Laien, deren schwächere Sinne
durch eine vollkommen einseitige Intelligenzerziehung weiter
verkümmerten, auf dem Winckelmannschen Standpunkt blei-
ben! Die Lehrer- und Philologenschaft steht im allgemeinen
heute noch da und kann von ihm aus der Jugend den Dienst
der künstlerischen Einstellung nicht oder nur ausnahmsweise
leisten. Vielleicht wird es die nächste Generation schon
häufiger können, die in Zeichen- und Werkunterricht eine
Sinnenschulung erfährt, wie sie uns Alteren nie zuteil ge-
worden ist.
Ein anderes ungelöstes Problem ist die Bilderfrage. Kunst-
betrachtung ist nur vor Kunstwerken möglich. Natürlich
sind Nachbildungen nicht völlig wertlos. Sogar der Gut-
gebildete benutzt sie und bereichert sich mit ihrer Hilfe.
Aber Kinder und Jugendliche, die zur Aufnahmefähigkeit
von Formwerten erzogen werden sollen, müssen doch erst
viele Male die ungebrochene Kraft des farbigen Wesens
oder des Urformats von Bildern erlebt haben, ehe sie auf
die schwächliche Miniaturwirkung derselben Verhältnisse
richtig reagieren. Der literarische Kunsterzieher oder der
Musiker hat es leichter. Hier aber geht mit jeder Format-
veränderung Wesentliches verloren. Darum wird auf lange
hinaus auch die Kümmerlichkeit der vorhandenen Anschauungs-
mittel den vollen Erfolg beeinträchtigen. Was not tut, sind
wenige, aber sorgfältige (und daher teure) Buntdrucke großen
Formates für das Gebiet der Malerei; gute Lichtbilder plas-
tischer und architektonischer Werke, die meistens von ver-
schiedenen Seiten und mit zahlreichen Teilstückaufnahmen
gezeigt werden müssen; und eine reichhaltige Sammlung
von Kupferstichen und Holzschnitten in originalgetreuen
Nachbildungen, so wie sie etwa bei Amsler und Ruthatdt
oder in der Reichsdruckerei hergestellt werden.
Vorläufig also wird aus mehreren Gründen Zurückhaltung
und Vorsicht in der Bilderbenutzung wichtiger sein als eif-
146
Künstlersinne betrachtet, sondern nur als treffende Belege
und gut vergleichbare Typen herangezogen und gemerkt;
höchstwahrscheinlich mit Hilfe kleiner Photographien irgend-
einer Kunstgeschichte oder des Luckenbach. Es scheint also
der Geist eines Historismus zu walten, der sich von dem
des alten durchschnittlichen Kunstgeschichtsbetriebes in den
höheren Mädchenschulen nur durch die gewünschte Ver-
knüpfung mit den andern Schaffensgebieten der Epoche
unterscheidet. Dieses Drängen auf Erkenntnis der „Einheit
des schöpferischen Volksgeistes" ist an sich gewiß wichtig
und eine schöne Neuerung, aber es bleibt zu befürchten,
daß es eben „Erkenntnis" zeugt, nicht ins Gefühl wirkt,
also kein natürliches Verhältnis zu bildender Kunst herstellt-
Diese Befürchtung bleibt bestehen trotz dessen, was die
Richtlinien für den Zeichen- und Werkunterricht Schönes
vorschreiben. Da wird, wie gesagt, außer der Pflege des
Zeichnens und Malens „als einer Äußerung des gefühls-
mäßigen Erlebens und des natürlichen Ausdrucks willens",
„in Arbeitsteilung mit dem kulturkundlichen Gesamtunter-
richt Einführung in das Verständnis der bildenden Kunst"
gefordert. „Betrachten von Bauwerken als Beispiele zweck-
und stoffbedingter Raumgestaltung", „Einführung in die
Probleme des Gestaltens" usw. Hier also erscheint die Kunst-
betrachtung nicht nur um einer allgemeinen Kulturkunde
willen, sondern als ein Ding an sich; und das Kunstwerk
zwar gewissen technischen Bedingtheiten unterliegend, im
übrigen aber aus sich selbst bestehend und ganz bestimmte
menschlische Kräfte für seine Erfassung brauchend. Damit
könnte die Einsicht wachsen, daß das Kunstwerk erst
gründlich gesehen, die sinnlichen Anhalte in der vom Künst-
ler gegebenen Betonung empfunden und so seine mensch-
lichen Bekenntniswerte aufgenommen werden müssen, ehe
es vom vergleichenden Verstände mit Erfolg weiter benutzt
werden kann.
Wer neben dieser gesunden Theorie aber die Praxis kennt,
sieht sofort, daß der Zeichenlehrer mit seinen zwei Wochen-
stunden, in denen doch vor allem Zeichnen und Malen ge-
lernt werden soll, kein genügendes Gegengewicht für eine
einseitig intellektuelle Kunstbetrachtung in Religion, Deutsch,
Geschichte, Erdkunde, Fremdsprachen schaffen kann. Zum
mindesten wird es ihm sehr schwer gemacht werden; er
wird alles nur trotz und nicht mit Hilfe seiner dortigen Mit-
erzieher erreichen können. Im allgemeinen natürlich. Damit
berühren wir den wundesten Punkt: Die zu einer sachlichen
Einstellung zu Kunstwerken verhelfen sollen, haben selbst
keinen festen Standpunkt. Das wird auch von den meisten
offen zugegeben, ist auch kein Vorwurf für den einzelnen,
sondern nur einer für das bisherige System.
Das war bisher blind gegenüber jeglicher Augenkunst,
soweit sie nicht eine besondere literarische Rechtfertigung
für sich hatte. Solange es eine wohldurchdachte Lehrplan-
arbeit gibt, also etwa seit Wilhelm von Humboldts Tagen,
hat man der Schule wer weiß wie viele Stunden Literatur-
unterricht gesichert, aber nicht eine Stunde für sachliche
Kunstbetrachtung übrig gehabt. Man hat zwar auch auf dem
literarischen Gebiet das eigentlich Künstlerische oft zu kurz
kommen lassen, ja geradezu schauderhaft danebengetroffen,
aber doch die Schüler — mit vollem Bewußtsein der Wich-
tigkeit — dem Einfluß der großen Dichter unterstellt. Die
großen Künstler des Volkes blieben ohne Wirkung. Die
kümmerlichen kulturgeschichtlichenAbschnitte der Geschichts-
lehrbücher verzeichneten wohl, mit einer wohlklingenden
Phrase verbrämt, einige Namen; aber unsere Lehrer wußten
nichts damit anzufangen, verwechselten Dürer mit Rembrandt
und hielten den Braunschweiger Löwen für ein recht unzu-
längliches Geschöpf. Alle kannten sie die Akropolis, Phidias,
Raffael und dies und das noch aus der Renaissance. Aber
vom Bamberger Reiter oder vom Westchor des Naumburger
Domes wußten sie nichts, selbst wenn sie Germanisten oder
deutsche Historiker waren. Geltung hatte seit hundert
Jahren nur das Klassische, Anekdotenhafte und Allegorische:
Winckelmanns Einfluß in einer Zeit vorwaltender literarischer
(und musikalischer) Begabungen! Wie der große Kunstge-
lehrte (nach Waetzold der Vater der deutschen Kunstbildung,
aber auch der europäischen Bildungskunst) mit Michelangelo,
Rembrandt, ja mit Rubens wenig anzufangen wußte, so
wußten es bald sogar die Künstler nicht. Es hat lange ge-
dauert, bis innerhalb des Künstlertums an die Stelle der
Lehre vom Ideal und der Bedeutsamkeit wieder die Lehre
von der Anschauungskraft und der vergeistigten Natur trat,
bis Begriff und Gedanke durch sinnliche Emplindung und
Instinkt, abgeleitete Schönheit („was würde das Altertum
sagen?") durch elementare Ausdruckskraft verdrängt wurden.
Um wieviel länger mußten die Laien, deren schwächere Sinne
durch eine vollkommen einseitige Intelligenzerziehung weiter
verkümmerten, auf dem Winckelmannschen Standpunkt blei-
ben! Die Lehrer- und Philologenschaft steht im allgemeinen
heute noch da und kann von ihm aus der Jugend den Dienst
der künstlerischen Einstellung nicht oder nur ausnahmsweise
leisten. Vielleicht wird es die nächste Generation schon
häufiger können, die in Zeichen- und Werkunterricht eine
Sinnenschulung erfährt, wie sie uns Alteren nie zuteil ge-
worden ist.
Ein anderes ungelöstes Problem ist die Bilderfrage. Kunst-
betrachtung ist nur vor Kunstwerken möglich. Natürlich
sind Nachbildungen nicht völlig wertlos. Sogar der Gut-
gebildete benutzt sie und bereichert sich mit ihrer Hilfe.
Aber Kinder und Jugendliche, die zur Aufnahmefähigkeit
von Formwerten erzogen werden sollen, müssen doch erst
viele Male die ungebrochene Kraft des farbigen Wesens
oder des Urformats von Bildern erlebt haben, ehe sie auf
die schwächliche Miniaturwirkung derselben Verhältnisse
richtig reagieren. Der literarische Kunsterzieher oder der
Musiker hat es leichter. Hier aber geht mit jeder Format-
veränderung Wesentliches verloren. Darum wird auf lange
hinaus auch die Kümmerlichkeit der vorhandenen Anschauungs-
mittel den vollen Erfolg beeinträchtigen. Was not tut, sind
wenige, aber sorgfältige (und daher teure) Buntdrucke großen
Formates für das Gebiet der Malerei; gute Lichtbilder plas-
tischer und architektonischer Werke, die meistens von ver-
schiedenen Seiten und mit zahlreichen Teilstückaufnahmen
gezeigt werden müssen; und eine reichhaltige Sammlung
von Kupferstichen und Holzschnitten in originalgetreuen
Nachbildungen, so wie sie etwa bei Amsler und Ruthatdt
oder in der Reichsdruckerei hergestellt werden.
Vorläufig also wird aus mehreren Gründen Zurückhaltung
und Vorsicht in der Bilderbenutzung wichtiger sein als eif-
146