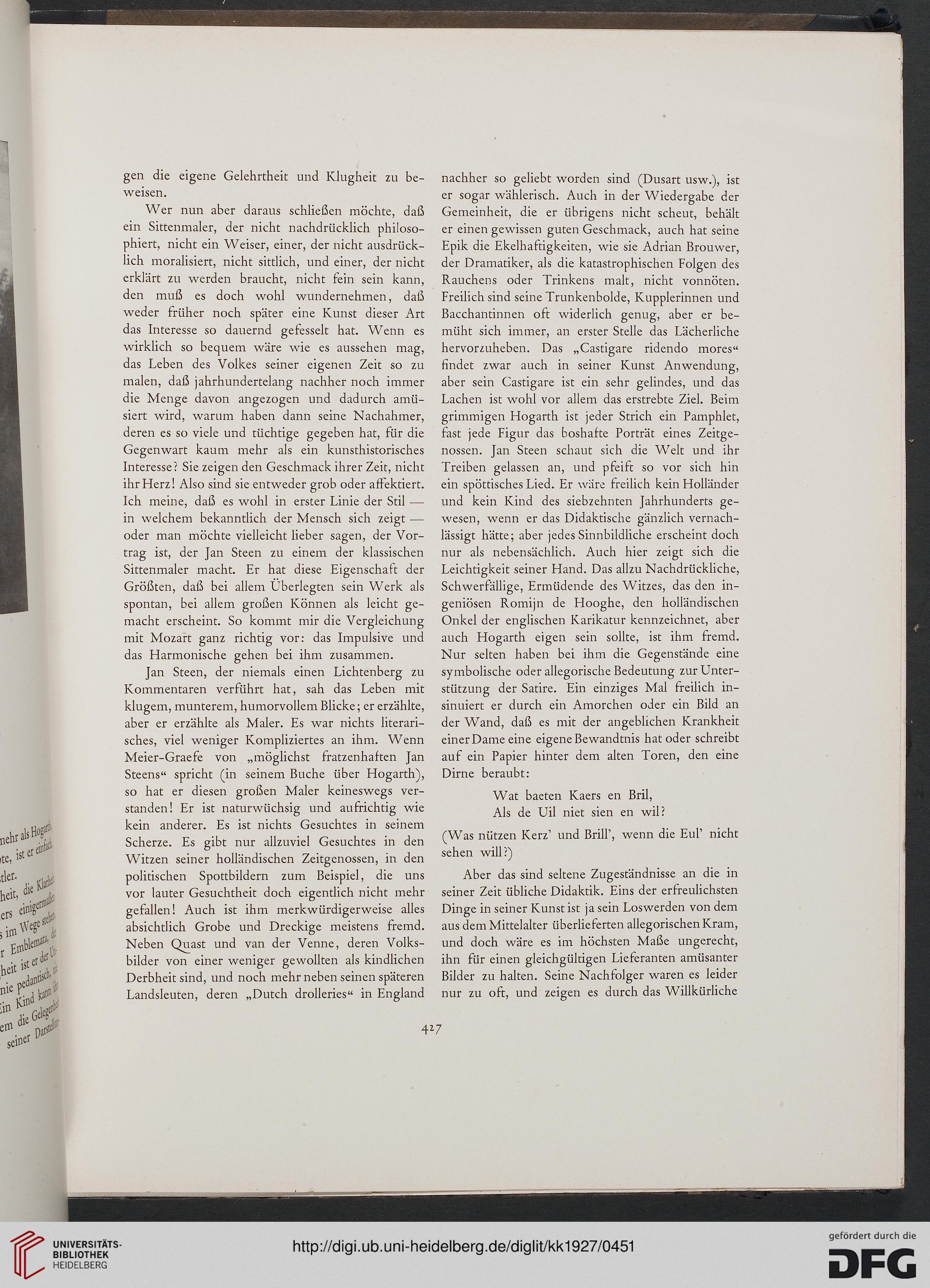1
die
einir
ist er c
gen die eigene Gelehrtheit und Klugheit zu be-
weisen.
Wer nun aber daraus schließen möchte, daß
ein Sittenmaler, der nicht nachdrücklich philoso-
phiert, nicht ein Weiser, einer, der nicht ausdrück-
lich moralisiert, nicht sittlich, und einer, der nicht
erklärt zu werden braucht, nicht fein sein kann,
den muß es doch wohl wundernehmen, daß
weder früher noch später eine Kunst dieser Art
das Interesse so dauernd gefesselt hat. Wenn es
wirklich so bequem wäre wie es aussehen mag,
das Leben des Volkes seiner eigenen Zeit so zu
malen, daß jahrhundertelang nachher noch immer
die Menge davon angezogen und dadurch amü-
siert wird, warum haben dann seine Nachahmer,
deren es so viele und tüchtige gegeben hat, für die
Gegenwart kaum mehr als ein kunsthistorisches
Interesse? Sie zeigen den Geschmack ihrer Zeit, nicht
ihr Herz! Also sind sie entweder grob oder affektiert.
Ich meine, daß es wohl in erster Linie der Stil —
in welchem bekanntlich der Mensch sich zeigt —
oder man möchte vielleicht lieber sagen, der Vor-
trag ist, der Jan Steen zu einem der klassischen
Sittenmaler macht. Er hat diese Eigenschaft der
Größten, daß bei allem Uberlegten sein Werk als
spontan, bei allem großen Können als leicht ge-
macht erscheint. So kommt mir die Vergleichung
mit Mozart ganz richtig vor: das Impulsive und
das Harmonische gehen bei ihm zusammen.
Jan Steen, der niemals einen Lichtenberg zu
Kommentaren verführt hat, sah das Leben mit
klugem, munterem, humorvollem Blicke; er erzählte,
aber er erzählte als Maler. Es war nichts literari-
sches, viel weniger Kompliziertes an ihm. Wenn
Meier-Graefe von „möglichst fratzenhaften Jan
Steens" spricht (in seinem Buche über Hogarth),
so hat er diesen großen Maler keineswegs ver-
standen! Er ist naturwüchsig und aufrichtig wie
kein anderer. Es ist nichts Gesuchtes in seinem
Scherze. Es gibt nur allzuviel Gesuchtes in den
Witzen seiner holländischen Zeitgenossen, in den
politischen Spottbildern zum Beispiel, die uns
vor lauter Gesuchtheit doch eigentlich nicht mehr
gefallen! Auch ist ihm merkwürdigerweise alles
absichtlich Grobe und Dreckige meistens fremd.
Neben Quast und van der Venne, deren Volks-
bilder von einer weniger gewollten als kindlichen
Derbheit sind, und noch mehr neben seinen späteren
Landsleuten, deren „Dutch drolleries" in England
nachher so geliebt worden sind (Dusart usw.), ist
er sogar wählerisch. Auch in der Wiedergabe der
Gemeinheit, die er übrigens nicht scheut, behält
er einen gewissen guten Geschmack, auch hat seine
Epik die Ekelhaftigkeiten, wie sie Adrian Brouwer,
der Dramatiker, als die katastrophischen Folgen des
Rauchens oder Trinkens malt, nicht vonnöten.
Freilich sind seine Trunkenbolde, Kupplerinnen und
Bacchantinnen oft widerlich genug, aber er be-
müht sich immer, an erster Stelle das Lächerliche
hervorzuheben. Das „Castigare ridendo mores"
findet zwar auch in seiner Kunst Anwendung,
aber sein Castigare ist ein sehr gelindes, und das
Lachen ist wohl vor allem das erstrebte Ziel. Beim
grimmigen Hogarth ist jeder Strich ein Pamphlet,
fast jede Figur das boshafte Porträt eines Zeitge-
nossen. Jan Steen schaut sich die Welt und ihr
Treiben gelassen an, und pfeift so vor sich hin
ein spöttisches Lied. Er wäre freilich kein Holländer
und kein Kind des siebzehnten Jahrhunderts ge-
wesen, wenn er das Didaktische gänzlich vernach-
lässigt hätte; aber jedes Sinnbildliche erscheint doch
nur als nebensächlich. Auch hier zeigt sich die
Leichtigkeit seiner Hand. Das allzu Nachdrückliche,
Schwerfällige, Ermüdende des Witzes, das den in-
geniösen Romijn de Hooghe, den holländischen
Onkel der englischen Karikatur kennzeichnet, aber
auch Hogarth eigen sein sollte, ist ihm fremd.
Nur selten haben bei ihm die Gegenstände eine
symbolische oder allegorische Bedeutung zur Unter-
stützung der Satire. Ein einziges Mal freilich in-
sinuiert er durch ein Amorchen oder ein Bild an
der Wand, daß es mit der angeblichen Krankheit
einer Dame eine eigene Bewandtnis hat oder schreibt
auf ein Papier hinter dem alten Toren, den eine
Dirne beraubt:
Wat baeten Kaers en Bril,
Als de Uil niet sien en wil?
(Was nützen Kerz' und Brill', wenn die EuP nicht
sehen will?)
Aber das sind seltene Zugeständnisse an die in
seiner Zeit übliche Didaktik. Eins der erfreulichsten
Dinge in seiner Kunst ist ja sein Loswerden von dem
aus dem Mittelalter überlieferten allegorischen Kram,
und doch wäre es im höchsten Maße ungerecht,
ihn für einen gleichgültigen Lieferanten amüsanter
Bilder zu halten. Seine Nachfolger waren es leider
nur zu oft, und zeigen es durch das Willkürliche
4*7
die
einir
ist er c
gen die eigene Gelehrtheit und Klugheit zu be-
weisen.
Wer nun aber daraus schließen möchte, daß
ein Sittenmaler, der nicht nachdrücklich philoso-
phiert, nicht ein Weiser, einer, der nicht ausdrück-
lich moralisiert, nicht sittlich, und einer, der nicht
erklärt zu werden braucht, nicht fein sein kann,
den muß es doch wohl wundernehmen, daß
weder früher noch später eine Kunst dieser Art
das Interesse so dauernd gefesselt hat. Wenn es
wirklich so bequem wäre wie es aussehen mag,
das Leben des Volkes seiner eigenen Zeit so zu
malen, daß jahrhundertelang nachher noch immer
die Menge davon angezogen und dadurch amü-
siert wird, warum haben dann seine Nachahmer,
deren es so viele und tüchtige gegeben hat, für die
Gegenwart kaum mehr als ein kunsthistorisches
Interesse? Sie zeigen den Geschmack ihrer Zeit, nicht
ihr Herz! Also sind sie entweder grob oder affektiert.
Ich meine, daß es wohl in erster Linie der Stil —
in welchem bekanntlich der Mensch sich zeigt —
oder man möchte vielleicht lieber sagen, der Vor-
trag ist, der Jan Steen zu einem der klassischen
Sittenmaler macht. Er hat diese Eigenschaft der
Größten, daß bei allem Uberlegten sein Werk als
spontan, bei allem großen Können als leicht ge-
macht erscheint. So kommt mir die Vergleichung
mit Mozart ganz richtig vor: das Impulsive und
das Harmonische gehen bei ihm zusammen.
Jan Steen, der niemals einen Lichtenberg zu
Kommentaren verführt hat, sah das Leben mit
klugem, munterem, humorvollem Blicke; er erzählte,
aber er erzählte als Maler. Es war nichts literari-
sches, viel weniger Kompliziertes an ihm. Wenn
Meier-Graefe von „möglichst fratzenhaften Jan
Steens" spricht (in seinem Buche über Hogarth),
so hat er diesen großen Maler keineswegs ver-
standen! Er ist naturwüchsig und aufrichtig wie
kein anderer. Es ist nichts Gesuchtes in seinem
Scherze. Es gibt nur allzuviel Gesuchtes in den
Witzen seiner holländischen Zeitgenossen, in den
politischen Spottbildern zum Beispiel, die uns
vor lauter Gesuchtheit doch eigentlich nicht mehr
gefallen! Auch ist ihm merkwürdigerweise alles
absichtlich Grobe und Dreckige meistens fremd.
Neben Quast und van der Venne, deren Volks-
bilder von einer weniger gewollten als kindlichen
Derbheit sind, und noch mehr neben seinen späteren
Landsleuten, deren „Dutch drolleries" in England
nachher so geliebt worden sind (Dusart usw.), ist
er sogar wählerisch. Auch in der Wiedergabe der
Gemeinheit, die er übrigens nicht scheut, behält
er einen gewissen guten Geschmack, auch hat seine
Epik die Ekelhaftigkeiten, wie sie Adrian Brouwer,
der Dramatiker, als die katastrophischen Folgen des
Rauchens oder Trinkens malt, nicht vonnöten.
Freilich sind seine Trunkenbolde, Kupplerinnen und
Bacchantinnen oft widerlich genug, aber er be-
müht sich immer, an erster Stelle das Lächerliche
hervorzuheben. Das „Castigare ridendo mores"
findet zwar auch in seiner Kunst Anwendung,
aber sein Castigare ist ein sehr gelindes, und das
Lachen ist wohl vor allem das erstrebte Ziel. Beim
grimmigen Hogarth ist jeder Strich ein Pamphlet,
fast jede Figur das boshafte Porträt eines Zeitge-
nossen. Jan Steen schaut sich die Welt und ihr
Treiben gelassen an, und pfeift so vor sich hin
ein spöttisches Lied. Er wäre freilich kein Holländer
und kein Kind des siebzehnten Jahrhunderts ge-
wesen, wenn er das Didaktische gänzlich vernach-
lässigt hätte; aber jedes Sinnbildliche erscheint doch
nur als nebensächlich. Auch hier zeigt sich die
Leichtigkeit seiner Hand. Das allzu Nachdrückliche,
Schwerfällige, Ermüdende des Witzes, das den in-
geniösen Romijn de Hooghe, den holländischen
Onkel der englischen Karikatur kennzeichnet, aber
auch Hogarth eigen sein sollte, ist ihm fremd.
Nur selten haben bei ihm die Gegenstände eine
symbolische oder allegorische Bedeutung zur Unter-
stützung der Satire. Ein einziges Mal freilich in-
sinuiert er durch ein Amorchen oder ein Bild an
der Wand, daß es mit der angeblichen Krankheit
einer Dame eine eigene Bewandtnis hat oder schreibt
auf ein Papier hinter dem alten Toren, den eine
Dirne beraubt:
Wat baeten Kaers en Bril,
Als de Uil niet sien en wil?
(Was nützen Kerz' und Brill', wenn die EuP nicht
sehen will?)
Aber das sind seltene Zugeständnisse an die in
seiner Zeit übliche Didaktik. Eins der erfreulichsten
Dinge in seiner Kunst ist ja sein Loswerden von dem
aus dem Mittelalter überlieferten allegorischen Kram,
und doch wäre es im höchsten Maße ungerecht,
ihn für einen gleichgültigen Lieferanten amüsanter
Bilder zu halten. Seine Nachfolger waren es leider
nur zu oft, und zeigen es durch das Willkürliche
4*7