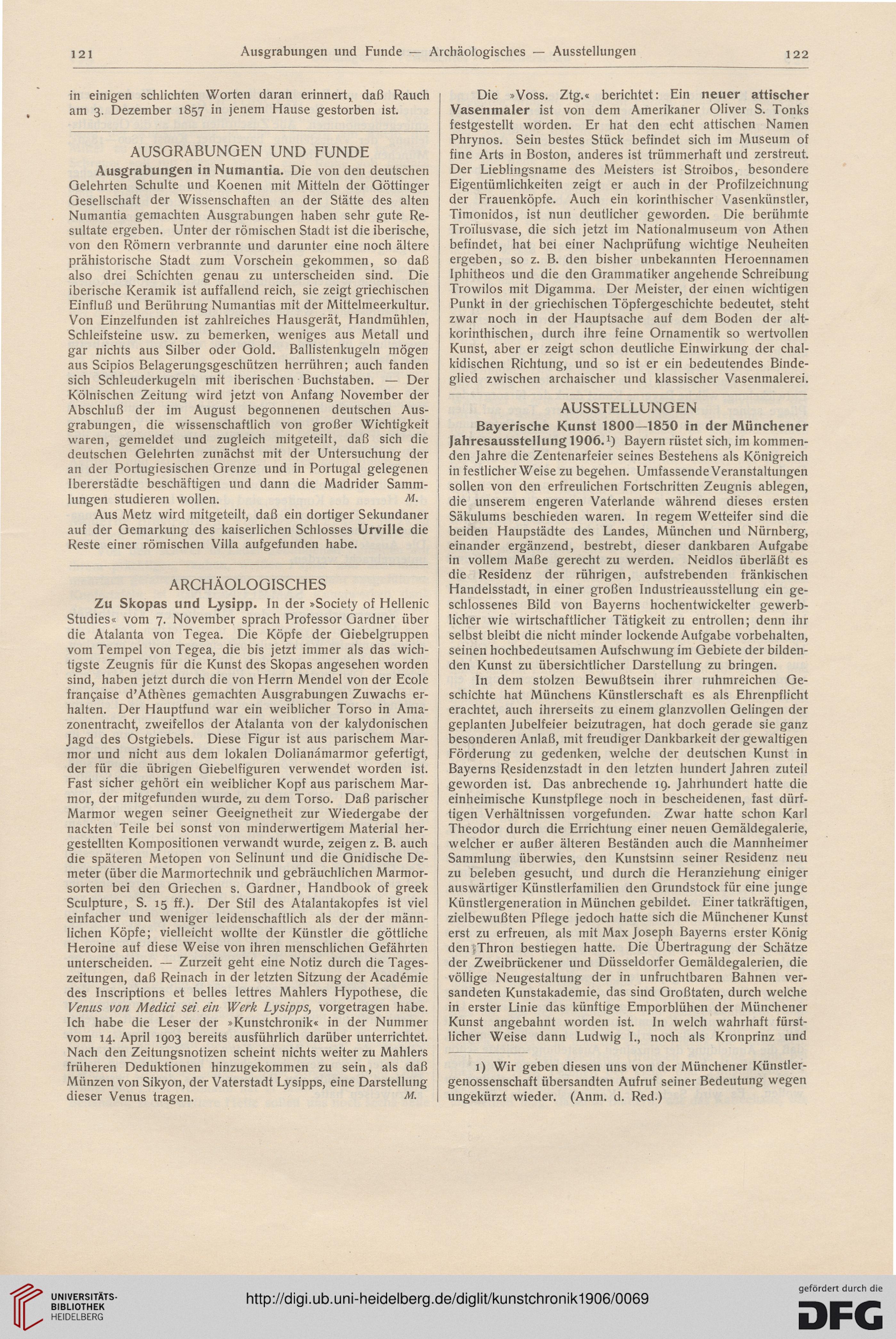121
Ausgrabungen und Funde — Archäologisches — Ausstellungen
122
in einigen schlichten Worten daran erinnert, daß Rauch
am 3. Dezember 1857 in jenem Hause gestorben ist.
AUSGRABUNGEN UND FUNDE
Ausgrabungen in Numantia. Die von den deutschen
Gelehrten Schulte und Koenen mit Mitteln der Qöttinger
Gesellschaft der Wissenschaften an der Stätte des alten
Numantia gemachten Ausgrabungen haben sehr gute Re-
sultate ergeben. Unter der römischen Stadt ist die iberische,
von den Römern verbrannte und darunter eine noch ältere
prähistorische Stadt zum Vorschein gekommen, so daß
also drei Schichten genau zu unterscheiden sind. Die
iberische Keramik ist auffallend reich, sie zeigt griechischen
Einfluß und Berührung Numantias mit der Mittelmeerkultur.
Von Einzelfunden ist zahlreiches Hausgerät, Handmühlen,
Schleifsteine usw. zu bemerken, weniges aus Metall und
gar nichts aus Silber oder Gold. Bailistenkugeln mögen
aus Scipios Belagerungsgeschützen herrühren; auch fanden
sich Schleuderkugeln mit iberischen Buchstaben. — Der
Kölnischen Zeitung wird jetzt von Anfang November der
Abschluß der im August begonnenen deutschen Aus-
grabungen, die wissenschaftlich von großer Wichtigkeit
waren, gemeldet und zugleich mitgeteilt, daß sich die
deutschen Gelehrten zunächst mit der Untersuchung der
an der Portugiesischen Grenze und in Portugal gelegenen
Ibererstädte beschäftigen und dann die Madrider Samm-
lungen studieren wollen. M.
Aus Metz wird mitgeteilt, daß ein dortiger Sekundaner
auf der Gemarkung des kaiserlichen Schlosses Urville die
Reste einer römischen Villa aufgefunden habe.
ARCHÄOLOGISCHES
Zu Skopas und Lysipp. In der »Society of Hellenic
Studies« vom 7. November sprach Professor Gardner über
die Atalanta von Tegea. Die Köpfe der Giebelgruppen
vom Tempel von Tegea, die bis jetzt immer als das wich-
tigste Zeugnis für die Kunst des Skopas angesehen worden
sind, haben jetzt durch die von Herrn Mendel von der Ecole
francaise d'Athenes gemachten Ausgrabungen Zuwachs er-
halten. Der Hauptfund war ein weiblicher Torso in Ama-
zonentracht, zweifellos der Atalanta von der kalydonischen
Jagd des Ostgiebels. Diese Figur ist aus parischem Mar-
mor und nicht aus dem lokalen Dolianamarmor gefertigt,
der für die übrigen Giebelfiguren verwendet worden ist.
Fast sicher gehört ein weiblicher Kopf aus parischem Mar-
mor, der mitgefunden wurde, zu dem Torso. Daß parischer
Marmor wegen seiner Geeignetheit zur Wiedergabe der
nackten Teile bei sonst von minderwertigem Material her-
gestellten Kompositionen verwandt wurde, zeigen z. B. auch
die späteren Metopen von Selinunt und die Gnidische De-
meter (über die Marmortechnik und gebräuchlichen Marmor-
sorten bei den Griechen s. Gardner, Handbook of greek
Sculpture, S. 15 ff.). Der Stil des Atalantakopfes ist viel
einfacher und weniger leidenschaftlich als der der männ-
lichen Köpfe; vielleicht wollte der Künstler die göttliche
Heroine auf diese Weise von ihren menschlichen Gefährten
unterscheiden. — Zurzeit geht eine Notiz durch die Tages-
zeitungen, daß Reinach in der letzten Sitzung der Academie
des Inscriptions et belles lettres Mahlers Hypothese, die
Venus von Medici sei. ein Werk Lysipps, vorgetragen habe.
Ich habe die Leser der »Kunstchronik« in der Nummer
vom 14. April 1903 bereits ausführlich darüber unterrichtet.
Nach den Zeitungsnotizen scheint nichts weiter zu Mahlers
früheren Deduktionen hinzugekommen zu sein, als daß
Münzen von Sikyon, der Vaterstadt Lysipps, eine Darstellung
dieser Venus tragen. M-
Die »Voss. Ztg.« berichtet: Ein neuer attischer
Vasenmaler ist von dem Amerikaner Oliver S. Tonks
festgestellt worden. Er hat den echt attischen Namen
Phrynos. Sein bestes Stück befindet sich im Museum of
fine Arts in Boston, anderes ist trümmerhaft und zerstreut.
Der Lieblingsname des Meisters ist Stroibos, besondere
Eigentümlichkeiten zeigt er auch in der Profilzeichnung
der Frauenköpfe. Auch ein korinthischer Vasenkünstler,
Timonidos, ist nun deutlicher geworden. Die berühmte
Troi'lusvase, die sich jetzt im Nationalmuseum von Athen
befindet, hat bei einer Nachprüfung wichtige Neuheiten
ergeben, so z. B. den bisher unbekannten Heroennamen
Iphitheos und die den Grammatiker angehende Schreibung
Trowilos mit Digamma. Der Meister, der einen wichtigen
Punkt in der griechischen Töpfergeschichte bedeutet, steht
zwar noch in der Hauptsache auf dem Boden der alt-
korinthischen, durch ihre feine Ornamentik so wertvollen
Kunst, aber er zeigt schon deutliche Einwirkung der chal-
kidischen Richtung, und so ist er ein bedeutendes Binde-
glied zwischen archaischer und klassischer Vasenmalerei.
AUSSTELLUNGEN
Bayerische Kunst 1800—1850 in der Münchener
Jahresausstellung 1906.J) Bayern rüstet sich, im kommen-
den Jahre die Zentenarfeier seines Bestehens als Königreich
in festlicher Weise zu begehen. Unifassende Veranstaltungen
sollen von den erfreulichen Fortschritten Zeugnis ablegen,
die unserem engeren Vaterlande während dieses ersten
Säkulums beschieden waren. In regem Wetteifer sind die
beiden Haupstädte des Landes, München und Nürnberg,
einander ergänzend, bestrebt, dieser dankbaren Aufgabe
in vollem Maße gerecht zu werden. Neidlos überläßt es
die Residenz der rührigen, aufstrebenden fränkischen
Handelsstadt, in einer großen Industrieausstellung ein ge-
schlossenes Bild von Bayerns hochentwickelter gewerb-
licher wie wirtschaftlicher Tätigkeit zu entrollen; denn ihr
selbst bleibt die nicht minder lockende Aufgabe vorbehalten,
seinen hochbedeutsamen Aufschwung im Gebiete der bilden-
den Kunst zu übersichtlicher Darstellung zu bringen.
In dem stolzen Bewußtsein ihrer ruhmreichen Ge-
schichte hat Münchens Künstlerschaft es als Ehrenpflicht
erachtet, auch ihrerseits zu einem glanzvollen Gelingen der
geplanten Jubelfeier beizutragen, hat doch gerade sie ganz
besonderen Anlaß, mit freudiger Dankbarkeit der gewaltigen
Förderung zu gedenken, welche der deutschen Kunst in
Bayerns Residenzstadt in den letzten hundert Jahren zuteil
geworden ist. Das anbrechende 19. Jahrhundert hatte die
einheimische Kunstpflege noch in bescheidenen, fast dürf-
tigen Verhältnissen vorgefunden. Zwar hatte schon Karl
Theodor durch die Errichtung einer neuen Gemäldegalerie,
welcher er außer älteren Beständen auch die Mannheimer
Sammlung überwies, den Kunstsinn seiner Residenz neu
zu beleben gesucht, und durch die Heranziehung einiger
auswärtiger Künstlerfamilien den Grundstock für eine junge
Künstlergeneration in München gebildet. Einer tatkräftigen,
zielbewußten Pflege jedoch hatte sich die Münchener Kunst
erst zu erfreuen, als mit Max Joseph Bayerns erster König
denfThron bestiegen hatte. Die Übertragung der Schätze
der Zweibrückener und Düsseldorfer Gemäldegalerien, die
völlige Neugestaltung der in unfruchtbaren Bahnen ver-
sandeten Kunstakademie, das sind Großtaten, durch welche
in erster Linie das künftige Emporblühen der Münchener
Kunst angebahnt worden ist. In welch wahrhaft fürst-
licher Weise dann Ludwig I., noch als Kronprinz und
1) Wir geben diesen uns von der Münchener Künstler-
genossenschaft übersandten Aufruf seiner Bedeutung wegen
ungekürzt wieder. (Anm. d. Red.)
Ausgrabungen und Funde — Archäologisches — Ausstellungen
122
in einigen schlichten Worten daran erinnert, daß Rauch
am 3. Dezember 1857 in jenem Hause gestorben ist.
AUSGRABUNGEN UND FUNDE
Ausgrabungen in Numantia. Die von den deutschen
Gelehrten Schulte und Koenen mit Mitteln der Qöttinger
Gesellschaft der Wissenschaften an der Stätte des alten
Numantia gemachten Ausgrabungen haben sehr gute Re-
sultate ergeben. Unter der römischen Stadt ist die iberische,
von den Römern verbrannte und darunter eine noch ältere
prähistorische Stadt zum Vorschein gekommen, so daß
also drei Schichten genau zu unterscheiden sind. Die
iberische Keramik ist auffallend reich, sie zeigt griechischen
Einfluß und Berührung Numantias mit der Mittelmeerkultur.
Von Einzelfunden ist zahlreiches Hausgerät, Handmühlen,
Schleifsteine usw. zu bemerken, weniges aus Metall und
gar nichts aus Silber oder Gold. Bailistenkugeln mögen
aus Scipios Belagerungsgeschützen herrühren; auch fanden
sich Schleuderkugeln mit iberischen Buchstaben. — Der
Kölnischen Zeitung wird jetzt von Anfang November der
Abschluß der im August begonnenen deutschen Aus-
grabungen, die wissenschaftlich von großer Wichtigkeit
waren, gemeldet und zugleich mitgeteilt, daß sich die
deutschen Gelehrten zunächst mit der Untersuchung der
an der Portugiesischen Grenze und in Portugal gelegenen
Ibererstädte beschäftigen und dann die Madrider Samm-
lungen studieren wollen. M.
Aus Metz wird mitgeteilt, daß ein dortiger Sekundaner
auf der Gemarkung des kaiserlichen Schlosses Urville die
Reste einer römischen Villa aufgefunden habe.
ARCHÄOLOGISCHES
Zu Skopas und Lysipp. In der »Society of Hellenic
Studies« vom 7. November sprach Professor Gardner über
die Atalanta von Tegea. Die Köpfe der Giebelgruppen
vom Tempel von Tegea, die bis jetzt immer als das wich-
tigste Zeugnis für die Kunst des Skopas angesehen worden
sind, haben jetzt durch die von Herrn Mendel von der Ecole
francaise d'Athenes gemachten Ausgrabungen Zuwachs er-
halten. Der Hauptfund war ein weiblicher Torso in Ama-
zonentracht, zweifellos der Atalanta von der kalydonischen
Jagd des Ostgiebels. Diese Figur ist aus parischem Mar-
mor und nicht aus dem lokalen Dolianamarmor gefertigt,
der für die übrigen Giebelfiguren verwendet worden ist.
Fast sicher gehört ein weiblicher Kopf aus parischem Mar-
mor, der mitgefunden wurde, zu dem Torso. Daß parischer
Marmor wegen seiner Geeignetheit zur Wiedergabe der
nackten Teile bei sonst von minderwertigem Material her-
gestellten Kompositionen verwandt wurde, zeigen z. B. auch
die späteren Metopen von Selinunt und die Gnidische De-
meter (über die Marmortechnik und gebräuchlichen Marmor-
sorten bei den Griechen s. Gardner, Handbook of greek
Sculpture, S. 15 ff.). Der Stil des Atalantakopfes ist viel
einfacher und weniger leidenschaftlich als der der männ-
lichen Köpfe; vielleicht wollte der Künstler die göttliche
Heroine auf diese Weise von ihren menschlichen Gefährten
unterscheiden. — Zurzeit geht eine Notiz durch die Tages-
zeitungen, daß Reinach in der letzten Sitzung der Academie
des Inscriptions et belles lettres Mahlers Hypothese, die
Venus von Medici sei. ein Werk Lysipps, vorgetragen habe.
Ich habe die Leser der »Kunstchronik« in der Nummer
vom 14. April 1903 bereits ausführlich darüber unterrichtet.
Nach den Zeitungsnotizen scheint nichts weiter zu Mahlers
früheren Deduktionen hinzugekommen zu sein, als daß
Münzen von Sikyon, der Vaterstadt Lysipps, eine Darstellung
dieser Venus tragen. M-
Die »Voss. Ztg.« berichtet: Ein neuer attischer
Vasenmaler ist von dem Amerikaner Oliver S. Tonks
festgestellt worden. Er hat den echt attischen Namen
Phrynos. Sein bestes Stück befindet sich im Museum of
fine Arts in Boston, anderes ist trümmerhaft und zerstreut.
Der Lieblingsname des Meisters ist Stroibos, besondere
Eigentümlichkeiten zeigt er auch in der Profilzeichnung
der Frauenköpfe. Auch ein korinthischer Vasenkünstler,
Timonidos, ist nun deutlicher geworden. Die berühmte
Troi'lusvase, die sich jetzt im Nationalmuseum von Athen
befindet, hat bei einer Nachprüfung wichtige Neuheiten
ergeben, so z. B. den bisher unbekannten Heroennamen
Iphitheos und die den Grammatiker angehende Schreibung
Trowilos mit Digamma. Der Meister, der einen wichtigen
Punkt in der griechischen Töpfergeschichte bedeutet, steht
zwar noch in der Hauptsache auf dem Boden der alt-
korinthischen, durch ihre feine Ornamentik so wertvollen
Kunst, aber er zeigt schon deutliche Einwirkung der chal-
kidischen Richtung, und so ist er ein bedeutendes Binde-
glied zwischen archaischer und klassischer Vasenmalerei.
AUSSTELLUNGEN
Bayerische Kunst 1800—1850 in der Münchener
Jahresausstellung 1906.J) Bayern rüstet sich, im kommen-
den Jahre die Zentenarfeier seines Bestehens als Königreich
in festlicher Weise zu begehen. Unifassende Veranstaltungen
sollen von den erfreulichen Fortschritten Zeugnis ablegen,
die unserem engeren Vaterlande während dieses ersten
Säkulums beschieden waren. In regem Wetteifer sind die
beiden Haupstädte des Landes, München und Nürnberg,
einander ergänzend, bestrebt, dieser dankbaren Aufgabe
in vollem Maße gerecht zu werden. Neidlos überläßt es
die Residenz der rührigen, aufstrebenden fränkischen
Handelsstadt, in einer großen Industrieausstellung ein ge-
schlossenes Bild von Bayerns hochentwickelter gewerb-
licher wie wirtschaftlicher Tätigkeit zu entrollen; denn ihr
selbst bleibt die nicht minder lockende Aufgabe vorbehalten,
seinen hochbedeutsamen Aufschwung im Gebiete der bilden-
den Kunst zu übersichtlicher Darstellung zu bringen.
In dem stolzen Bewußtsein ihrer ruhmreichen Ge-
schichte hat Münchens Künstlerschaft es als Ehrenpflicht
erachtet, auch ihrerseits zu einem glanzvollen Gelingen der
geplanten Jubelfeier beizutragen, hat doch gerade sie ganz
besonderen Anlaß, mit freudiger Dankbarkeit der gewaltigen
Förderung zu gedenken, welche der deutschen Kunst in
Bayerns Residenzstadt in den letzten hundert Jahren zuteil
geworden ist. Das anbrechende 19. Jahrhundert hatte die
einheimische Kunstpflege noch in bescheidenen, fast dürf-
tigen Verhältnissen vorgefunden. Zwar hatte schon Karl
Theodor durch die Errichtung einer neuen Gemäldegalerie,
welcher er außer älteren Beständen auch die Mannheimer
Sammlung überwies, den Kunstsinn seiner Residenz neu
zu beleben gesucht, und durch die Heranziehung einiger
auswärtiger Künstlerfamilien den Grundstock für eine junge
Künstlergeneration in München gebildet. Einer tatkräftigen,
zielbewußten Pflege jedoch hatte sich die Münchener Kunst
erst zu erfreuen, als mit Max Joseph Bayerns erster König
denfThron bestiegen hatte. Die Übertragung der Schätze
der Zweibrückener und Düsseldorfer Gemäldegalerien, die
völlige Neugestaltung der in unfruchtbaren Bahnen ver-
sandeten Kunstakademie, das sind Großtaten, durch welche
in erster Linie das künftige Emporblühen der Münchener
Kunst angebahnt worden ist. In welch wahrhaft fürst-
licher Weise dann Ludwig I., noch als Kronprinz und
1) Wir geben diesen uns von der Münchener Künstler-
genossenschaft übersandten Aufruf seiner Bedeutung wegen
ungekürzt wieder. (Anm. d. Red.)