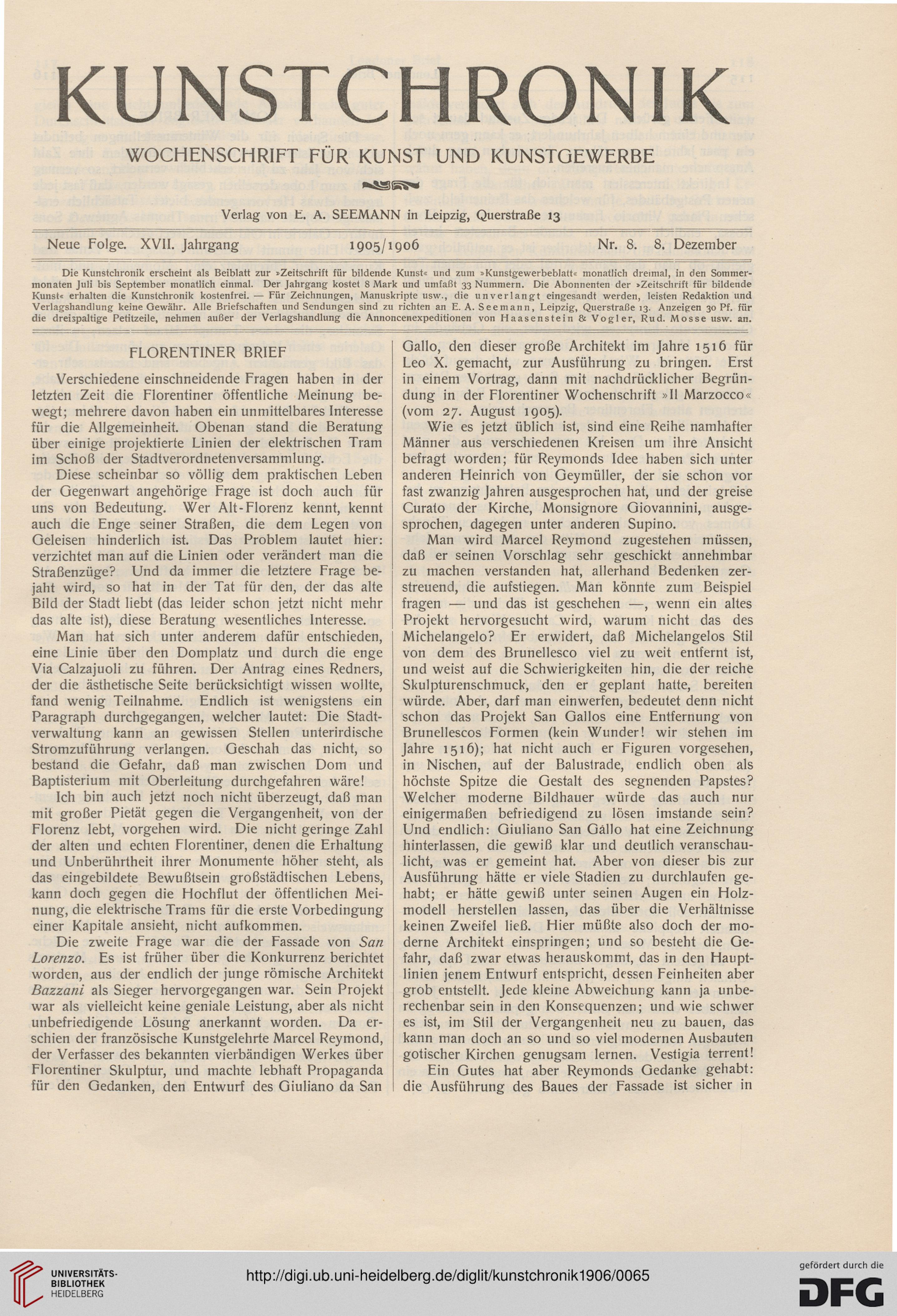KUNSTCHRONIK
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig, Querstraße 13
Neue Folge. XVII. Jahrgang 1905/1906 Nr. 8. 8. Dezember
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur »Zeitschrift für bildende Kunst« und zum »Kunstgewerbeblatt« monatlich dreimal, in den Sommer-
monaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfaßt 33 Nummern. Die Abonnenten der »Zeitschrift für bildende
Kunst« erhalten die Kunstchronik kostenfrei. — Für Zeichnungen, Manuskripte usw., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und
Verlagshandlung keine Gewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann, Leipzig, Querstraße 13. Anzeigen 30 Pf. für
die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein 8t Vogler, Rud. Mosse usw. an.
FLORENTINER BRIEF
Verschiedene einschneidende Fragen haben in der
letzten Zeit die Florentiner öffentliche Meinung be-
wegt; mehrere davon haben ein unmittelbares Interesse
für die Allgemeinheit. Obenan stand die Beratung
über einige projektierte Linien der elektrischen Tram
im Schoß der Stadtverordnetenversammlung.
Diese scheinbar so völlig dem praktischen Leben
der Gegenwart angehörige Frage ist doch auch für
uns von Bedeutung. Wer Alt-Florenz kennt, kennt
auch die Enge seiner Straßen, die dem Legen von
Geleisen hinderlich ist. Das Problem lautet hier:
verzichtet man auf die Linien oder verändert man die
Straßenzüge? Und da immer die letztere Frage be-
jaht wird, so hat in der Tat für den, der das alte
Bild der Stadt liebt (das leider schon jetzt nicht mehr
das alte ist), diese Beratung wesentliches Interesse.
Man hat sich unter anderem dafür entschieden,
eine Linie über den Domplatz und durch die enge
Via Calzajuoli zu führen. Der Antrag eines Redners,
der die ästhetische Seite berücksichtigt wissen wollte,
fand wenig Teilnahme. Endlich ist wenigstens ein
Paragraph durchgegangen, welcher lautet: Die Stadt-
verwaltung kann an gewissen Stellen unterirdische
Stromzuführung verlangen. Geschah das nicht, so
bestand die Gefahr, daß man zwischen Dom und
Baptisterium mit Oberleitung durchgefahren wäre!
Ich bin auch jetzt noch nicht überzeugt, daß man
mit großer Pietät gegen die Vergangenheit, von der
Florenz lebt, vorgehen wird. Die nicht geringe Zahl
der alten und echten Florentiner, denen die Erhaltung
und Unberührtheit ihrer Monumente höher steht, als
das eingebildete Bewußtsein großstädtischen Lebens,
kann doch gegen die Hochflut der öffentlichen Mei-
nung, die elektrische Trams für die erste Vorbedingung
einer Kapitale ansieht, nicht aufkommen.
Die zweite Frage war die der Fassade von San
Lorenzo. Es ist früher über die Konkurrenz berichtet
worden, aus der endlich der junge römische Architekt
Bazzani als Sieger hervorgegangen war. Sein Projekt
war als vielleicht keine geniale Leistung, aber als nicht
unbefriedigende Lösung anerkannt worden. Da er-
schien der französische Kunstgelehrte Marcel Reymond,
der Verfasser des bekannten vierbändigen Werkes über
Florentiner Skulptur, und machte lebhaft Propaganda
für den Gedanken, den Entwurf des Giuliano da San
Gallo, den dieser große Architekt im Jahre 1516 für
Leo X. gemacht, zur Ausführung zu bringen. Erst
in einem Vortrag, dann mit nachdrücklicher Begrün-
dung in der Florentiner Wochenschrift »II Marzocco«
(vom 27. August 1905).
Wie es jetzt üblich ist, sind eine Reihe namhafter
Männer aus verschiedenen Kreisen um ihre Ansicht
befragt worden; für Reymonds Idee haben sich unter
anderen Heinrich von Geymüller, der sie schon vor
fast zwanzig Jahren ausgesprochen hat, und der greise
Curato der Kirche, Monsignore Giovannini, ausge-
sprochen, dagegen unter anderen Supino.
Man wird Marcel Reymond zugestehen müssen,
daß er seinen Vorschlag sehr geschickt annehmbar
zu machen verstanden hat, allerhand Bedenken zer-
streuend, die aufstiegen. Man könnte zum Beispiel
fragen — und das ist geschehen —, wenn ein altes
Projekt hervorgesucht wird, warum nicht das des
Michelangelo? Er erwidert, daß Michelangelos Stil
von dem des Brunellesco viel zu weit entfernt ist,
und weist auf die Schwierigkeiten hin, die der reiche
Skulpturenschmuck, den er geplant hatte, bereiten
würde. Aber, darf man einwerfen, bedeutet denn nicht
schon das Projekt San Gallos eine Entfernung von
Brunellescos Formen (kein Wunder! wir stehen im
Jahre 1516); hat nicht auch er Figuren vorgesehen,
in Nischen, auf der Balustrade, endlich oben als
höchste Spitze die Gestalt des segnenden Papstes?
Welcher moderne Bildhauer würde das auch nur
einigermaßen befriedigend zu lösen imstande sein?
Und endlich: Giuliano San Gallo hat eine Zeichnung
hinterlassen, die gewiß klar und deutlich veranschau-
licht, was er gemeint hat. Aber von dieser bis zur
Ausführung hätte er viele Stadien zu durchlaufen ge-
habt; er hätte gewiß unter seinen Augen ein Holz-
modell herstellen lassen, das über die Verhältnisse
keinen Zweifel ließ. Hier müßte also doch der mo-
derne Architekt einspringen; und so besteht die Ge-
fahr, daß zwar etwas herauskommt, das in den Haupt-
linien jenem Entwurf entspricht, dessen Feinheiten aber
grob entstellt. Jede kleine Abweichung kann ja unbe-
rechenbar sein in den Konsequenzen; und wie schwer
es ist, im Stil der Vergangenheit neu zu bauen, das
kann man doch an so und so viel modernen Ausbauten
gotischer Kirchen genugsam lernen. Vestigia terrent!
Ein Gutes hat aber Reymonds Gedanke gehabt:
die Ausführung des Baues der Fassade ist sicher in
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig, Querstraße 13
Neue Folge. XVII. Jahrgang 1905/1906 Nr. 8. 8. Dezember
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur »Zeitschrift für bildende Kunst« und zum »Kunstgewerbeblatt« monatlich dreimal, in den Sommer-
monaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfaßt 33 Nummern. Die Abonnenten der »Zeitschrift für bildende
Kunst« erhalten die Kunstchronik kostenfrei. — Für Zeichnungen, Manuskripte usw., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und
Verlagshandlung keine Gewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann, Leipzig, Querstraße 13. Anzeigen 30 Pf. für
die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein 8t Vogler, Rud. Mosse usw. an.
FLORENTINER BRIEF
Verschiedene einschneidende Fragen haben in der
letzten Zeit die Florentiner öffentliche Meinung be-
wegt; mehrere davon haben ein unmittelbares Interesse
für die Allgemeinheit. Obenan stand die Beratung
über einige projektierte Linien der elektrischen Tram
im Schoß der Stadtverordnetenversammlung.
Diese scheinbar so völlig dem praktischen Leben
der Gegenwart angehörige Frage ist doch auch für
uns von Bedeutung. Wer Alt-Florenz kennt, kennt
auch die Enge seiner Straßen, die dem Legen von
Geleisen hinderlich ist. Das Problem lautet hier:
verzichtet man auf die Linien oder verändert man die
Straßenzüge? Und da immer die letztere Frage be-
jaht wird, so hat in der Tat für den, der das alte
Bild der Stadt liebt (das leider schon jetzt nicht mehr
das alte ist), diese Beratung wesentliches Interesse.
Man hat sich unter anderem dafür entschieden,
eine Linie über den Domplatz und durch die enge
Via Calzajuoli zu führen. Der Antrag eines Redners,
der die ästhetische Seite berücksichtigt wissen wollte,
fand wenig Teilnahme. Endlich ist wenigstens ein
Paragraph durchgegangen, welcher lautet: Die Stadt-
verwaltung kann an gewissen Stellen unterirdische
Stromzuführung verlangen. Geschah das nicht, so
bestand die Gefahr, daß man zwischen Dom und
Baptisterium mit Oberleitung durchgefahren wäre!
Ich bin auch jetzt noch nicht überzeugt, daß man
mit großer Pietät gegen die Vergangenheit, von der
Florenz lebt, vorgehen wird. Die nicht geringe Zahl
der alten und echten Florentiner, denen die Erhaltung
und Unberührtheit ihrer Monumente höher steht, als
das eingebildete Bewußtsein großstädtischen Lebens,
kann doch gegen die Hochflut der öffentlichen Mei-
nung, die elektrische Trams für die erste Vorbedingung
einer Kapitale ansieht, nicht aufkommen.
Die zweite Frage war die der Fassade von San
Lorenzo. Es ist früher über die Konkurrenz berichtet
worden, aus der endlich der junge römische Architekt
Bazzani als Sieger hervorgegangen war. Sein Projekt
war als vielleicht keine geniale Leistung, aber als nicht
unbefriedigende Lösung anerkannt worden. Da er-
schien der französische Kunstgelehrte Marcel Reymond,
der Verfasser des bekannten vierbändigen Werkes über
Florentiner Skulptur, und machte lebhaft Propaganda
für den Gedanken, den Entwurf des Giuliano da San
Gallo, den dieser große Architekt im Jahre 1516 für
Leo X. gemacht, zur Ausführung zu bringen. Erst
in einem Vortrag, dann mit nachdrücklicher Begrün-
dung in der Florentiner Wochenschrift »II Marzocco«
(vom 27. August 1905).
Wie es jetzt üblich ist, sind eine Reihe namhafter
Männer aus verschiedenen Kreisen um ihre Ansicht
befragt worden; für Reymonds Idee haben sich unter
anderen Heinrich von Geymüller, der sie schon vor
fast zwanzig Jahren ausgesprochen hat, und der greise
Curato der Kirche, Monsignore Giovannini, ausge-
sprochen, dagegen unter anderen Supino.
Man wird Marcel Reymond zugestehen müssen,
daß er seinen Vorschlag sehr geschickt annehmbar
zu machen verstanden hat, allerhand Bedenken zer-
streuend, die aufstiegen. Man könnte zum Beispiel
fragen — und das ist geschehen —, wenn ein altes
Projekt hervorgesucht wird, warum nicht das des
Michelangelo? Er erwidert, daß Michelangelos Stil
von dem des Brunellesco viel zu weit entfernt ist,
und weist auf die Schwierigkeiten hin, die der reiche
Skulpturenschmuck, den er geplant hatte, bereiten
würde. Aber, darf man einwerfen, bedeutet denn nicht
schon das Projekt San Gallos eine Entfernung von
Brunellescos Formen (kein Wunder! wir stehen im
Jahre 1516); hat nicht auch er Figuren vorgesehen,
in Nischen, auf der Balustrade, endlich oben als
höchste Spitze die Gestalt des segnenden Papstes?
Welcher moderne Bildhauer würde das auch nur
einigermaßen befriedigend zu lösen imstande sein?
Und endlich: Giuliano San Gallo hat eine Zeichnung
hinterlassen, die gewiß klar und deutlich veranschau-
licht, was er gemeint hat. Aber von dieser bis zur
Ausführung hätte er viele Stadien zu durchlaufen ge-
habt; er hätte gewiß unter seinen Augen ein Holz-
modell herstellen lassen, das über die Verhältnisse
keinen Zweifel ließ. Hier müßte also doch der mo-
derne Architekt einspringen; und so besteht die Ge-
fahr, daß zwar etwas herauskommt, das in den Haupt-
linien jenem Entwurf entspricht, dessen Feinheiten aber
grob entstellt. Jede kleine Abweichung kann ja unbe-
rechenbar sein in den Konsequenzen; und wie schwer
es ist, im Stil der Vergangenheit neu zu bauen, das
kann man doch an so und so viel modernen Ausbauten
gotischer Kirchen genugsam lernen. Vestigia terrent!
Ein Gutes hat aber Reymonds Gedanke gehabt:
die Ausführung des Baues der Fassade ist sicher in