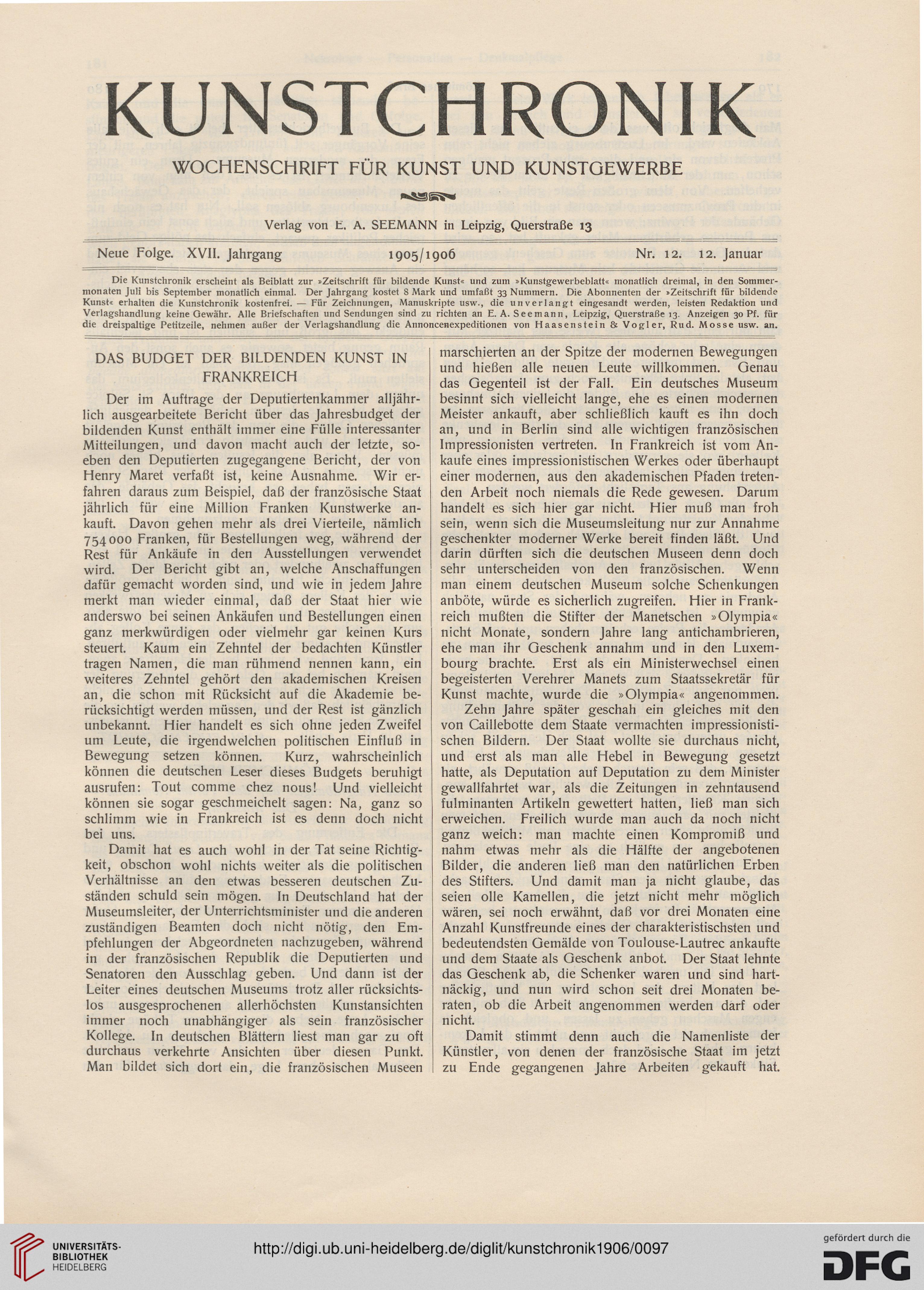KUNSTCHRONIK
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig, Querstraße 13
Neue Folge. XVII. Jahrgang 1905/1906 Nr. 12. 12. Januar
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur »Zeitschrift für bildende Kunst« und zum »Kunstgewerbeblatt« monatlich dreimal, in den Sommer-
monaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfaßt 33 Nummern. Die Abonnenten der »Zeitschrift für bildende
Kunst« erhalten die Kunstchronik kostenfrei. — Für Zeichnungen, Manuskripte usw., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und
Verlagshandlung keine Gewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann, Leipzig, Querstraße 13. Anzeigen 30 Pf. für
die dreispaltige Peritzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse usw. an.
DAS BUDGET DER BILDENDEN KUNST IN
FRANKREICH
Der im Auftrage der Deputiertenkammer alljähr-
lich ausgearbeitete Bericht über das Jahresbudget der
bildenden Kunst enthält immer eine Fülle interessanter
Mitteilungen, und davon macht auch der letzte, so-
eben den Deputierten zugegangene Bericht, der von
Henry Maret verfaßt ist, keine Ausnahme. Wir er-
fahren daraus zum Beispiel, daß der französische Staat
jährlich für eine Million Franken Kunstwerke an-
kauft. Davon gehen mehr als drei Vierteile, nämlich
754000 Franken, für Bestellungen weg, während der
Rest für Ankäufe in den Ausstellungen verwendet
wird. Der Bericht gibt an, welche Anschaffungen
dafür gemacht worden sind, und wie in jedem Jahre
merkt man wieder einmal, daß der Staat hier wie
anderswo bei seinen Ankäufen und Bestellungen einen
ganz merkwürdigen oder vielmehr gar keinen Kurs
steuert. Kaum ein Zehntel der bedachten Künstler
tragen Namen, die man rühmend nennen kann, ein
weiteres Zehntel gehört den akademischen Kreisen
an, die schon mit Rücksicht auf die Akademie be-
rücksichtigt werden müssen, und der Rest ist gänzlich
unbekannt. Hier handelt es sich ohne jeden Zweifel
um Leute, die irgendwelchen politischen Einfluß in
Bewegung setzen können. Kurz, wahrscheinlich
können die deutschen Leser dieses Budgets beruhigt
ausrufen: Tout comme chez nous! Und vielleicht
können sie sogar geschmeichelt sagen: Na, ganz so
schlimm wie in Frankreich ist es denn doch nicht
bei uns.
Damit hat es auch wohl in der Tat seine Richtig-
keit, obschon wohl nichts weiter als die politischen
Verhältnisse an den etwas besseren deutschen Zu-
ständen schuld sein mögen. In Deutschland hat der
Museumsleiter, der Unterrichtsminister und die anderen
zuständigen Beamten doch nicht nötig, den Em-
pfehlungen der Abgeordneten nachzugeben, während
in der französischen Republik die Deputierten und
Senatoren den Ausschlag geben. Und dann ist der
Leiter eines deutschen Museums trotz aller rücksichts-
los ausgesprochenen allerhöchsten Kunstansichten
immer noch unabhängiger als sein französischer
Kollege. In deutschen Blättern liest man gar zu oft
durchaus verkehrte Ansichten über diesen Punkt.
Man bildet sich dort ein, die französischen Museen
marschierten an der Spitze der modernen Bewegungen
und hießen alle neuen Leute willkommen. Genau
das Gegenteil ist der Fall. Ein deutsches Museum
besinnt sich vielleicht lange, ehe es einen modernen
Meister ankauft, aber schließlich kauft es ihn doch
an, und in Berlin sind alle wichtigen französischen
Impressionisten vertreten. In Frankreich ist vom An-
kaufe eines impressionistischen Werkes oder überhaupt
einer modernen, aus den akademischen Pfaden treten-
den Arbeit noch niemals die Rede gewesen. Darum
handelt es sich hier gar nicht. Hier muß man froh
sein, wenn sich die Museumsleitung nur zur Annahme
geschenkter moderner Werke bereit finden läßt. Und
darin dürften sich die deutschen Museen denn doch
sehr unterscheiden von den französischen. Wenn
man einem deutschen Museum solche Schenkungen
anböte, würde es sicherlich zugreifen. Hier in Frank-
reich mußten die Stifter der Manetschen »Olympia«
nicht Monate, sondern Jahre lang antichambrieren,
ehe man ihr Geschenk annahm und in den Luxem-
bourg brachte. Erst als ein Ministerwechsel einen
begeisterten Verehrer Manets zum Staatssekretär für
Kunst machte, wurde die »Olympia« angenommen.
Zehn Jahre später geschah ein gleiches mit den
von Caillebotte dem Staate vermachten impressionisti-
schen Bildern. Der Staat wollte sie durchaus nicht,
und erst als man alle Hebel in Bewegung gesetzt
hatte, als Deputation auf Deputation zu dem Minister
gewallfahrtet war, als die Zeitungen in zehntausend
fulminanten Artikeln gewettert hatten, ließ man sich
erweichen. Freilich wurde man auch da noch nicht
ganz weich: man machte einen Kompromiß und
nahm etwas mehr als die Hälfte der angebotenen
Bilder, die anderen ließ man den natürlichen Erben
des Stifters. Und damit man ja nicht glaube, das
seien olle Kamellen, die jetzt nicht mehr möglich
wären, sei noch erwähnt, daß vor drei Monaten eine
Anzahl Kunstfreunde eines der charakteristischsten und
bedeutendsten Gemälde von Toulouse-Lautrec ankaufte
und dem Staate als Geschenk anbot. Der Staat lehnte
das Geschenk ab, die Schenker waren und sind hart-
näckig, und nun wird schon seit drei Monaten be-
raten, ob die Arbeit angenommen werden darf oder
nicht.
Damit stimmt denn auch die Namenliste der
Künstler, von denen der französische Staat im jetzt
zu Ende gegangenen Jahre Arbeiten gekauft hat.
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig, Querstraße 13
Neue Folge. XVII. Jahrgang 1905/1906 Nr. 12. 12. Januar
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur »Zeitschrift für bildende Kunst« und zum »Kunstgewerbeblatt« monatlich dreimal, in den Sommer-
monaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfaßt 33 Nummern. Die Abonnenten der »Zeitschrift für bildende
Kunst« erhalten die Kunstchronik kostenfrei. — Für Zeichnungen, Manuskripte usw., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und
Verlagshandlung keine Gewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann, Leipzig, Querstraße 13. Anzeigen 30 Pf. für
die dreispaltige Peritzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse usw. an.
DAS BUDGET DER BILDENDEN KUNST IN
FRANKREICH
Der im Auftrage der Deputiertenkammer alljähr-
lich ausgearbeitete Bericht über das Jahresbudget der
bildenden Kunst enthält immer eine Fülle interessanter
Mitteilungen, und davon macht auch der letzte, so-
eben den Deputierten zugegangene Bericht, der von
Henry Maret verfaßt ist, keine Ausnahme. Wir er-
fahren daraus zum Beispiel, daß der französische Staat
jährlich für eine Million Franken Kunstwerke an-
kauft. Davon gehen mehr als drei Vierteile, nämlich
754000 Franken, für Bestellungen weg, während der
Rest für Ankäufe in den Ausstellungen verwendet
wird. Der Bericht gibt an, welche Anschaffungen
dafür gemacht worden sind, und wie in jedem Jahre
merkt man wieder einmal, daß der Staat hier wie
anderswo bei seinen Ankäufen und Bestellungen einen
ganz merkwürdigen oder vielmehr gar keinen Kurs
steuert. Kaum ein Zehntel der bedachten Künstler
tragen Namen, die man rühmend nennen kann, ein
weiteres Zehntel gehört den akademischen Kreisen
an, die schon mit Rücksicht auf die Akademie be-
rücksichtigt werden müssen, und der Rest ist gänzlich
unbekannt. Hier handelt es sich ohne jeden Zweifel
um Leute, die irgendwelchen politischen Einfluß in
Bewegung setzen können. Kurz, wahrscheinlich
können die deutschen Leser dieses Budgets beruhigt
ausrufen: Tout comme chez nous! Und vielleicht
können sie sogar geschmeichelt sagen: Na, ganz so
schlimm wie in Frankreich ist es denn doch nicht
bei uns.
Damit hat es auch wohl in der Tat seine Richtig-
keit, obschon wohl nichts weiter als die politischen
Verhältnisse an den etwas besseren deutschen Zu-
ständen schuld sein mögen. In Deutschland hat der
Museumsleiter, der Unterrichtsminister und die anderen
zuständigen Beamten doch nicht nötig, den Em-
pfehlungen der Abgeordneten nachzugeben, während
in der französischen Republik die Deputierten und
Senatoren den Ausschlag geben. Und dann ist der
Leiter eines deutschen Museums trotz aller rücksichts-
los ausgesprochenen allerhöchsten Kunstansichten
immer noch unabhängiger als sein französischer
Kollege. In deutschen Blättern liest man gar zu oft
durchaus verkehrte Ansichten über diesen Punkt.
Man bildet sich dort ein, die französischen Museen
marschierten an der Spitze der modernen Bewegungen
und hießen alle neuen Leute willkommen. Genau
das Gegenteil ist der Fall. Ein deutsches Museum
besinnt sich vielleicht lange, ehe es einen modernen
Meister ankauft, aber schließlich kauft es ihn doch
an, und in Berlin sind alle wichtigen französischen
Impressionisten vertreten. In Frankreich ist vom An-
kaufe eines impressionistischen Werkes oder überhaupt
einer modernen, aus den akademischen Pfaden treten-
den Arbeit noch niemals die Rede gewesen. Darum
handelt es sich hier gar nicht. Hier muß man froh
sein, wenn sich die Museumsleitung nur zur Annahme
geschenkter moderner Werke bereit finden läßt. Und
darin dürften sich die deutschen Museen denn doch
sehr unterscheiden von den französischen. Wenn
man einem deutschen Museum solche Schenkungen
anböte, würde es sicherlich zugreifen. Hier in Frank-
reich mußten die Stifter der Manetschen »Olympia«
nicht Monate, sondern Jahre lang antichambrieren,
ehe man ihr Geschenk annahm und in den Luxem-
bourg brachte. Erst als ein Ministerwechsel einen
begeisterten Verehrer Manets zum Staatssekretär für
Kunst machte, wurde die »Olympia« angenommen.
Zehn Jahre später geschah ein gleiches mit den
von Caillebotte dem Staate vermachten impressionisti-
schen Bildern. Der Staat wollte sie durchaus nicht,
und erst als man alle Hebel in Bewegung gesetzt
hatte, als Deputation auf Deputation zu dem Minister
gewallfahrtet war, als die Zeitungen in zehntausend
fulminanten Artikeln gewettert hatten, ließ man sich
erweichen. Freilich wurde man auch da noch nicht
ganz weich: man machte einen Kompromiß und
nahm etwas mehr als die Hälfte der angebotenen
Bilder, die anderen ließ man den natürlichen Erben
des Stifters. Und damit man ja nicht glaube, das
seien olle Kamellen, die jetzt nicht mehr möglich
wären, sei noch erwähnt, daß vor drei Monaten eine
Anzahl Kunstfreunde eines der charakteristischsten und
bedeutendsten Gemälde von Toulouse-Lautrec ankaufte
und dem Staate als Geschenk anbot. Der Staat lehnte
das Geschenk ab, die Schenker waren und sind hart-
näckig, und nun wird schon seit drei Monaten be-
raten, ob die Arbeit angenommen werden darf oder
nicht.
Damit stimmt denn auch die Namenliste der
Künstler, von denen der französische Staat im jetzt
zu Ende gegangenen Jahre Arbeiten gekauft hat.