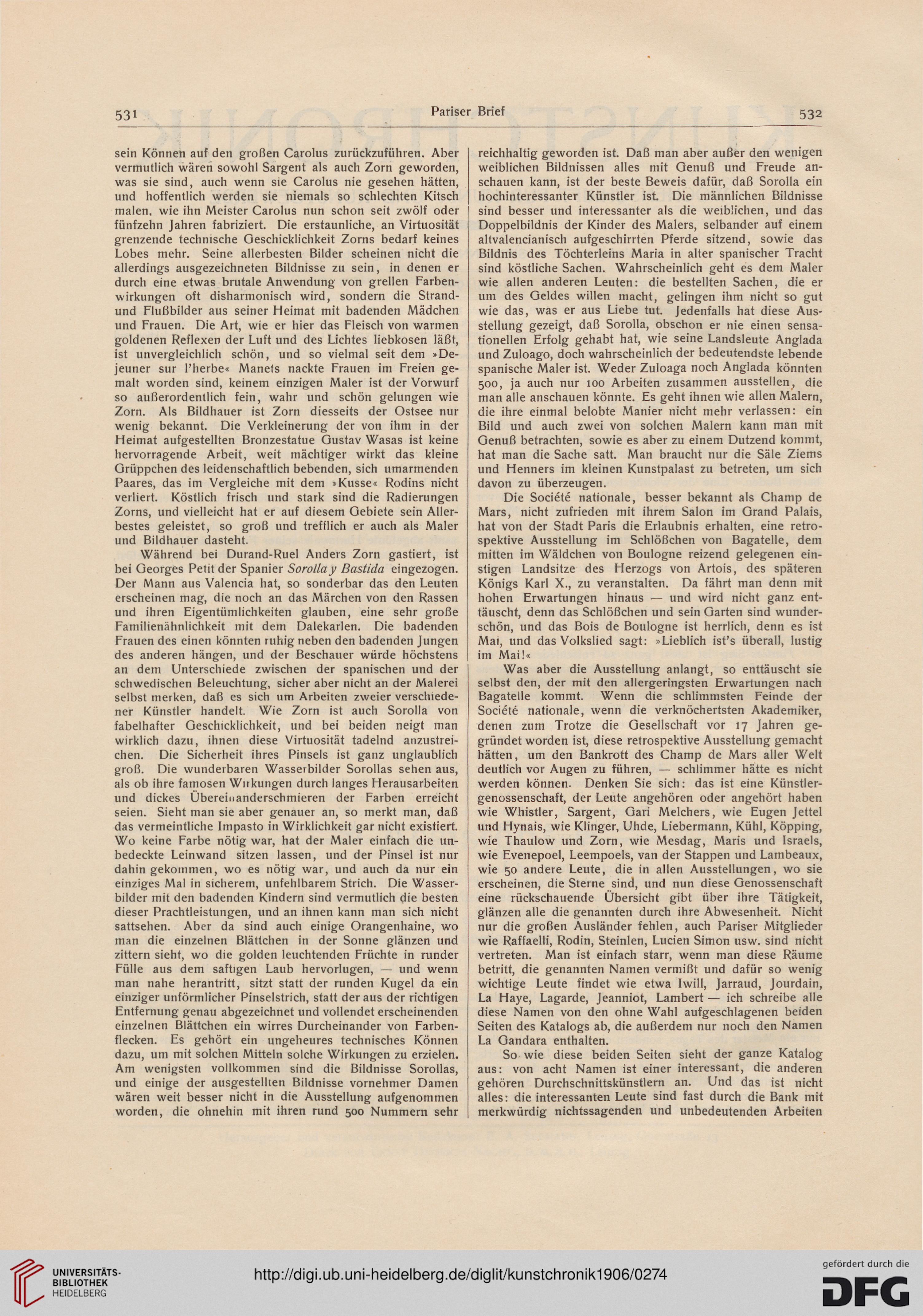531
Pariser Brief
532
sein Können auf den großen Carolus zurückzuführen. Aber
vermutlich wären sowohl Sargent als auch Zorn geworden,
was sie sind, auch wenn sie Carolus nie gesehen hätten,
und hoffentlich werden sie niemals so schlechten Kitsch
malen, wie ihn Meister Carolus nun schon seit zwölf oder
fünfzehn Jahren fabriziert. Die erstaunliche, an Virtuosität
grenzende technische Geschicklichkeit Zorns bedarf keines
Lobes mehr. Seine allerbesten Bilder scheinen nicht die
allerdings ausgezeichneten Bildnisse zu sein, in denen er
durch eine etwas brutale Anwendung von grellen Farben-
wirkungen oft disharmonisch wird, sondern die Strand-
und Flußbilder aus seiner Heimat mit badenden Mädchen
und Frauen. Die Art, wie er hier das Fleisch von warmen
goldenen Reflexen der Luft und des Lichtes liebkosen läßt,
ist unvergleichlich schön, und so vielmal seit dem »De-
jeuner sur l'herbe« Manets nackte Frauen im Freien ge-
malt worden sind, keinem einzigen Maler ist der Vorwurf
so außerordentlich fein, wahr und schön gelungen wie
Zorn. Als Bildhauer ist Zorn diesseits der Ostsee nur
wenig bekannt. Die Verkleinerung der von ihm in der
Heimat aufgestellten Bronzestatue Gustav Wasas ist keine
hervorragende Arbeit, weit mächtiger wirkt das kleine
Grüppchen des leidenschaftlich bebenden, sich umarmenden
Paares, das im Vergleiche mit dem »Kusse« Rodins nicht
verliert. Köstlich frisch und stark sind die Radierungen
Zorns, und vielleicht hat er auf diesem Gebiete sein Aller-
bestes geleistet, so groß und trefflich er auch als Maler
und Bildhauer dasteht.
Während bei Durand-Ruel Anders Zorn gastiert, ist
bei Georges Petit der Spanier Sorollay Bastida eingezogen.
Der Mann aus Valencia hat, so sonderbar das den Leuten
erscheinen mag, die noch an das Märchen von den Rassen
und ihren Eigentümlichkeiten glauben, eine sehr große
Familienähnlichkeit mit dem Dalekarlen. Die badenden
Frauen des einen könnten ruhig neben den badenden Jungen
des anderen hängen, und der Beschauer würde höchstens
an dem Unterschiede zwischen der spanischen und der
schwedischen Beleuchtung, sicher aber nicht an der Malerei
selbst merken, daß es sich um Arbeiten zweier verschiede-
ner Künstler handelt. Wie Zorn ist auch Sorolla von
fabelhafter Geschicklichkeit, und bei beiden neigt man
wirklich dazu, ihnen diese Virtuosität tadelnd anzustrei-
chen. Die Sicherheit ihres Pinsels ist ganz unglaublich
groß. Die wunderbaren Wasserbilder Sorollas sehen aus,
als ob ihre famosen Wirkungen durch langes Herausarbeiten
und dickes Übereiuanderschmieren der Farben erreicht
seien. Sieht man sie aber genauer an, so merkt man, daß
das vermeintliche Impasto in Wirklichkeit gar nicht existiert.
Wo keine Farbe nötig war, hat der Maler einfach die un-
bedeckte Leinwand sitzen lassen, und der Pinsel ist nur
dahin gekommen, wo es nötig war, und auch da nur ein
einziges Mal in sicherem, unfehlbarem Strich. Die Wasser-
bilder mit den badenden Kindern sind vermutlich die besten
dieser Prachtleistungen, und an ihnen kann man sich nicht
sattsehen. Aber da sind auch einige Orangenhaine, wo
man die einzelnen Blättchen in der Sonne glänzen und
zittern sieht, wo die golden leuchtenden Früchte in runder
Fülle aus dem saftigen Laub hervorlugen, — und wenn
man nahe herantritt, sitzt statt der runden Kugel da ein
einziger unförmlicher Pinselstrich, statt der aus der richtigen
Entfernung genau abgezeichnet und vollendet erscheinenden
einzelnen Blättchen ein wirres Durcheinander von Farben-
flecken. Es gehört ein ungeheures technisches Können
dazu, um mit solchen Mitteln solche Wirkungen zu erzielen.
Am wenigsten vollkommen sind die Bildnisse Sorollas,
und einige der ausgestellten Bildnisse vornehmer Damen
wären weit besser nicht in die Ausstellung aufgenommen
worden, die ohnehin mit ihren rund 500 Nummern sehr
reichhaltig geworden ist. Daß man aber außer den wenigen
weiblichen Bildnissen alles mit Genuß und Freude an-
schauen kann, ist der beste Beweis dafür, daß Sorolla ein
hochinteressanter Künstler ist. Die männlichen Bildnisse
sind besser und interessanter als die weiblichen, und das
Doppelbildnis der Kinder des Malers, selbander auf einem
altvalencianisch aufgeschirrten Pferde sitzend, sowie das
Bildnis des Töchterleins Maria in alter spanischer Tracht
sind köstliche Sachen. Wahrscheinlich geht es dem Maler
wie allen anderen Leuten: die bestellten Sachen, die er
um des Geldes willen macht, gelingen ihm nicht so gut
wie das, was er aus Liebe tut. Jedenfalls hat diese Aus-
stellung gezeigt, daß Sorolla, obschon er nie einen sensa-
tionellen Erfolg gehabt hat, wie seine Landsleute Anglada
und Zuloago, doch wahrscheinlich der bedeutendste lebende
spanische Maler ist. Weder Zuloaga noch Anglada könnten
500, ja auch nur 100 Arbeiten zusammen ausstellen, die
man alle anschauen könnte. Es geht ihnen wie allen Malern,
die ihre einmal belobte Manier nicht mehr verlassen: ein
Bild und auch zwei von solchen Malern kann man mit
Genuß betrachten, sowie es aber zu einem Dutzend kommt,
hat man die Sache satt. Man braucht nur die Säle Ziems
und Henners im kleinen Kunstpalast zu betreten, um sich
davon zu überzeugen.
Die Societe nationale, besser bekannt als Champ de
Mars, nicht zufrieden mit ihrem Salon im Grand Palais,
hat von der Stadt Paris die Erlaubnis erhalten, eine retro-
spektive Ausstellung im Schlößchen von Bagatelle, dem
mitten im Wäldchen von Boulogne reizend gelegenen ein-
stigen Landsitze des Herzogs von Artois, des späteren
Königs Karl X., zu veranstalten. Da fährt man denn mit
hohen Erwartungen hinaus — und wird nicht ganz ent-
täuscht, denn das Schlößchen und sein Garten sind wunder-
schön, und das Bois de Boulogne ist herrlich, denn es ist
Mai, und das Volkslied sagt: »Lieblich ist's überall, lustig
im Mai!«
Was aber die Ausstellung anlangt, so enttäuscht sie
selbst den, der mit den allergeringsten Erwartungen nach
Bagatelle kommt. Wenn die schlimmsten Feinde der
Societe nationale, wenn die verknöchertsten Akademiker,
denen zum Trotze die Gesellschaft vor 17 Jahren ge-
gründet worden ist, diese retrospektive Ausstellung gemacht
hätten, um den Bankrott des Champ de Mars aller Welt
deutlich vor Augen zu führen, — schlimmer hätte es nicht
werden können. Denken Sie sich: das ist eine Künstler-
genossenschaft, der Leute angehören oder angehört haben
wie Whistler, Sargent, Gari Melchers, wie Eugen Jettel
und Hynais, wie Klinger, Uhde, Liebermann, Kühl, Köpping,
wie Thaulow und Zorn, wie Mesdag, Maris und Israels,
wie Evenepoel, Leempoels, van der Stappen und Lambeaux,
wie 50 andere Leute, die in allen Ausstellungen, wo sie
erscheinen, die Sterne sind, und nun diese Genossenschaft
eine rückschauende Übersicht gibt über ihre Tätigkeit,
glänzen alle die genannten durch ihre Abwesenheit. Nicht
nur die großen Ausländer fehlen, auch Pariser Mitglieder
wie Raffaelli, Rodin, Steinlen, Lucien Simon usw. sind nicht
vertreten. Man ist einfach starr, wenn man diese Räume
betritt, die genannten Namen vermißt und dafür so wenig
wichtige Leute findet wie etwa Iwill, Jarraud, Jourdain,
La Haye, Lagarde, Jeanniot, Lambert — ich schreibe alle
diese Namen von den ohne Wahl aufgeschlagenen beiden
Seiten des Katalogs ab, die außerdem nur noch den Namen
La Gandara enthalten.
So wie diese beiden Seiten sieht der ganze Katalog
aus: von acht Namen ist einer interessant, die anderen
gehören Durchschnittskünstlern an. Und das ist nicht
alles: die interessanten Leute sind fast durch die Bank mit
merkwürdig nichtssagenden und unbedeutenden Arbeiten
Pariser Brief
532
sein Können auf den großen Carolus zurückzuführen. Aber
vermutlich wären sowohl Sargent als auch Zorn geworden,
was sie sind, auch wenn sie Carolus nie gesehen hätten,
und hoffentlich werden sie niemals so schlechten Kitsch
malen, wie ihn Meister Carolus nun schon seit zwölf oder
fünfzehn Jahren fabriziert. Die erstaunliche, an Virtuosität
grenzende technische Geschicklichkeit Zorns bedarf keines
Lobes mehr. Seine allerbesten Bilder scheinen nicht die
allerdings ausgezeichneten Bildnisse zu sein, in denen er
durch eine etwas brutale Anwendung von grellen Farben-
wirkungen oft disharmonisch wird, sondern die Strand-
und Flußbilder aus seiner Heimat mit badenden Mädchen
und Frauen. Die Art, wie er hier das Fleisch von warmen
goldenen Reflexen der Luft und des Lichtes liebkosen läßt,
ist unvergleichlich schön, und so vielmal seit dem »De-
jeuner sur l'herbe« Manets nackte Frauen im Freien ge-
malt worden sind, keinem einzigen Maler ist der Vorwurf
so außerordentlich fein, wahr und schön gelungen wie
Zorn. Als Bildhauer ist Zorn diesseits der Ostsee nur
wenig bekannt. Die Verkleinerung der von ihm in der
Heimat aufgestellten Bronzestatue Gustav Wasas ist keine
hervorragende Arbeit, weit mächtiger wirkt das kleine
Grüppchen des leidenschaftlich bebenden, sich umarmenden
Paares, das im Vergleiche mit dem »Kusse« Rodins nicht
verliert. Köstlich frisch und stark sind die Radierungen
Zorns, und vielleicht hat er auf diesem Gebiete sein Aller-
bestes geleistet, so groß und trefflich er auch als Maler
und Bildhauer dasteht.
Während bei Durand-Ruel Anders Zorn gastiert, ist
bei Georges Petit der Spanier Sorollay Bastida eingezogen.
Der Mann aus Valencia hat, so sonderbar das den Leuten
erscheinen mag, die noch an das Märchen von den Rassen
und ihren Eigentümlichkeiten glauben, eine sehr große
Familienähnlichkeit mit dem Dalekarlen. Die badenden
Frauen des einen könnten ruhig neben den badenden Jungen
des anderen hängen, und der Beschauer würde höchstens
an dem Unterschiede zwischen der spanischen und der
schwedischen Beleuchtung, sicher aber nicht an der Malerei
selbst merken, daß es sich um Arbeiten zweier verschiede-
ner Künstler handelt. Wie Zorn ist auch Sorolla von
fabelhafter Geschicklichkeit, und bei beiden neigt man
wirklich dazu, ihnen diese Virtuosität tadelnd anzustrei-
chen. Die Sicherheit ihres Pinsels ist ganz unglaublich
groß. Die wunderbaren Wasserbilder Sorollas sehen aus,
als ob ihre famosen Wirkungen durch langes Herausarbeiten
und dickes Übereiuanderschmieren der Farben erreicht
seien. Sieht man sie aber genauer an, so merkt man, daß
das vermeintliche Impasto in Wirklichkeit gar nicht existiert.
Wo keine Farbe nötig war, hat der Maler einfach die un-
bedeckte Leinwand sitzen lassen, und der Pinsel ist nur
dahin gekommen, wo es nötig war, und auch da nur ein
einziges Mal in sicherem, unfehlbarem Strich. Die Wasser-
bilder mit den badenden Kindern sind vermutlich die besten
dieser Prachtleistungen, und an ihnen kann man sich nicht
sattsehen. Aber da sind auch einige Orangenhaine, wo
man die einzelnen Blättchen in der Sonne glänzen und
zittern sieht, wo die golden leuchtenden Früchte in runder
Fülle aus dem saftigen Laub hervorlugen, — und wenn
man nahe herantritt, sitzt statt der runden Kugel da ein
einziger unförmlicher Pinselstrich, statt der aus der richtigen
Entfernung genau abgezeichnet und vollendet erscheinenden
einzelnen Blättchen ein wirres Durcheinander von Farben-
flecken. Es gehört ein ungeheures technisches Können
dazu, um mit solchen Mitteln solche Wirkungen zu erzielen.
Am wenigsten vollkommen sind die Bildnisse Sorollas,
und einige der ausgestellten Bildnisse vornehmer Damen
wären weit besser nicht in die Ausstellung aufgenommen
worden, die ohnehin mit ihren rund 500 Nummern sehr
reichhaltig geworden ist. Daß man aber außer den wenigen
weiblichen Bildnissen alles mit Genuß und Freude an-
schauen kann, ist der beste Beweis dafür, daß Sorolla ein
hochinteressanter Künstler ist. Die männlichen Bildnisse
sind besser und interessanter als die weiblichen, und das
Doppelbildnis der Kinder des Malers, selbander auf einem
altvalencianisch aufgeschirrten Pferde sitzend, sowie das
Bildnis des Töchterleins Maria in alter spanischer Tracht
sind köstliche Sachen. Wahrscheinlich geht es dem Maler
wie allen anderen Leuten: die bestellten Sachen, die er
um des Geldes willen macht, gelingen ihm nicht so gut
wie das, was er aus Liebe tut. Jedenfalls hat diese Aus-
stellung gezeigt, daß Sorolla, obschon er nie einen sensa-
tionellen Erfolg gehabt hat, wie seine Landsleute Anglada
und Zuloago, doch wahrscheinlich der bedeutendste lebende
spanische Maler ist. Weder Zuloaga noch Anglada könnten
500, ja auch nur 100 Arbeiten zusammen ausstellen, die
man alle anschauen könnte. Es geht ihnen wie allen Malern,
die ihre einmal belobte Manier nicht mehr verlassen: ein
Bild und auch zwei von solchen Malern kann man mit
Genuß betrachten, sowie es aber zu einem Dutzend kommt,
hat man die Sache satt. Man braucht nur die Säle Ziems
und Henners im kleinen Kunstpalast zu betreten, um sich
davon zu überzeugen.
Die Societe nationale, besser bekannt als Champ de
Mars, nicht zufrieden mit ihrem Salon im Grand Palais,
hat von der Stadt Paris die Erlaubnis erhalten, eine retro-
spektive Ausstellung im Schlößchen von Bagatelle, dem
mitten im Wäldchen von Boulogne reizend gelegenen ein-
stigen Landsitze des Herzogs von Artois, des späteren
Königs Karl X., zu veranstalten. Da fährt man denn mit
hohen Erwartungen hinaus — und wird nicht ganz ent-
täuscht, denn das Schlößchen und sein Garten sind wunder-
schön, und das Bois de Boulogne ist herrlich, denn es ist
Mai, und das Volkslied sagt: »Lieblich ist's überall, lustig
im Mai!«
Was aber die Ausstellung anlangt, so enttäuscht sie
selbst den, der mit den allergeringsten Erwartungen nach
Bagatelle kommt. Wenn die schlimmsten Feinde der
Societe nationale, wenn die verknöchertsten Akademiker,
denen zum Trotze die Gesellschaft vor 17 Jahren ge-
gründet worden ist, diese retrospektive Ausstellung gemacht
hätten, um den Bankrott des Champ de Mars aller Welt
deutlich vor Augen zu führen, — schlimmer hätte es nicht
werden können. Denken Sie sich: das ist eine Künstler-
genossenschaft, der Leute angehören oder angehört haben
wie Whistler, Sargent, Gari Melchers, wie Eugen Jettel
und Hynais, wie Klinger, Uhde, Liebermann, Kühl, Köpping,
wie Thaulow und Zorn, wie Mesdag, Maris und Israels,
wie Evenepoel, Leempoels, van der Stappen und Lambeaux,
wie 50 andere Leute, die in allen Ausstellungen, wo sie
erscheinen, die Sterne sind, und nun diese Genossenschaft
eine rückschauende Übersicht gibt über ihre Tätigkeit,
glänzen alle die genannten durch ihre Abwesenheit. Nicht
nur die großen Ausländer fehlen, auch Pariser Mitglieder
wie Raffaelli, Rodin, Steinlen, Lucien Simon usw. sind nicht
vertreten. Man ist einfach starr, wenn man diese Räume
betritt, die genannten Namen vermißt und dafür so wenig
wichtige Leute findet wie etwa Iwill, Jarraud, Jourdain,
La Haye, Lagarde, Jeanniot, Lambert — ich schreibe alle
diese Namen von den ohne Wahl aufgeschlagenen beiden
Seiten des Katalogs ab, die außerdem nur noch den Namen
La Gandara enthalten.
So wie diese beiden Seiten sieht der ganze Katalog
aus: von acht Namen ist einer interessant, die anderen
gehören Durchschnittskünstlern an. Und das ist nicht
alles: die interessanten Leute sind fast durch die Bank mit
merkwürdig nichtssagenden und unbedeutenden Arbeiten