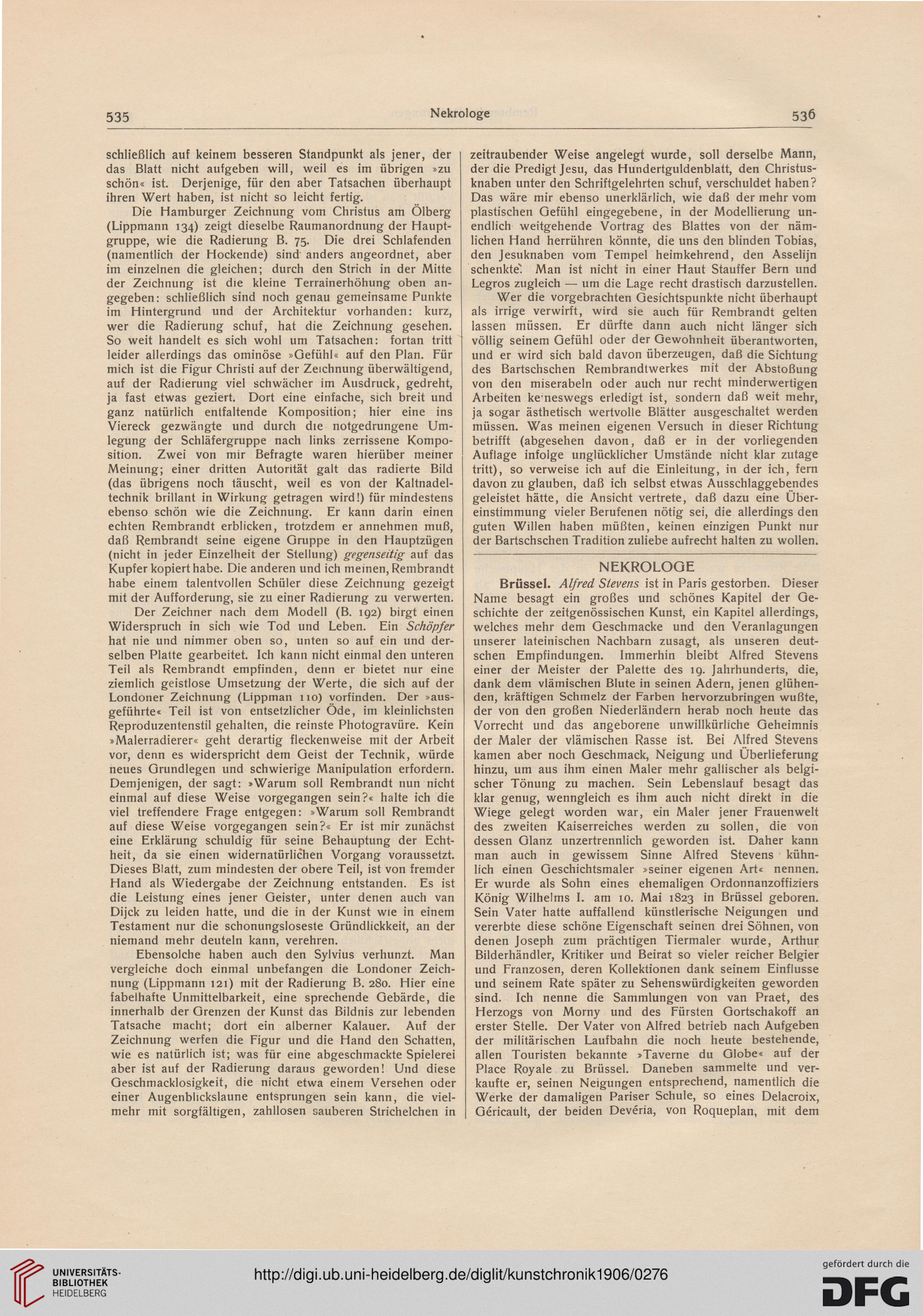535
Nekrologe
536
schließlich auf keinem besseren Standpunkt als jener, der
das Blatt nicht aufgeben will, weil es im übrigen »zu
schön« ist. Derjenige, für den aber Tatsachen überhaupt
ihren Wert haben, ist nicht so leicht fertig.
Die Hamburger Zeichnung vom Christus am Ölberg
(Lippmann 134) zeigt dieselbe Raumanordnung der Haupt-
gruppe, wie die Radierung B. 75. Die drei Schlafenden
(namentlich der Hockende) sind anders angeordnet, aber
im einzelnen die gleichen; durch den Strich in der Mitte
der Zeichnung ist die kleine Terrainerhöhung oben an-
gegeben: schließlich sind noch genau gemeinsame Punkte
im Hintergrund und der Architektur vorhanden: kurz,
wer die Radierung schuf, hat die Zeichnung gesehen.
So weit handelt es sich wohl um Tatsachen: fortan tritt
leider allerdings das ominöse »Gefühl« auf den Plan. Für
mich ist die Figur Christi auf der Zeichnung überwältigend,
auf der Radierung viel schwächer im Ausdruck, gedreht,
ja fast etwas geziert. Dort eine einfache, sich breit und
ganz natürlich entfaltende Komposition; hier eine ins
Viereck gezwängte und durch die notgedrungene Um-
legung der Schläfergruppe nach links zerrissene Kompo-
sition. Zwei von mir Befragte waren hierüber meiner
Meinung; einer dritten Autorität galt das radierte Bild
(das übrigens noch täuscht, weil es von der Kaltnadel-
technik brillant in Wirkung getragen wird!) für mindestens
ebenso schön wie die Zeichnung. Er kann darin einen
echten Rembrandt erblicken, trotzdem er annehmen muß,
daß Rembrandt seine eigene Gruppe in den Hauptzügen
(nicht in jeder Einzelheit der Stellung) gegenseitig auf das
Kupfer kopiert habe. Die anderen und ich meinen, Rembrandt
habe einem talentvollen Schüler diese Zeichnung gezeigt
mit der Aufforderung, sie zu einer Radierung zu verwerten.
Der Zeichner nach dem Modell (B. 192) birgt einen
Widerspruch in sich wie Tod und Leben. Ein Schöpfer
hat nie und nimmer oben so, unten so auf ein und der-
selben Platte gearbeitet. Ich kann nicht einmal den unteren
Teil als Rembrandt empfinden, denn er bietet nur eine
ziemlich geistlose Umsetzung der Werte, die sich auf der
Londoner Zeichnung (Lippman 110) vorfinden. Der »aus-
geführte« Teil ist von entsetzlicher Öde, im kleinlichsten
Reproduzentenstil gehalten, die reinste Photogravüre. Kein
»Malerradierer« geht derartig fleckenweise mit der Arbeit
vor, denn es widerspricht dem Geist der Technik, würde
neues Grundlegen und schwierige Manipulation erfordern.
Demjenigen, der sagt: »Warum soll Rembrandt nun nicht
einmal auf diese Weise vorgegangen sein?« halte ich die
viel treffendere Frage entgegen: »Warum soll Rembrandt
auf diese Weise vorgegangen sein?« Er ist mir zunächst
eine Erklärung schuldig für seine Behauptung der Echt-
heit, da sie einen widernatürlichen Vorgang voraussetzt.
Dieses Blatt, zum mindesten der obere Teil, ist von fremder
Hand als Wiedergabe der Zeichnung entstanden. Es ist
die Leistung eines jener Geister, unter denen auch van
Dijck zu leiden hatte, und die in der Kunst wie in einem
Testament nur die schonungsloseste Gründlickkeit, an der
niemand mehr deuteln kann, verehren.
Ebensolche haben auch den Sylvius verhunzt. Man
vergleiche doch einmal unbefangen die Londoner Zeich-
nung (Lippmann 121) mit der Radierung B. 280. Hier eine
fabelhafte Unmittelbarkeit, eine sprechende Gebärde, die
innerhalb der Grenzen der Kunst das Bildnis zur lebenden
Tatsache macht; dort ein alberner Kalauer. Auf der
Zeichnung werfen die Figur und die Hand den Schatten,
wie es natürlich ist; was für eine abgeschmackte Spielerei
aber ist auf der Radierung daraus geworden! Und diese
Geschmacklosigkeit, die nicht etwa einem Versehen oder
einer Augenblickslaune entsprungen sein kann, die viel-
mehr mit sorgfältigen, zahllosen sauberen Strichelchen in
zeitraubender Weise angelegt wurde, soll derselbe Mann,
der die Predigt Jesu, das Hundertguldenblatt, den Christus-
knaben unter den Schriftgelehrten schuf, verschuldet haben?
Das wäre mir ebenso unerklärlich, wie daß der mehr vom
plastischen Gefühl eingegebene, in der Modellierung un-
endlich weitgehende Vortrag des Blattes von der näm-
lichen Hand herrühren könnte, die uns den blinden Tobias,
den Jesuknaben vom Tempel heimkehrend, den Asselijn
schenkte". Man ist nicht in einer Haut Stauffer Bern und
Legros zugleich — um die Lage recht drastisch darzustellen.
Wer die vorgebrachten Gesichtspunkte nicht überhaupt
als irrige verwirft, wird sie auch für Rembrandt gelten
lassen müssen. Er dürfte dann auch nicht länger sich
völlig seinem Gefühl oder der Gewohnheit überantworten,
und er wird sich bald davon überzeugen, daß die Sichtung
des Bartschschen Rembrandtwerkes mit der Abstoßung
von den miserabeln oder auch nur recht minderwertigen
Arbeiten ke neswegs erledigt ist, sondern daß weit mehr,
ja sogar ästhetisch wertvolle Blätter ausgeschaltet werden
müssen. Was meinen eigenen Versuch in dieser Richtung
betrifft (abgesehen davon, daß er in der vorliegenden
Auflage infolge unglücklicher Umstände nicht klar zutage
tritt), so verweise ich auf die Einleitung, in der ich, fern
davon zu glauben, daß ich selbst etwas Ausschlaggebendes
geleistet hätte, die Ansicht vertrete, daß dazu eine Über-
einstimmung vieler Berufenen nötig sei, die allerdings den
guten Willen haben müßten, keinen einzigen Punkt nur
der Bartschschen Tradition zuliebe aufrecht halten zu wollen.
NEKROLOGE
Brüssel. Alfred Stevens ist in Paris gestorben. Dieser
Name besagt ein großes und schönes Kapitel der Ge-
schichte der zeitgenössischen Kunst, ein Kapitel allerdings,
welches mehr dem Geschmacke und den Veranlagungen
unserer lateinischen Nachbarn zusagt, als unseren deut-
schen Empfindungen. Immerhin bleibt Alfred Stevens
einer der Meister der Palette des 19. Jahrhunderts, die,
dank dem vlämischen Blute in seinen Adern, jenen glühen-
den, kräftigen Schmelz der Farben hervorzubringen wußte,
der von den großen Niederländern herab noch heute das
Vorrecht und das angeborene unwillkürliche Geheimnis
der Maler der vlämischen Rasse ist. Bei Alfred Stevens
kamen aber noch Geschmack, Neigung und Überlieferung
hinzu, um aus ihm einen Maler mehr gallischer als belgi-
scher Tönung zu machen. Sein Lebenslauf besagt das
klar genug, wenngleich es ihm auch nicht direkt in die
Wiege gelegt worden war, ein Maler jener Frauenwelt
des zweiten Kaiserreiches werden zu sollen, die von
dessen Glanz unzertrennlich geworden ist. Daher kann
man auch in gewissem Sinne Alfred Stevens kühn-
lich einen Geschichtsmaler »seiner eigenen Art« nennen.
Er wurde als Sohn eines ehemaligen Ordonnanzoffiziers
König Wilhelms I. am 10. Mai 1823 in Brüssel geboren.
Sein Vater hatte auffallend künstlerische Neigungen und
vererbte diese schöne Eigenschaft seinen drei Söhnen, von
denen Joseph zum prächtigen Tiermaler wurde, Arthur
Bilderhändler, Kritiker und Beirat so vieler reicher Belgier
und Franzosen, deren Kollektionen dank seinem Einflüsse
und seinem Rate später zu Sehenswürdigkeiten geworden
sind. Ich nenne die Sammlungen von van Praet, des
Herzogs von Morny und des Fürsten Gortschakoff an
erster Stelle. Der Vater von Alfred betrieb nach Aufgeben
der militärischen Laufbahn die noch heute bestehende,
allen Touristen bekannte »Taverne du Globe« auf der
Place Royale zu Brüssel. Daneben sammelte und ver-
kaufte er, seinen Neigungen entsprechend, namentlich die
Werke der damaligen Pariser Schule, so eines Delacroix,
Gericault, der beiden Deveria, von Roqueplan, mit dem
Nekrologe
536
schließlich auf keinem besseren Standpunkt als jener, der
das Blatt nicht aufgeben will, weil es im übrigen »zu
schön« ist. Derjenige, für den aber Tatsachen überhaupt
ihren Wert haben, ist nicht so leicht fertig.
Die Hamburger Zeichnung vom Christus am Ölberg
(Lippmann 134) zeigt dieselbe Raumanordnung der Haupt-
gruppe, wie die Radierung B. 75. Die drei Schlafenden
(namentlich der Hockende) sind anders angeordnet, aber
im einzelnen die gleichen; durch den Strich in der Mitte
der Zeichnung ist die kleine Terrainerhöhung oben an-
gegeben: schließlich sind noch genau gemeinsame Punkte
im Hintergrund und der Architektur vorhanden: kurz,
wer die Radierung schuf, hat die Zeichnung gesehen.
So weit handelt es sich wohl um Tatsachen: fortan tritt
leider allerdings das ominöse »Gefühl« auf den Plan. Für
mich ist die Figur Christi auf der Zeichnung überwältigend,
auf der Radierung viel schwächer im Ausdruck, gedreht,
ja fast etwas geziert. Dort eine einfache, sich breit und
ganz natürlich entfaltende Komposition; hier eine ins
Viereck gezwängte und durch die notgedrungene Um-
legung der Schläfergruppe nach links zerrissene Kompo-
sition. Zwei von mir Befragte waren hierüber meiner
Meinung; einer dritten Autorität galt das radierte Bild
(das übrigens noch täuscht, weil es von der Kaltnadel-
technik brillant in Wirkung getragen wird!) für mindestens
ebenso schön wie die Zeichnung. Er kann darin einen
echten Rembrandt erblicken, trotzdem er annehmen muß,
daß Rembrandt seine eigene Gruppe in den Hauptzügen
(nicht in jeder Einzelheit der Stellung) gegenseitig auf das
Kupfer kopiert habe. Die anderen und ich meinen, Rembrandt
habe einem talentvollen Schüler diese Zeichnung gezeigt
mit der Aufforderung, sie zu einer Radierung zu verwerten.
Der Zeichner nach dem Modell (B. 192) birgt einen
Widerspruch in sich wie Tod und Leben. Ein Schöpfer
hat nie und nimmer oben so, unten so auf ein und der-
selben Platte gearbeitet. Ich kann nicht einmal den unteren
Teil als Rembrandt empfinden, denn er bietet nur eine
ziemlich geistlose Umsetzung der Werte, die sich auf der
Londoner Zeichnung (Lippman 110) vorfinden. Der »aus-
geführte« Teil ist von entsetzlicher Öde, im kleinlichsten
Reproduzentenstil gehalten, die reinste Photogravüre. Kein
»Malerradierer« geht derartig fleckenweise mit der Arbeit
vor, denn es widerspricht dem Geist der Technik, würde
neues Grundlegen und schwierige Manipulation erfordern.
Demjenigen, der sagt: »Warum soll Rembrandt nun nicht
einmal auf diese Weise vorgegangen sein?« halte ich die
viel treffendere Frage entgegen: »Warum soll Rembrandt
auf diese Weise vorgegangen sein?« Er ist mir zunächst
eine Erklärung schuldig für seine Behauptung der Echt-
heit, da sie einen widernatürlichen Vorgang voraussetzt.
Dieses Blatt, zum mindesten der obere Teil, ist von fremder
Hand als Wiedergabe der Zeichnung entstanden. Es ist
die Leistung eines jener Geister, unter denen auch van
Dijck zu leiden hatte, und die in der Kunst wie in einem
Testament nur die schonungsloseste Gründlickkeit, an der
niemand mehr deuteln kann, verehren.
Ebensolche haben auch den Sylvius verhunzt. Man
vergleiche doch einmal unbefangen die Londoner Zeich-
nung (Lippmann 121) mit der Radierung B. 280. Hier eine
fabelhafte Unmittelbarkeit, eine sprechende Gebärde, die
innerhalb der Grenzen der Kunst das Bildnis zur lebenden
Tatsache macht; dort ein alberner Kalauer. Auf der
Zeichnung werfen die Figur und die Hand den Schatten,
wie es natürlich ist; was für eine abgeschmackte Spielerei
aber ist auf der Radierung daraus geworden! Und diese
Geschmacklosigkeit, die nicht etwa einem Versehen oder
einer Augenblickslaune entsprungen sein kann, die viel-
mehr mit sorgfältigen, zahllosen sauberen Strichelchen in
zeitraubender Weise angelegt wurde, soll derselbe Mann,
der die Predigt Jesu, das Hundertguldenblatt, den Christus-
knaben unter den Schriftgelehrten schuf, verschuldet haben?
Das wäre mir ebenso unerklärlich, wie daß der mehr vom
plastischen Gefühl eingegebene, in der Modellierung un-
endlich weitgehende Vortrag des Blattes von der näm-
lichen Hand herrühren könnte, die uns den blinden Tobias,
den Jesuknaben vom Tempel heimkehrend, den Asselijn
schenkte". Man ist nicht in einer Haut Stauffer Bern und
Legros zugleich — um die Lage recht drastisch darzustellen.
Wer die vorgebrachten Gesichtspunkte nicht überhaupt
als irrige verwirft, wird sie auch für Rembrandt gelten
lassen müssen. Er dürfte dann auch nicht länger sich
völlig seinem Gefühl oder der Gewohnheit überantworten,
und er wird sich bald davon überzeugen, daß die Sichtung
des Bartschschen Rembrandtwerkes mit der Abstoßung
von den miserabeln oder auch nur recht minderwertigen
Arbeiten ke neswegs erledigt ist, sondern daß weit mehr,
ja sogar ästhetisch wertvolle Blätter ausgeschaltet werden
müssen. Was meinen eigenen Versuch in dieser Richtung
betrifft (abgesehen davon, daß er in der vorliegenden
Auflage infolge unglücklicher Umstände nicht klar zutage
tritt), so verweise ich auf die Einleitung, in der ich, fern
davon zu glauben, daß ich selbst etwas Ausschlaggebendes
geleistet hätte, die Ansicht vertrete, daß dazu eine Über-
einstimmung vieler Berufenen nötig sei, die allerdings den
guten Willen haben müßten, keinen einzigen Punkt nur
der Bartschschen Tradition zuliebe aufrecht halten zu wollen.
NEKROLOGE
Brüssel. Alfred Stevens ist in Paris gestorben. Dieser
Name besagt ein großes und schönes Kapitel der Ge-
schichte der zeitgenössischen Kunst, ein Kapitel allerdings,
welches mehr dem Geschmacke und den Veranlagungen
unserer lateinischen Nachbarn zusagt, als unseren deut-
schen Empfindungen. Immerhin bleibt Alfred Stevens
einer der Meister der Palette des 19. Jahrhunderts, die,
dank dem vlämischen Blute in seinen Adern, jenen glühen-
den, kräftigen Schmelz der Farben hervorzubringen wußte,
der von den großen Niederländern herab noch heute das
Vorrecht und das angeborene unwillkürliche Geheimnis
der Maler der vlämischen Rasse ist. Bei Alfred Stevens
kamen aber noch Geschmack, Neigung und Überlieferung
hinzu, um aus ihm einen Maler mehr gallischer als belgi-
scher Tönung zu machen. Sein Lebenslauf besagt das
klar genug, wenngleich es ihm auch nicht direkt in die
Wiege gelegt worden war, ein Maler jener Frauenwelt
des zweiten Kaiserreiches werden zu sollen, die von
dessen Glanz unzertrennlich geworden ist. Daher kann
man auch in gewissem Sinne Alfred Stevens kühn-
lich einen Geschichtsmaler »seiner eigenen Art« nennen.
Er wurde als Sohn eines ehemaligen Ordonnanzoffiziers
König Wilhelms I. am 10. Mai 1823 in Brüssel geboren.
Sein Vater hatte auffallend künstlerische Neigungen und
vererbte diese schöne Eigenschaft seinen drei Söhnen, von
denen Joseph zum prächtigen Tiermaler wurde, Arthur
Bilderhändler, Kritiker und Beirat so vieler reicher Belgier
und Franzosen, deren Kollektionen dank seinem Einflüsse
und seinem Rate später zu Sehenswürdigkeiten geworden
sind. Ich nenne die Sammlungen von van Praet, des
Herzogs von Morny und des Fürsten Gortschakoff an
erster Stelle. Der Vater von Alfred betrieb nach Aufgeben
der militärischen Laufbahn die noch heute bestehende,
allen Touristen bekannte »Taverne du Globe« auf der
Place Royale zu Brüssel. Daneben sammelte und ver-
kaufte er, seinen Neigungen entsprechend, namentlich die
Werke der damaligen Pariser Schule, so eines Delacroix,
Gericault, der beiden Deveria, von Roqueplan, mit dem