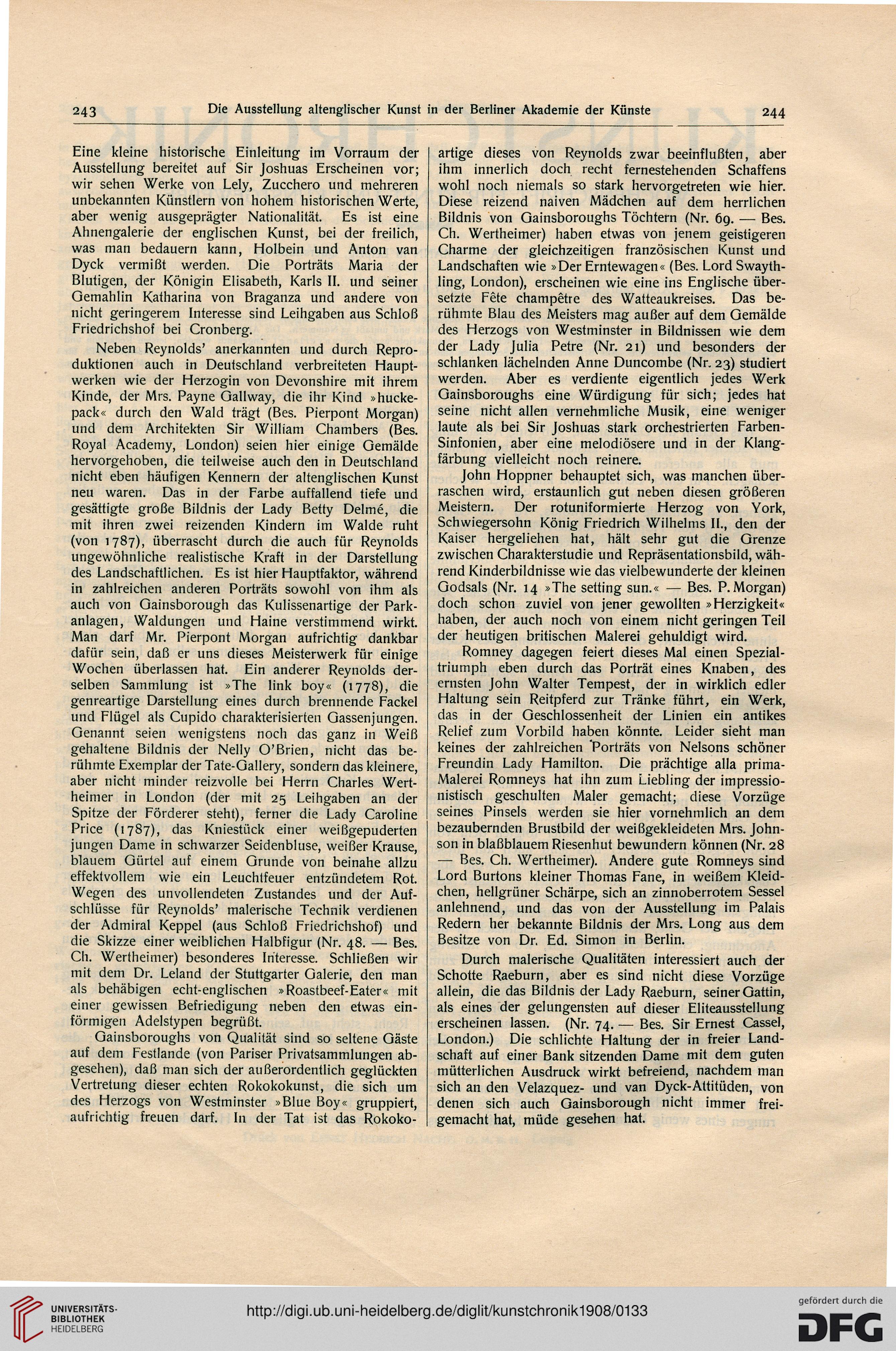243
Die Ausstellung altenglischer Kunst in der Berliner Akademie der Künste
244
Eine kleine historische Einleitung im Vorraum der
Ausstellung bereitet auf Sir Joshuas Erscheinen vor;
wir sehen Werke von Lely, Zucchero und mehreren
unbekannten Künstlern von hohem historischen Werte,
aber wenig ausgeprägter Nationalität. Es ist eine
Ahnengalerie der englischen Kunst, bei der freilich,
was man bedauern kann, Holbein und Anton van
Dyck vermißt werden. Die Porträts Maria der
Blutigen, der Königin Elisabeth, Karls IL und seiner
Gemahlin Katharina von Braganza und andere von
nicht geringerem Interesse sind Leihgaben aus Schloß
Friedrichshof bei Cronberg.
Neben Reynolds' anerkannten und durch Repro-
duktionen auch in Deutschland verbreiteten Haupt-
werken wie der Herzogin von Devonshire mit ihrem
Kinde, der Mrs. Payne Gallway, die ihr Kind »hucke-
pack« durch den Wald trägt (Bes. Pierpont Morgan)
und dem Architekten Sir William Chambers (Bes.
Royal Academy, London) seien hier einige Gemälde
hervorgehoben, die teilweise auch den in Deutschland
nicht eben häufigen Kennern der altenglischen Kunst
neu waren. Das in der Farbe auffallend tiefe und
gesättigte große Bildnis der Lady Betty Delme, die
mit ihren zwei reizenden Kindern im Walde ruht
(von 1787), überrascht durch die auch für Reynolds
ungewöhnliche realistische Kraft in der Darstellung
des Landschaftlichen. Es ist hier Hauptfaktor, während
in zahlreichen anderen Porträts sowohl von ihm als
auch von Gainsborough das Kulissenartige der Park-
anlagen, Waldungen und Haine verstimmend wirkt.
Man darf Mr. Pierpont Morgan aufrichtig dankbar
dafür sein, daß er uns dieses Meisterwerk für einige
Wochen überlassen hat. Ein anderer Reynolds der-
selben Sammlung ist »The link boy« (1778), die
genreartige Darstellung eines durch brennende Fackel
und Flügel als Cupido charakterisierten Gassenjungen.
Genannt seien wenigstens noch das ganz in Weiß
gehaltene Bildnis der Nelly O'Brien, nicht das be-
rühmte Exemplar der Tate-Gallery, sondern das kleinere,
aber nicht minder reizvolle bei Herrn Charles Wert-
heimer in London (der mit 25 Leihgaben an der
Spitze der Förderer steht), ferner die Lady Caroline
Price (1787), das Kniestück einer weißgepuderten
jungen Dame in schwarzer Seidenbluse, weißer Krause,
blauem Gürtel auf einem Grunde von beinahe allzu
effektvollem wie ein Leuchtfeuer entzündetem Rot.
Wegen des unvollendeten Zustandes und der Auf-
schlüsse für Reynolds' malerische Technik verdienen
der Admiral Keppel (aus Schloß Friedrichshof) und
die Skizze einer weiblichen Halbfigur (Nr. 48. — Bes.
Ch. Wertheimer) besonderes Interesse. Schließen wir
mit dem Dr. Leland der Stuttgarter Galerie, den man
als behäbigen echt-englischen »Roastbeef-Eater« mit
einer gewissen Befriedigung neben den etwas ein-
förmigen Adelstypen begrüßt.
Gainsboroughs von Qualität sind so seltene Gäste
auf dem Festlande (von Pariser Privatsammlungen ab-
gesehen), daß man sich der außerordentlich geglückten
Vertretung dieser echten Rokokokunst, die sich um
des Herzogs von Westminster »Blue Boy« gruppiert,
aufrichtig freuen darf. In der Tat ist das Rokoko-
artige dieses von Reynolds zwar beeinflußten, aber
ihm innerlich doch recht fernestehenden Schaffens
wohl noch niemals so stark hervorgetreten wie hier.
Diese reizend naiven Mädchen auf dem herrlichen
Bildnis von Gainsboroughs Töchtern (Nr. 69. — Bes.
Ch. Wertheimer) haben etwas von jenem geistigeren
Charme der gleichzeitigen französischen Kunst und
Landschaften wie »Der Erntewagen« (Bes. Lord Swayth-
ling, London), erscheinen wie eine ins Englische über-
setzte Fete champetre des Watteaukreises. Das be-
rühmte Blau des Meisters mag außer auf dem Gemälde
des Herzogs von Westminster in Bildnissen wie dem
der Lady Julia Petre (Nr. 21) und besonders der
schlanken lächelnden Anne Duncombe (Nr. 23) studiert
werden. Aber es verdiente eigentlich jedes Werk
Gainsboroughs eine Würdigung für sich; jedes hat
seine nicht allen vernehmliche Musik, eine weniger
laute als bei Sir Joshuas stark orchestrierten Farben-
Sinfonien, aber eine melodiösere und in der Klang-
färbung vielleicht noch reinere.
John Hoppner behauptet sich, was manchen über-
raschen wird, erstaunlich gut neben diesen größeren
Meistern. Der rotuniformierte Herzog von York,
Schwiegersohn König Friedrich Wilhelms IL, den der
Kaiser hergeliehen hat, hält sehr gut die Grenze
zwischen Charakterstudie und Repräsentationsbild, wäh-
rend Kinderbildnisse wie das vielbewunderte der kleinen
Godsals (Nr. 14 »The setting sun.« — Bes. P.Morgan)
doch schon zuviel von jener gewollten »Herzigkeit«
haben, der auch noch von einem nicht geringen Teil
der heutigen britischen Malerei gehuldigt wird.
Romney dagegen feiert dieses Mal einen Spezial-
triumph eben durch das Porträt eines Knaben, des
ernsten John Walter Tempest, der in wirklich edler
Haltung sein Reitpferd zur Tränke führt, ein Werk,
das in der Geschlossenheit der Linien ein antikes
Relief zum Vorbild haben könnte. Leider sieht man
keines der zahlreichen 'Porträts von Nelsons schöner
Freundin Lady Hamilton. Die prächtige alla prima-
Malerei Romneys hat ihn zum Liebling der impressio-
nistisch geschulten Maler gemacht; diese Vorzüge
seines Pinsels werden sie hier vornehmlich an dem
bezaubernden Brustbild der weißgekleideten Mrs. John-
son in blaßblauem Riesenhut bewundern können (Nr. 28
— Bes. Ch. Wertheimer). Andere gute Romneys sind
Lord Burtons kleiner Thomas Fane, in weißem Kleid-
chen, hellgrüner Schärpe, sich an zinnoberrotem Sessel
anlehnend, und das von der Ausstellung im Palais
Redern her bekannte Bildnis der Mrs. Long aus dem
Besitze von Dr. Ed. Simon in Berlin.
Durch malerische Qualitäten interessiert auch der
Schotte Raeburn, aber es sind nicht diese Vorzüge
allein, die das Bildnis der Lady Raeburn, seiner Gattin,
als eines der gelungensten auf dieser Eliteausstellung
erscheinen lassen. (Nr. 74. — Bes. Sir Ernest Cassel,
London.) Die schlichte Haltung der in freier Land-
schaft auf einer Bank sitzenden Dame mit dem guten
mütterlichen Ausdruck wirkt befreiend, nachdem man
sich an den Velazquez- und van Dyck-Attitüden, von
denen sich auch Gainsborough nicht immer frei-
gemacht hat, müde gesehen hat.
Die Ausstellung altenglischer Kunst in der Berliner Akademie der Künste
244
Eine kleine historische Einleitung im Vorraum der
Ausstellung bereitet auf Sir Joshuas Erscheinen vor;
wir sehen Werke von Lely, Zucchero und mehreren
unbekannten Künstlern von hohem historischen Werte,
aber wenig ausgeprägter Nationalität. Es ist eine
Ahnengalerie der englischen Kunst, bei der freilich,
was man bedauern kann, Holbein und Anton van
Dyck vermißt werden. Die Porträts Maria der
Blutigen, der Königin Elisabeth, Karls IL und seiner
Gemahlin Katharina von Braganza und andere von
nicht geringerem Interesse sind Leihgaben aus Schloß
Friedrichshof bei Cronberg.
Neben Reynolds' anerkannten und durch Repro-
duktionen auch in Deutschland verbreiteten Haupt-
werken wie der Herzogin von Devonshire mit ihrem
Kinde, der Mrs. Payne Gallway, die ihr Kind »hucke-
pack« durch den Wald trägt (Bes. Pierpont Morgan)
und dem Architekten Sir William Chambers (Bes.
Royal Academy, London) seien hier einige Gemälde
hervorgehoben, die teilweise auch den in Deutschland
nicht eben häufigen Kennern der altenglischen Kunst
neu waren. Das in der Farbe auffallend tiefe und
gesättigte große Bildnis der Lady Betty Delme, die
mit ihren zwei reizenden Kindern im Walde ruht
(von 1787), überrascht durch die auch für Reynolds
ungewöhnliche realistische Kraft in der Darstellung
des Landschaftlichen. Es ist hier Hauptfaktor, während
in zahlreichen anderen Porträts sowohl von ihm als
auch von Gainsborough das Kulissenartige der Park-
anlagen, Waldungen und Haine verstimmend wirkt.
Man darf Mr. Pierpont Morgan aufrichtig dankbar
dafür sein, daß er uns dieses Meisterwerk für einige
Wochen überlassen hat. Ein anderer Reynolds der-
selben Sammlung ist »The link boy« (1778), die
genreartige Darstellung eines durch brennende Fackel
und Flügel als Cupido charakterisierten Gassenjungen.
Genannt seien wenigstens noch das ganz in Weiß
gehaltene Bildnis der Nelly O'Brien, nicht das be-
rühmte Exemplar der Tate-Gallery, sondern das kleinere,
aber nicht minder reizvolle bei Herrn Charles Wert-
heimer in London (der mit 25 Leihgaben an der
Spitze der Förderer steht), ferner die Lady Caroline
Price (1787), das Kniestück einer weißgepuderten
jungen Dame in schwarzer Seidenbluse, weißer Krause,
blauem Gürtel auf einem Grunde von beinahe allzu
effektvollem wie ein Leuchtfeuer entzündetem Rot.
Wegen des unvollendeten Zustandes und der Auf-
schlüsse für Reynolds' malerische Technik verdienen
der Admiral Keppel (aus Schloß Friedrichshof) und
die Skizze einer weiblichen Halbfigur (Nr. 48. — Bes.
Ch. Wertheimer) besonderes Interesse. Schließen wir
mit dem Dr. Leland der Stuttgarter Galerie, den man
als behäbigen echt-englischen »Roastbeef-Eater« mit
einer gewissen Befriedigung neben den etwas ein-
förmigen Adelstypen begrüßt.
Gainsboroughs von Qualität sind so seltene Gäste
auf dem Festlande (von Pariser Privatsammlungen ab-
gesehen), daß man sich der außerordentlich geglückten
Vertretung dieser echten Rokokokunst, die sich um
des Herzogs von Westminster »Blue Boy« gruppiert,
aufrichtig freuen darf. In der Tat ist das Rokoko-
artige dieses von Reynolds zwar beeinflußten, aber
ihm innerlich doch recht fernestehenden Schaffens
wohl noch niemals so stark hervorgetreten wie hier.
Diese reizend naiven Mädchen auf dem herrlichen
Bildnis von Gainsboroughs Töchtern (Nr. 69. — Bes.
Ch. Wertheimer) haben etwas von jenem geistigeren
Charme der gleichzeitigen französischen Kunst und
Landschaften wie »Der Erntewagen« (Bes. Lord Swayth-
ling, London), erscheinen wie eine ins Englische über-
setzte Fete champetre des Watteaukreises. Das be-
rühmte Blau des Meisters mag außer auf dem Gemälde
des Herzogs von Westminster in Bildnissen wie dem
der Lady Julia Petre (Nr. 21) und besonders der
schlanken lächelnden Anne Duncombe (Nr. 23) studiert
werden. Aber es verdiente eigentlich jedes Werk
Gainsboroughs eine Würdigung für sich; jedes hat
seine nicht allen vernehmliche Musik, eine weniger
laute als bei Sir Joshuas stark orchestrierten Farben-
Sinfonien, aber eine melodiösere und in der Klang-
färbung vielleicht noch reinere.
John Hoppner behauptet sich, was manchen über-
raschen wird, erstaunlich gut neben diesen größeren
Meistern. Der rotuniformierte Herzog von York,
Schwiegersohn König Friedrich Wilhelms IL, den der
Kaiser hergeliehen hat, hält sehr gut die Grenze
zwischen Charakterstudie und Repräsentationsbild, wäh-
rend Kinderbildnisse wie das vielbewunderte der kleinen
Godsals (Nr. 14 »The setting sun.« — Bes. P.Morgan)
doch schon zuviel von jener gewollten »Herzigkeit«
haben, der auch noch von einem nicht geringen Teil
der heutigen britischen Malerei gehuldigt wird.
Romney dagegen feiert dieses Mal einen Spezial-
triumph eben durch das Porträt eines Knaben, des
ernsten John Walter Tempest, der in wirklich edler
Haltung sein Reitpferd zur Tränke führt, ein Werk,
das in der Geschlossenheit der Linien ein antikes
Relief zum Vorbild haben könnte. Leider sieht man
keines der zahlreichen 'Porträts von Nelsons schöner
Freundin Lady Hamilton. Die prächtige alla prima-
Malerei Romneys hat ihn zum Liebling der impressio-
nistisch geschulten Maler gemacht; diese Vorzüge
seines Pinsels werden sie hier vornehmlich an dem
bezaubernden Brustbild der weißgekleideten Mrs. John-
son in blaßblauem Riesenhut bewundern können (Nr. 28
— Bes. Ch. Wertheimer). Andere gute Romneys sind
Lord Burtons kleiner Thomas Fane, in weißem Kleid-
chen, hellgrüner Schärpe, sich an zinnoberrotem Sessel
anlehnend, und das von der Ausstellung im Palais
Redern her bekannte Bildnis der Mrs. Long aus dem
Besitze von Dr. Ed. Simon in Berlin.
Durch malerische Qualitäten interessiert auch der
Schotte Raeburn, aber es sind nicht diese Vorzüge
allein, die das Bildnis der Lady Raeburn, seiner Gattin,
als eines der gelungensten auf dieser Eliteausstellung
erscheinen lassen. (Nr. 74. — Bes. Sir Ernest Cassel,
London.) Die schlichte Haltung der in freier Land-
schaft auf einer Bank sitzenden Dame mit dem guten
mütterlichen Ausdruck wirkt befreiend, nachdem man
sich an den Velazquez- und van Dyck-Attitüden, von
denen sich auch Gainsborough nicht immer frei-
gemacht hat, müde gesehen hat.