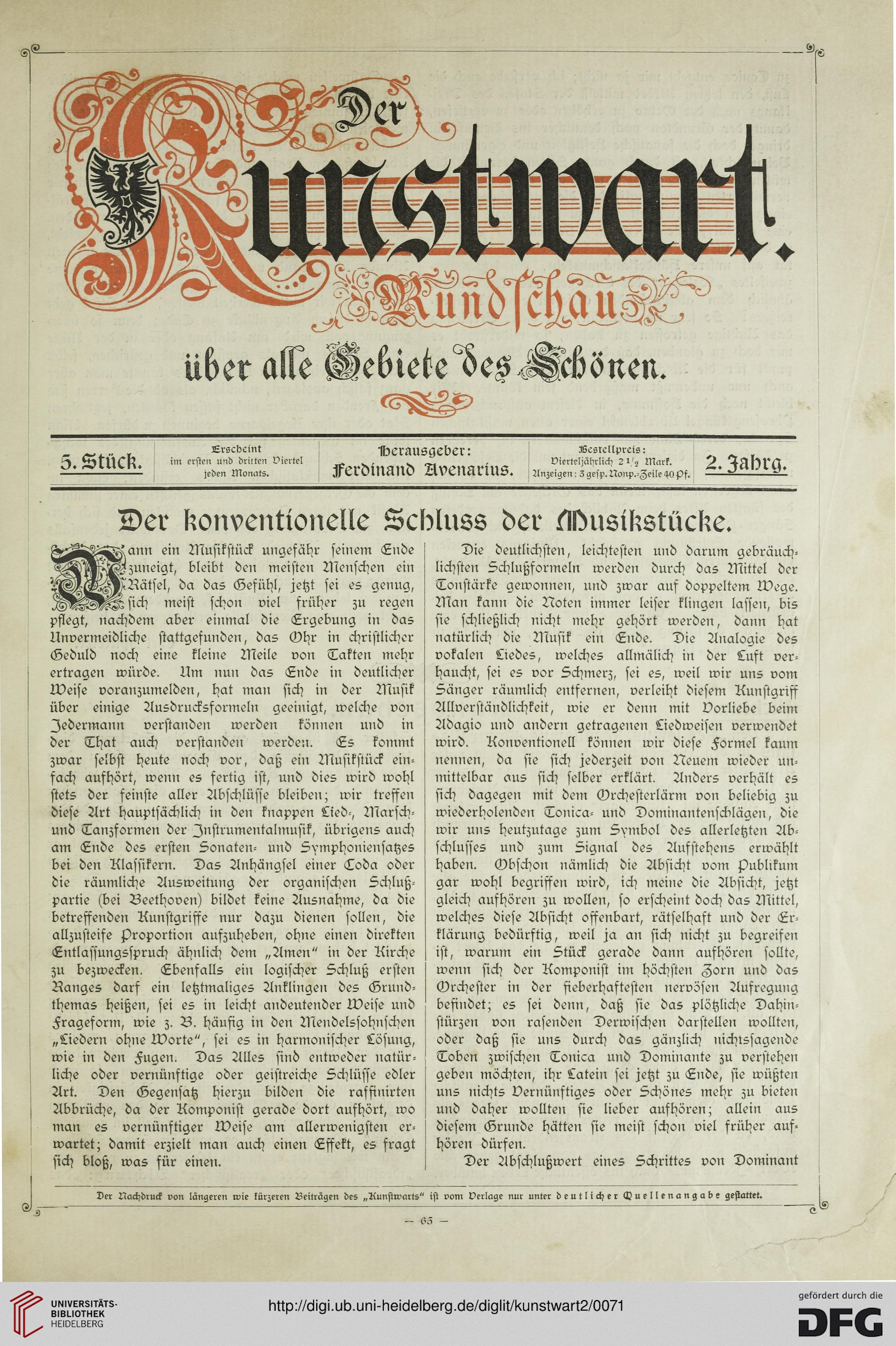s. Stück.
Lrscbcint
Derausgeber:
zferdlnand Nvennrius.
Kcsrcllprets:
vierteliäbrlich 2 1/2 Mark.
2.
Zabrg.
Der konventtonelle Lcbluss der tDustkstücke
ann ein Musikstück ungesähr seinem <Lnde
zuneigt, bleibt den meisten Menschen ein
Rätsel, da das Gesühl, jetzt sei es genug,
sich meist schon viel früher zu regen
pflegt, nachdem aber einmal die Lrgebung in das
Unvermeidliche stattgefunden, das Ohr in christlicher
Geduld noch eine kleine Meile von Takten mehr
ertragen würde. Um nun das Tnde in deutlicher
weise voranzumelden, hat man sich in der Utusik
über einige Ausdruckssormeln geeinigt, welche von
Iedermann verstanden werden können und in
der That auch verstanden werden. Ts kommt
zwar selbst heute noch vor, daß etn Utusikstück ein-
fach aushört, wenn es fertig ist, und dies wird wohl
stets der feinste aller Abschlüsse bleiben; wir treffen
diese Art hauptsächlich in den knappen Lied-, Utarsch-
und Tanzformen der Instrumentalmusik, übrigens auch
am Tnde des ersten Lonaten- und Lymphoniensatzes
bei den Ulassikern. Das Anhängsel einer Toda oder
die räumliche Ausweitung der organischen Schluß-
partie (bei Beethoven) bildet keine Ausnahme, da die
betreffenden Aunstgriffe nur dazu dienen sollen, die
allzusteife j)roportion aufzuheben, ohne einen direkten
Lntlafsungsspruch ähnlich dem „Amen" in der Airche
zu bezwecken. Lbenfalls ein logischer Schluß ersten
Ranges darf ein letztmaliges Anklingen des Grund-
themas heißen, sei es in leicht andeutender Meise und
Frageform, wie z. B. häufig in den Utendelssohnschen
„Liedern ohne Morte", sei es in harmonischer Lösung,
wie in den Fugen. Das Alles sind entweder natür-
liche oder vernünftige oder geistreiche Lchlüsse edler
Art. Den Gegensatz hierzu bilden die raffinirten
^ Abbrüche, da der Romponist gerade dort aufhört, wo
man es vernünftiger Meise am allerwenigsten er-
wartet; damit erzielt man auch einen Tffekt, es fragt
sich bloß, was für einen.
Die deutlichsten, leichtesten und darum gebräuch-
lichsten Lchlußformeln werden durch das Uüttel der
Tonstärke gewonnen, und zwar auf doppeltem Mege.
Ukan kann die Noten immer leiser klingen lassen, bis
sie schließlich nicht mehr gehört werden, dann hat
natürlich die Umsik ein Lnde. Die Analogie des
vokalen Liedes, welches allmälich in der Luft ver-
haucht, sei es vor Schmerz, sei es, weil wir uns vom
Länger räumlich entfernen, verleiht diesem Runstgriff
Allverständlichkeit, wie er denn mit Vorliebe beim
Adagio und andern getragenen Liedweisen verwendet
wird. Aonventionell können wir diese Formel kaum
nennen, da sie sich jederzeit von Neuem wieder un-
mittelbar aus sich selber erklärt. Anders verhält es
sich dagegen mit dem Grchesterlärm von beliebig zu
wiederholenden Tonioa- und Dominantenscblägen, die
wir uns heutzutage zum Svmbol des allerletzten Ab-
schlusses und zum Signal des Aufstehens erwählt
haben. Obschon nämlich die Absicht vom jDublikum
gar wohl begriffen wird, ich meine die Absicht, jetzt
gleich aufhören zu wollen, so erscheint doch das Uüttel,
welches diese Absicht offenbart, rätselhaft und der Tr-
klärung bedürftig, weil ja an sich nicht zu begreifen
ist, warum ein Stück gerade dann aufhören sollte,
wenn sich der Romponist im höchsten Zorn und das
Grchester in der fieberhaftesten nervösen Aufregung
befindet; es sei denn, daß sie das plötzliche Dahin-
stürzen von rasenden Derwischen darstellen wollten,
oder daß sie uns durch das gänzlich nichtssagende
Toben zwischen Tonica und Dominante zu verstehen
geben möchten, ihr Latein sei jetzt zu Lnde, sie wüßten
uns nichts vernünftiges oder Schönes mehr zu bieten
und daher wollten fie lieber aufhören; allein aus
diesem Grunde hätten sie meist schon viel früher auf-
hören dürfen.
Der Abschlußwert eines Schrittes von Dominant
/
— Sö —
Lrscbcint
Derausgeber:
zferdlnand Nvennrius.
Kcsrcllprets:
vierteliäbrlich 2 1/2 Mark.
2.
Zabrg.
Der konventtonelle Lcbluss der tDustkstücke
ann ein Musikstück ungesähr seinem <Lnde
zuneigt, bleibt den meisten Menschen ein
Rätsel, da das Gesühl, jetzt sei es genug,
sich meist schon viel früher zu regen
pflegt, nachdem aber einmal die Lrgebung in das
Unvermeidliche stattgefunden, das Ohr in christlicher
Geduld noch eine kleine Meile von Takten mehr
ertragen würde. Um nun das Tnde in deutlicher
weise voranzumelden, hat man sich in der Utusik
über einige Ausdruckssormeln geeinigt, welche von
Iedermann verstanden werden können und in
der That auch verstanden werden. Ts kommt
zwar selbst heute noch vor, daß etn Utusikstück ein-
fach aushört, wenn es fertig ist, und dies wird wohl
stets der feinste aller Abschlüsse bleiben; wir treffen
diese Art hauptsächlich in den knappen Lied-, Utarsch-
und Tanzformen der Instrumentalmusik, übrigens auch
am Tnde des ersten Lonaten- und Lymphoniensatzes
bei den Ulassikern. Das Anhängsel einer Toda oder
die räumliche Ausweitung der organischen Schluß-
partie (bei Beethoven) bildet keine Ausnahme, da die
betreffenden Aunstgriffe nur dazu dienen sollen, die
allzusteife j)roportion aufzuheben, ohne einen direkten
Lntlafsungsspruch ähnlich dem „Amen" in der Airche
zu bezwecken. Lbenfalls ein logischer Schluß ersten
Ranges darf ein letztmaliges Anklingen des Grund-
themas heißen, sei es in leicht andeutender Meise und
Frageform, wie z. B. häufig in den Utendelssohnschen
„Liedern ohne Morte", sei es in harmonischer Lösung,
wie in den Fugen. Das Alles sind entweder natür-
liche oder vernünftige oder geistreiche Lchlüsse edler
Art. Den Gegensatz hierzu bilden die raffinirten
^ Abbrüche, da der Romponist gerade dort aufhört, wo
man es vernünftiger Meise am allerwenigsten er-
wartet; damit erzielt man auch einen Tffekt, es fragt
sich bloß, was für einen.
Die deutlichsten, leichtesten und darum gebräuch-
lichsten Lchlußformeln werden durch das Uüttel der
Tonstärke gewonnen, und zwar auf doppeltem Mege.
Ukan kann die Noten immer leiser klingen lassen, bis
sie schließlich nicht mehr gehört werden, dann hat
natürlich die Umsik ein Lnde. Die Analogie des
vokalen Liedes, welches allmälich in der Luft ver-
haucht, sei es vor Schmerz, sei es, weil wir uns vom
Länger räumlich entfernen, verleiht diesem Runstgriff
Allverständlichkeit, wie er denn mit Vorliebe beim
Adagio und andern getragenen Liedweisen verwendet
wird. Aonventionell können wir diese Formel kaum
nennen, da sie sich jederzeit von Neuem wieder un-
mittelbar aus sich selber erklärt. Anders verhält es
sich dagegen mit dem Grchesterlärm von beliebig zu
wiederholenden Tonioa- und Dominantenscblägen, die
wir uns heutzutage zum Svmbol des allerletzten Ab-
schlusses und zum Signal des Aufstehens erwählt
haben. Obschon nämlich die Absicht vom jDublikum
gar wohl begriffen wird, ich meine die Absicht, jetzt
gleich aufhören zu wollen, so erscheint doch das Uüttel,
welches diese Absicht offenbart, rätselhaft und der Tr-
klärung bedürftig, weil ja an sich nicht zu begreifen
ist, warum ein Stück gerade dann aufhören sollte,
wenn sich der Romponist im höchsten Zorn und das
Grchester in der fieberhaftesten nervösen Aufregung
befindet; es sei denn, daß sie das plötzliche Dahin-
stürzen von rasenden Derwischen darstellen wollten,
oder daß sie uns durch das gänzlich nichtssagende
Toben zwischen Tonica und Dominante zu verstehen
geben möchten, ihr Latein sei jetzt zu Lnde, sie wüßten
uns nichts vernünftiges oder Schönes mehr zu bieten
und daher wollten fie lieber aufhören; allein aus
diesem Grunde hätten sie meist schon viel früher auf-
hören dürfen.
Der Abschlußwert eines Schrittes von Dominant
/
— Sö —