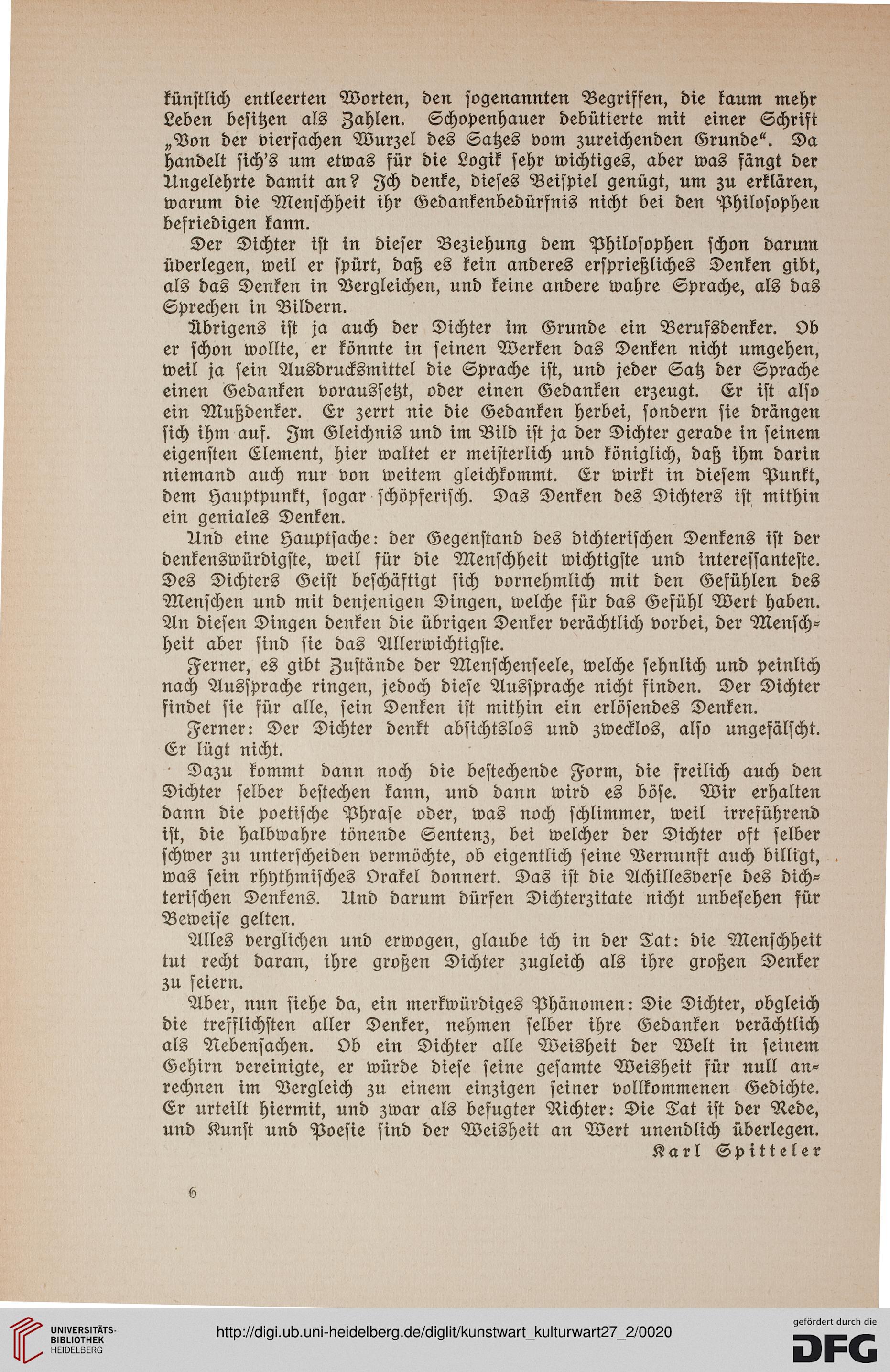künstlich entleerten Worten, den sogenannten Begriffen, die kaurn mehr
Leben besitzen als Zahlen. Schopenhauer debütierte mit einer Schrift
„Von der vierfachen Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde". Da
handelt sich's um etwas für die Logik sehr wichtiges, aber was fängt der
Angelehrte damit an? Ich denke, dieses Beispiel genügt, um zu erklaren,
warum die Menschheit ihr Gedankenbedürfnis nicht bei den Philosophen
befriedigen kann.
Der Dichter ist in dieser Beziehung dem Philosophen schon darum
üverlegen, weil er spürt, daß es kein anderes ersprießliches Denken gibt,
als das Denken in Vergleichen, und keine andere wahre Sprache, als das
Sprechen in Bildern.
Äbrigens ist ja auch der Dichter im Grunde ein Berufsdenker. Ob
er schon wollte, er könnte in seinen Werken das Denken nicht umgehen,
weil ja sein Ausdrucksmittel die Sprache ist, und jeder Satz der Sprache
einen Gedanken voraussetzt, oder einen Gedanken erzeugt. Er ist also
ein Mußdenker. Lr zerrt nie die Gedanken herbei, sondern sie drängen
sich ihm auf. Im Gleichnis und im Bild ist ja der Dichter gerade in seinem
eigensten Element, hier waltet er meisterlich und königlich, daß ihm darin
niemand auch nur von weitem gleichkommt. Er wirkt in diesem Punkt,
dem Hauptpunkt, sogar schöpferisch. Das Denken des Dichters ist mithin
ein geniales Denken.
Und eine Hauptsache: der Gegenstand des dichterischen Denkens ist der
denkenswürdigste, weil für die Menschheit wichtigste und interessanteste.
Des Dichters Geist beschäftigt sich vornehmlich mit den Gesühlen des
Menschen und mit denjenigen Dingen, welche für das Gefühl Wert haben.
An diesen Dingen denken die übrigen Denker verächtlich vorbei, der Mensch--
heit aber sind sie das Allerwichtigste.
Ferner, es gibt Zustände der Menschenseele, welche sehnlich und peinlich
nach Aussprache ringen, jedoch diese Aussprache nicht finden. Der Dichter
findet sie für alle, sein Denken ist mithin ein erlösendes Denken.
Ferner: Der Dichter denkt absichtslos und zwecklos, also ungefälscht.
Er lügt nicht.
Dazu kommt dann noch die bestechende Form, die freilich auch den
Dichter selber bestechen kann, und dann wird es böse. Wir erhalten
dann die poetische Phrase oder, was noch schlimmer, weil irreführend
ist, die halbwahre tönende Sentenz, bei welcher der Dichter oft selber
schwer zu unterscheiden vermöchte, ob eigentlich seine Vernunft auch billigt,
was sein rhythmisches Orakel donnert. Das ist die Achillesverse des dich-
terischen Denkens. Und darum dürfen Dichterzitate nicht unbesehen für
Beweise gelten.
Alles verglichen und erwogen, glaube ich in der Tat: die Menschheit
tut recht daran, ihre großen Dichter zugleich als ihre großen Denker
zu feiern.
Aber, nun siehe da, ein merkwürdiges Phänomen: Die Dichter, obgleich
die trefflichsten aller Denker, nehmen selber ihre Gedanken verächtlich
als Nebensachen. Ob ein Dichter alle Weisheit der Welt in seinem
Gehirn vereinigte, er würde diese seine gesamte Weisheit für null an--
rechnen im Vergleich zu einem einzigen seiner vollkommenen Gedichte.
Er urteilt hiermit, und zwar als befugter Richter: Die Tat ist der Rede,
und Kunst und Poesie sind der Weisheit an Wert unendlich überlegen.
Karl Spitteler
6
Leben besitzen als Zahlen. Schopenhauer debütierte mit einer Schrift
„Von der vierfachen Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde". Da
handelt sich's um etwas für die Logik sehr wichtiges, aber was fängt der
Angelehrte damit an? Ich denke, dieses Beispiel genügt, um zu erklaren,
warum die Menschheit ihr Gedankenbedürfnis nicht bei den Philosophen
befriedigen kann.
Der Dichter ist in dieser Beziehung dem Philosophen schon darum
üverlegen, weil er spürt, daß es kein anderes ersprießliches Denken gibt,
als das Denken in Vergleichen, und keine andere wahre Sprache, als das
Sprechen in Bildern.
Äbrigens ist ja auch der Dichter im Grunde ein Berufsdenker. Ob
er schon wollte, er könnte in seinen Werken das Denken nicht umgehen,
weil ja sein Ausdrucksmittel die Sprache ist, und jeder Satz der Sprache
einen Gedanken voraussetzt, oder einen Gedanken erzeugt. Er ist also
ein Mußdenker. Lr zerrt nie die Gedanken herbei, sondern sie drängen
sich ihm auf. Im Gleichnis und im Bild ist ja der Dichter gerade in seinem
eigensten Element, hier waltet er meisterlich und königlich, daß ihm darin
niemand auch nur von weitem gleichkommt. Er wirkt in diesem Punkt,
dem Hauptpunkt, sogar schöpferisch. Das Denken des Dichters ist mithin
ein geniales Denken.
Und eine Hauptsache: der Gegenstand des dichterischen Denkens ist der
denkenswürdigste, weil für die Menschheit wichtigste und interessanteste.
Des Dichters Geist beschäftigt sich vornehmlich mit den Gesühlen des
Menschen und mit denjenigen Dingen, welche für das Gefühl Wert haben.
An diesen Dingen denken die übrigen Denker verächtlich vorbei, der Mensch--
heit aber sind sie das Allerwichtigste.
Ferner, es gibt Zustände der Menschenseele, welche sehnlich und peinlich
nach Aussprache ringen, jedoch diese Aussprache nicht finden. Der Dichter
findet sie für alle, sein Denken ist mithin ein erlösendes Denken.
Ferner: Der Dichter denkt absichtslos und zwecklos, also ungefälscht.
Er lügt nicht.
Dazu kommt dann noch die bestechende Form, die freilich auch den
Dichter selber bestechen kann, und dann wird es böse. Wir erhalten
dann die poetische Phrase oder, was noch schlimmer, weil irreführend
ist, die halbwahre tönende Sentenz, bei welcher der Dichter oft selber
schwer zu unterscheiden vermöchte, ob eigentlich seine Vernunft auch billigt,
was sein rhythmisches Orakel donnert. Das ist die Achillesverse des dich-
terischen Denkens. Und darum dürfen Dichterzitate nicht unbesehen für
Beweise gelten.
Alles verglichen und erwogen, glaube ich in der Tat: die Menschheit
tut recht daran, ihre großen Dichter zugleich als ihre großen Denker
zu feiern.
Aber, nun siehe da, ein merkwürdiges Phänomen: Die Dichter, obgleich
die trefflichsten aller Denker, nehmen selber ihre Gedanken verächtlich
als Nebensachen. Ob ein Dichter alle Weisheit der Welt in seinem
Gehirn vereinigte, er würde diese seine gesamte Weisheit für null an--
rechnen im Vergleich zu einem einzigen seiner vollkommenen Gedichte.
Er urteilt hiermit, und zwar als befugter Richter: Die Tat ist der Rede,
und Kunst und Poesie sind der Weisheit an Wert unendlich überlegen.
Karl Spitteler
6