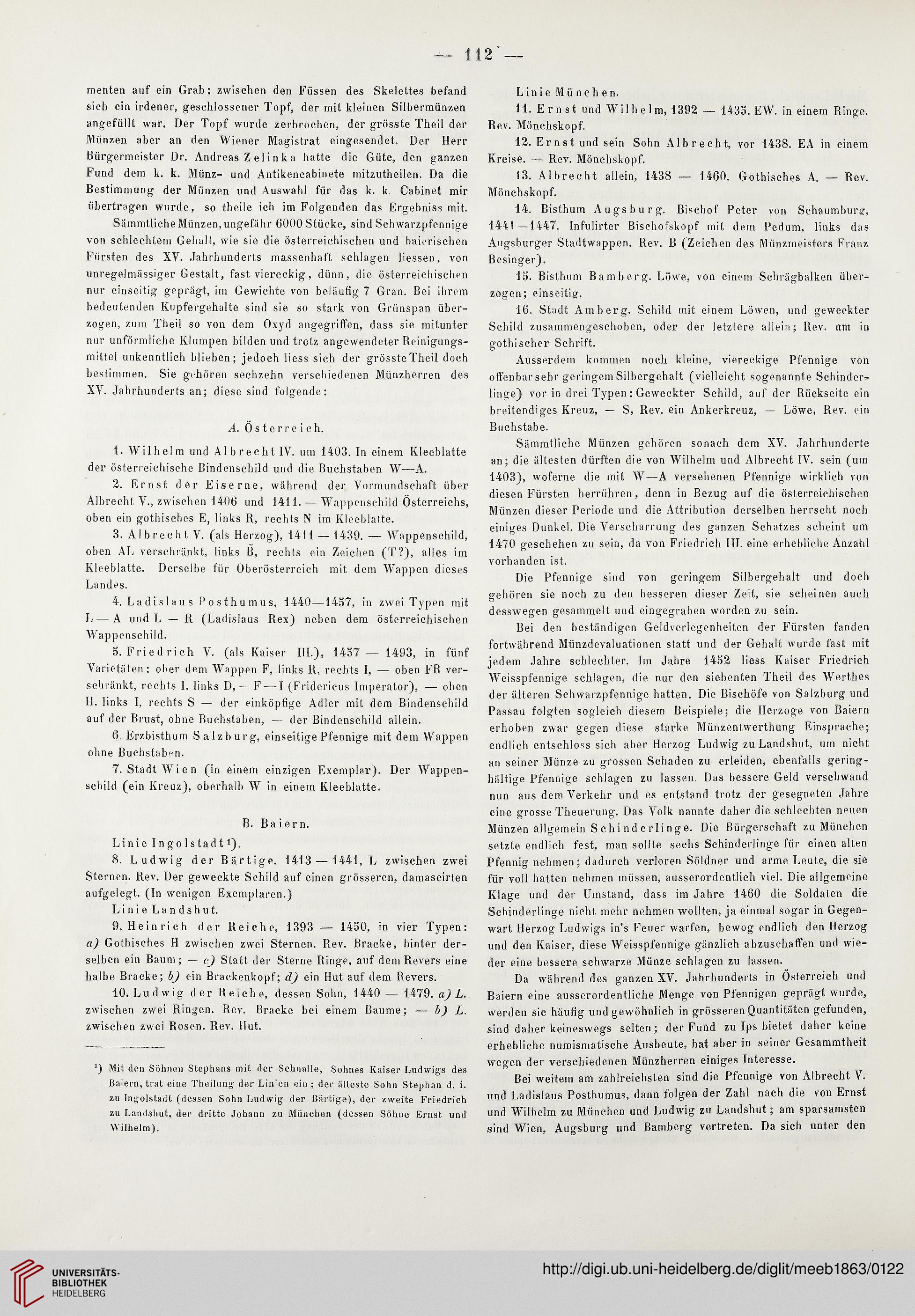112
menten auf ein Grab; zwischen den Füssen des Skelettes befand
sieh ein irdener, geschlossener Topf, der mit kleinen Silbermünzen
angefüllt war. Der Topf wurde zerbrochen, der grösste Theil der
Münzen aber an den Wiener Magistrat eingesendet. Der Herr
Bürgermeister Dr. Andreas Zelinka hatte die Güte, den ganzen
Fund dem k. k. Münz- und Antikencabinete mitzutheilen. Da die
Bestimmung der Münzen und Auswahl für das k. k Cabinet mir
übertragen wurde, so theile ich im Folgenden das Ergebniss mit.
SämmtlicheMünzen,ungefähr 6000 Stücke, sind Schwarzpfennige
von schlechtem Gehalt, wie sie die österreichischen und haierischen
Fürsten des XV. Jahrhunderts massenhaft schlagen Hessen, von
unregelmässiger Gestalt, fast viereckig, dünn, die österreichischen
nur einseitig geprägt, im Gewichte von beläufig 7 Gran. Bei ihrem
bedeutenden Kupfergehalte sind sie so stark von Grünspan über-
zogen, zum Theil so von dem Oxyd angegriffen, dass sie mitunter
nur unförmliche Klumpen bilden und trotz angewendeter Reinigungs-
mittel unkenntlich blieben; jedoch liess sich der grössteTheil doch
bestimmen. Sie gehören sechzehn verschiedenen Münzherren des
XV. Jahrhunderts an; diese sind folgende:
A. Österreich.
1. Wilhelm und Al b recht IV. um 1403. ln einem Kleeblatte
der österreichische Bindenschild und die Buchstaben W—A.
2. Ernst der Eiserne, während der Vormundschaft über
Albrecht V., zwischen 1406 und 1411. — Wappenschild Österreichs,
oben ein gothisches E, links R, rechts N im Kleeblatte.
3. Al b ree h t V. (als Herzog), 1411 — 1439. — Wappenschild,
oben AL verschränkt, links B, rechts ein Zeichen (T?), alles im
Kleeblatte. Derselbe für Oberösterreich mit dem Wappen dieses
Landes.
4. Ladislaus Posthumus, 1440—1457, in zwei Typen mit
L — A undL — R (Ladislaus Rex) neben dem österreichischen
Wappenschild.
5. Friedrich V. (als Kaiser I1L), 1457 — 1493, in fünf
Varietäten: ober dem Wappen F, links R, rechts I, — oben FR ver-
schränkt, rechts I, links D, - F — I (Fridericus Imperator), — oben
H. links I. rechts S — der einköpfige Adler mit dem Bindenschild
auf der Brust, ohne Buchstaben, — der Bindenschild allein.
6. Erzbisthum Salzburg, einseitige Pfennige mit dem Wappen
ohne Buchstaben.
7. Stadt Wien (in einem einzigen Exemplar). Der Wappen-
schild (ein Kreuz), oberhalb W in einem Kleeblatte.
B. Baiern.
Linie Ingolstadt*).
8. Ludwig der Bärtige. 1413 — 1441, L zwischen zwei
Sternen. Rev. Der geweckte Schild auf einen grösseren, damascirten
aufgelegt. (In wenigen Exemplaren.)
Linie Landshut.
9. Heinrich der Reiche, 1393 — 1450, in vier Typen:
o) Gothisches H zwischen zwei Sternen. Rev. Bracke, hinter der-
selben ein Baum; — c) Statt der Sterne Ringe, auf dem Revers eine
halbe Bracke; ein Brackenkopf; dl) ein Hut auf dem Revers.
10. Ludwig der Reiche, dessen Sohn, 1440 — 1479. a) T.
zwischen zwei Ringen. Rev. Bracke bei einem Baume; — d) L.
zwischen zwei Rosen. Rev. Hut.
0 Mit den Söhnen Stephans mit der Schnalle, Sohnes Kaiser Ludwigs des
Baiern, trat eine Theilung der Linien ein ; der älteste Sohn Stephan d. i.
Wilhelmj.
Linie München.
11. Ernst und Wilhelm, 1392 — 1435. EW. in einem Ringe.
Rev. Mönchskopf.
12. Ernst und sein Sohn Albrecht, vor 1438. EA in einem
Kreise. — Rev. Mönchskopf.
13. Albrecht allein, 1438 — 1460. Gothisches A. — Rev.
Mönchskopf.
14. Bisthum Augsburg. Bischof Peter von Schaumburg,
1441—1447. Infulirter Bischofskopf mit dem Pedum, links das
Augsburger Stadtwappen. Rev. B (Zeichen des Münzmeisters Franz
Besingen).
15. Bisthum Bamberg. Löwe, von einem Schrägbalken über-
zogen; einseitig.
16. Stadt Am b erg. Schild mit einem Löwen, und geweckter
Schild zusammengeschoben, oder der letztere allein; Rev. ttnt in
gothischer Schrift.
Ausserdem kommen noch kleine, viereckige Pfennige von
offenbar sehr geringem Silbergehalt (vielleicht sogenannt e Schinder-
linge) vor in drei Typen: Geweckter Schild, auf der Rückseite ein
breitendiges Kreuz, — S, Rev. ein Ankerkreuz, — Löwe, Rev. ein
Buchstabe.
Sämmtliche Münzen gehören sonach dem XV. Jahrhunderte
an; die ältesten dürften die von Wilhelm und Albrecht IV. sein (um
1403), woferne die mit W—A versehenen Pfennige wirklich von
diesen Fürsten herrühren, denn in Bezug auf die österreichischen
Münzen dieser Periode und die Attribution derselben herrscht noch
einiges Dunkel. Die Verscharrung des ganzen Schatzes scheint um
1470 geschehen zu sein, da von Friedrich MI. eine erhebliche Anzahl
vorhanden ist.
Die Pfennige sind von geringem Silbergehalt und doch
gehören sie noch zu den besseren dieser Zeit, sie scheinen auch
desswegen gesammelt und eingegraben worden zu sein.
Bei den beständigen Geldverlegenheiten der Fürsten fanden
fortwährend Münzdevaluationen statt und der Gehalt wurde fast mit
jedem Jahre schlechter. Im Jahre 1452 liess Kaiser Friedrich
Weisspfennige schlagen, die nur den siebenten Theil des Werthes
der älteren Schwarzpfennige hatten. Die Bischöfe von Salzburg und
Passau folgten sogleich diesem Beispiele; die Herzoge von Baiern
erhoben zwar gegen diese starke Münzentwerthung Einsprache;
endlich entschloss sich aber Herzog Ludwig zu Landshut, um nicht
an seiner Münze zu grossen Schaden zu erleiden, ebenfalls gering-
hältige Pfennige schlagen zu lassen. Das bessere Geld verschwand
nun aus dem Verkehr und es entstand trotz der gesegneten Jahre
eine grosse Theuerung. Das Volk nannte daher die schlechten neuen
Münzen allgemein Schinderlinge. Die Bürgerschaft zu München
setzte endlich fest, man sollte sechs Schinderlinge für einen alten
Pfennig nehmen; dadurch verloren Söldner und arme Leute, die sie
für voll hatten nehmen müssen, ausserordentlich viel. Die allgemeine
Klage und der Umstand, dass im Jahre 1460 die Soldaten die
Schinderlinge nicht mehr nehmen wollten, ja einmal sogar in Gegen-
wart Herzog Ludwigs in's Feuer warfen, bewog endlich den Herzog
und den Kaiser, diese Weisspfennige gänzlich abzuschaffen und wie-
der eine bessere schwarze Münze schlagen zu lassen.
Da während des ganzen XV. Jahrhunderts in Österreich und
Baiern eine ausserordentliche Menge von Pfennigen geprägt wurde,
werden sie häuhg und gewöhnlich in grösserenQuantitäten gefunden,
sind daher keineswegs selten; der Fund zu Ips bietet daher keine
erhebliche numismatische Ausbeute, hat aber in seiner Gesammtheit
wegen der verschiedenen Münzherren einiges Interesse.
Bei weitem am zahlreichsten sind die Pfennige von Albrecht V.
und Ladislaus Posthumus, dann folgen der Zahl nach die von Ernst
und Wilhelm zu München und Ludwig zu Landshut; am sparsamsten
sind Wien, Augsburg und Bamberg vertreten. Da sich unter den
menten auf ein Grab; zwischen den Füssen des Skelettes befand
sieh ein irdener, geschlossener Topf, der mit kleinen Silbermünzen
angefüllt war. Der Topf wurde zerbrochen, der grösste Theil der
Münzen aber an den Wiener Magistrat eingesendet. Der Herr
Bürgermeister Dr. Andreas Zelinka hatte die Güte, den ganzen
Fund dem k. k. Münz- und Antikencabinete mitzutheilen. Da die
Bestimmung der Münzen und Auswahl für das k. k Cabinet mir
übertragen wurde, so theile ich im Folgenden das Ergebniss mit.
SämmtlicheMünzen,ungefähr 6000 Stücke, sind Schwarzpfennige
von schlechtem Gehalt, wie sie die österreichischen und haierischen
Fürsten des XV. Jahrhunderts massenhaft schlagen Hessen, von
unregelmässiger Gestalt, fast viereckig, dünn, die österreichischen
nur einseitig geprägt, im Gewichte von beläufig 7 Gran. Bei ihrem
bedeutenden Kupfergehalte sind sie so stark von Grünspan über-
zogen, zum Theil so von dem Oxyd angegriffen, dass sie mitunter
nur unförmliche Klumpen bilden und trotz angewendeter Reinigungs-
mittel unkenntlich blieben; jedoch liess sich der grössteTheil doch
bestimmen. Sie gehören sechzehn verschiedenen Münzherren des
XV. Jahrhunderts an; diese sind folgende:
A. Österreich.
1. Wilhelm und Al b recht IV. um 1403. ln einem Kleeblatte
der österreichische Bindenschild und die Buchstaben W—A.
2. Ernst der Eiserne, während der Vormundschaft über
Albrecht V., zwischen 1406 und 1411. — Wappenschild Österreichs,
oben ein gothisches E, links R, rechts N im Kleeblatte.
3. Al b ree h t V. (als Herzog), 1411 — 1439. — Wappenschild,
oben AL verschränkt, links B, rechts ein Zeichen (T?), alles im
Kleeblatte. Derselbe für Oberösterreich mit dem Wappen dieses
Landes.
4. Ladislaus Posthumus, 1440—1457, in zwei Typen mit
L — A undL — R (Ladislaus Rex) neben dem österreichischen
Wappenschild.
5. Friedrich V. (als Kaiser I1L), 1457 — 1493, in fünf
Varietäten: ober dem Wappen F, links R, rechts I, — oben FR ver-
schränkt, rechts I, links D, - F — I (Fridericus Imperator), — oben
H. links I. rechts S — der einköpfige Adler mit dem Bindenschild
auf der Brust, ohne Buchstaben, — der Bindenschild allein.
6. Erzbisthum Salzburg, einseitige Pfennige mit dem Wappen
ohne Buchstaben.
7. Stadt Wien (in einem einzigen Exemplar). Der Wappen-
schild (ein Kreuz), oberhalb W in einem Kleeblatte.
B. Baiern.
Linie Ingolstadt*).
8. Ludwig der Bärtige. 1413 — 1441, L zwischen zwei
Sternen. Rev. Der geweckte Schild auf einen grösseren, damascirten
aufgelegt. (In wenigen Exemplaren.)
Linie Landshut.
9. Heinrich der Reiche, 1393 — 1450, in vier Typen:
o) Gothisches H zwischen zwei Sternen. Rev. Bracke, hinter der-
selben ein Baum; — c) Statt der Sterne Ringe, auf dem Revers eine
halbe Bracke; ein Brackenkopf; dl) ein Hut auf dem Revers.
10. Ludwig der Reiche, dessen Sohn, 1440 — 1479. a) T.
zwischen zwei Ringen. Rev. Bracke bei einem Baume; — d) L.
zwischen zwei Rosen. Rev. Hut.
0 Mit den Söhnen Stephans mit der Schnalle, Sohnes Kaiser Ludwigs des
Baiern, trat eine Theilung der Linien ein ; der älteste Sohn Stephan d. i.
Wilhelmj.
Linie München.
11. Ernst und Wilhelm, 1392 — 1435. EW. in einem Ringe.
Rev. Mönchskopf.
12. Ernst und sein Sohn Albrecht, vor 1438. EA in einem
Kreise. — Rev. Mönchskopf.
13. Albrecht allein, 1438 — 1460. Gothisches A. — Rev.
Mönchskopf.
14. Bisthum Augsburg. Bischof Peter von Schaumburg,
1441—1447. Infulirter Bischofskopf mit dem Pedum, links das
Augsburger Stadtwappen. Rev. B (Zeichen des Münzmeisters Franz
Besingen).
15. Bisthum Bamberg. Löwe, von einem Schrägbalken über-
zogen; einseitig.
16. Stadt Am b erg. Schild mit einem Löwen, und geweckter
Schild zusammengeschoben, oder der letztere allein; Rev. ttnt in
gothischer Schrift.
Ausserdem kommen noch kleine, viereckige Pfennige von
offenbar sehr geringem Silbergehalt (vielleicht sogenannt e Schinder-
linge) vor in drei Typen: Geweckter Schild, auf der Rückseite ein
breitendiges Kreuz, — S, Rev. ein Ankerkreuz, — Löwe, Rev. ein
Buchstabe.
Sämmtliche Münzen gehören sonach dem XV. Jahrhunderte
an; die ältesten dürften die von Wilhelm und Albrecht IV. sein (um
1403), woferne die mit W—A versehenen Pfennige wirklich von
diesen Fürsten herrühren, denn in Bezug auf die österreichischen
Münzen dieser Periode und die Attribution derselben herrscht noch
einiges Dunkel. Die Verscharrung des ganzen Schatzes scheint um
1470 geschehen zu sein, da von Friedrich MI. eine erhebliche Anzahl
vorhanden ist.
Die Pfennige sind von geringem Silbergehalt und doch
gehören sie noch zu den besseren dieser Zeit, sie scheinen auch
desswegen gesammelt und eingegraben worden zu sein.
Bei den beständigen Geldverlegenheiten der Fürsten fanden
fortwährend Münzdevaluationen statt und der Gehalt wurde fast mit
jedem Jahre schlechter. Im Jahre 1452 liess Kaiser Friedrich
Weisspfennige schlagen, die nur den siebenten Theil des Werthes
der älteren Schwarzpfennige hatten. Die Bischöfe von Salzburg und
Passau folgten sogleich diesem Beispiele; die Herzoge von Baiern
erhoben zwar gegen diese starke Münzentwerthung Einsprache;
endlich entschloss sich aber Herzog Ludwig zu Landshut, um nicht
an seiner Münze zu grossen Schaden zu erleiden, ebenfalls gering-
hältige Pfennige schlagen zu lassen. Das bessere Geld verschwand
nun aus dem Verkehr und es entstand trotz der gesegneten Jahre
eine grosse Theuerung. Das Volk nannte daher die schlechten neuen
Münzen allgemein Schinderlinge. Die Bürgerschaft zu München
setzte endlich fest, man sollte sechs Schinderlinge für einen alten
Pfennig nehmen; dadurch verloren Söldner und arme Leute, die sie
für voll hatten nehmen müssen, ausserordentlich viel. Die allgemeine
Klage und der Umstand, dass im Jahre 1460 die Soldaten die
Schinderlinge nicht mehr nehmen wollten, ja einmal sogar in Gegen-
wart Herzog Ludwigs in's Feuer warfen, bewog endlich den Herzog
und den Kaiser, diese Weisspfennige gänzlich abzuschaffen und wie-
der eine bessere schwarze Münze schlagen zu lassen.
Da während des ganzen XV. Jahrhunderts in Österreich und
Baiern eine ausserordentliche Menge von Pfennigen geprägt wurde,
werden sie häuhg und gewöhnlich in grösserenQuantitäten gefunden,
sind daher keineswegs selten; der Fund zu Ips bietet daher keine
erhebliche numismatische Ausbeute, hat aber in seiner Gesammtheit
wegen der verschiedenen Münzherren einiges Interesse.
Bei weitem am zahlreichsten sind die Pfennige von Albrecht V.
und Ladislaus Posthumus, dann folgen der Zahl nach die von Ernst
und Wilhelm zu München und Ludwig zu Landshut; am sparsamsten
sind Wien, Augsburg und Bamberg vertreten. Da sich unter den