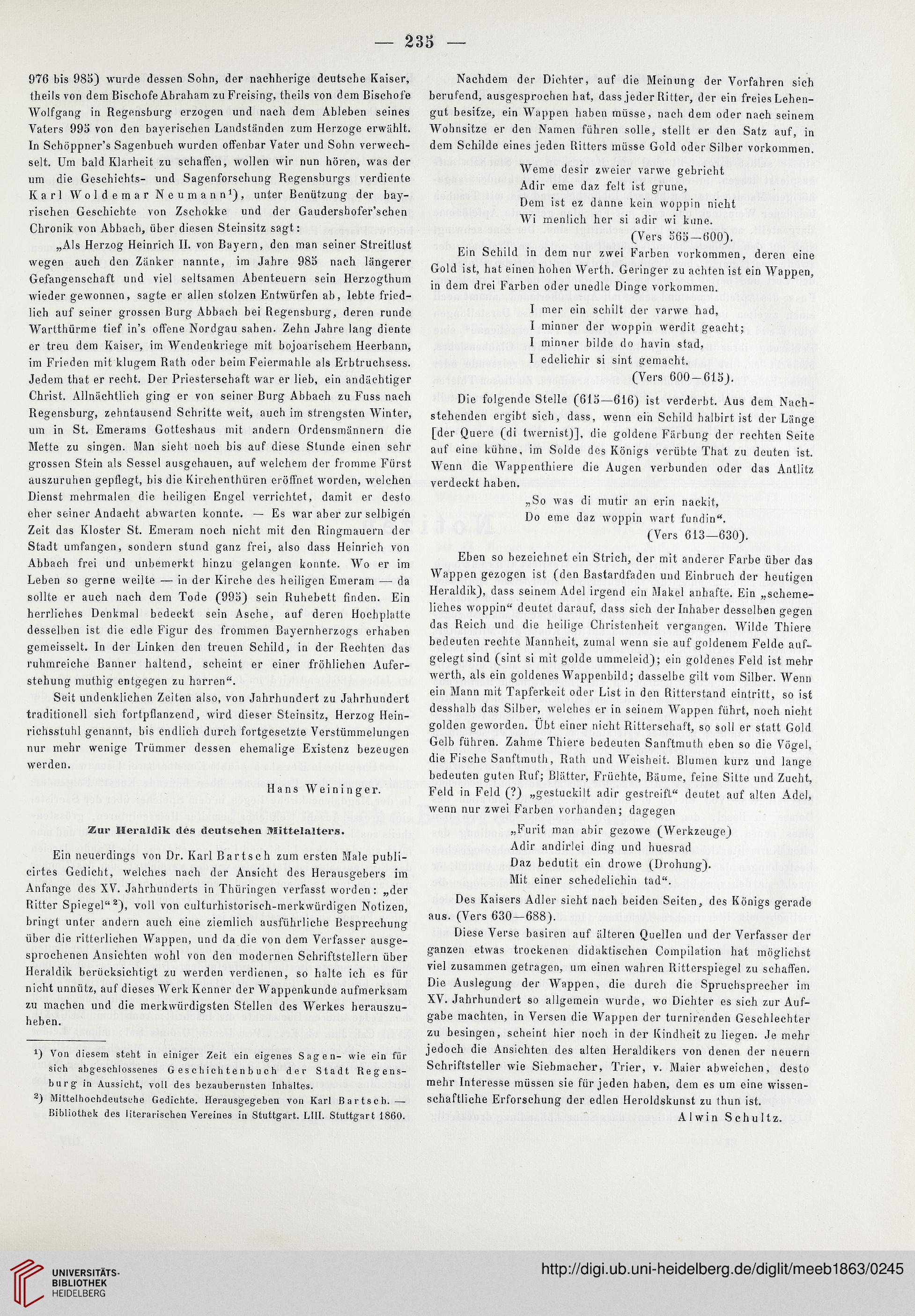— 235
976 bis 985) wurde dessen Sohn, der nacbherige deutsche Kaiser,
theiis von dem Bischöfe Abraham zu Freising, theiis von dem Bischöfe
Wolfgang in Regensburg erzogen und nach dem Ableben seines
Vaters 995 von den bayerischen Landständen zum Herzoge erwählt.
In Schöppner's Sagenbuch wurden olfenbar Vater und Sohn verwech-
selt. Um bald Klarheit zu schaffen, wollen wir nun hören, was der
um die Geschicbts- und Sagenforschung Regensburgs verdiente
Karl W o 1 d e m a r N e u m a n n i) , unter Benützung der bay-
rischen Geschichte von Zschokke und der Gaudershofer'schen
Chronik von Abbach, über diesen Steinsitz sagt:
„Als Herzog Heinrich II. von Bayern, den man seiner Streitlust
wegen auch den Zänker nannte, im Jahre 985 nach längerer
Gefangenschaft und viel seltsamen Abenteuern sein Herzogthum
wieder gewonnen, sagte er allen stolzen Entwürfen ab, lebte fried-
lich auf seiner grossen Burg Abbach bei Regensburg, deren runde
Wartthürme tief in's olfene Nordgau sahen. Zehn Jahre lang diente
er treu dem Kaiser, im Wendenkriege mit bojoarisehem Heerbann,
im Frieden mit klugem Rath oder beim Feiermahle als Erbtruchsess.
Jedem that er recht. Der Priesterschaft war er lieb, ein andächtiger
Christ. Allnächtlich ging er von seiner Burg Abbach zu Fuss nach
Regensburg, zehntausend Schritte weit, auch im strengsten Winter,
um in St. Emerams Gotteshaus mit andern Ordensmännern die
Mette zu singen. Man sieht noch bis auf diese Stunde einen sehr
grossen Stein als Sessel ausgehauen, auf welchem der fromme Fürst
auszuruhen gepflegt, bis die Kirchenthüren eröffnet worden, welchen
Dienst mehrmalen die heiligen Engel verrichtet, damit er deslo
eher seiner Andacht abwarten konnte. — Es war aber zur selbigen
Zeit das Kloster St. Emeram noch nicht mit den Ringmauern der
Stadt umfangen, sondern stund ganz frei, also dass Heinrich von
Abbach frei und unbemerkt hinzu gelangen konnte. Wo er im
Leben so gerne weilte — in der Kirche des heiligen Emeram — da
sollte er auch nach dem Tode (995) sein Ruhebett ßnden. Ein
herrliches Denkmal bedeckt sein Asche, auf deren Hochplatte
desselben ist die edle Figur des frommen Bayernherzogs erhaben
gcmeisselt. In der Linken den treuen Schild, in der Rechten das
ruhmreiche Banner haltend, scheint er einer fröhlichen Aufer-
stehung muthig entgegen zu harren".
Seit undenklichen Zeiten also, von Jahrhundert zu Jahrhundert
traditionell sich fortpflanzend, wird dieser Steinsitz, Herzog Hein-
richsstuhl genannt, bis endlich durch fortgesetzte Verstümmelungen
nur mehr wenige Trümmer dessen ehemalige Existenz bezeugen
werden.
Hans W e i n i n g e r.
Zur HeraMik des deutschen Mittetalters.
Ein neuerdings von Dr. Karl Bartsch zum ersten Male publi-
cirtes Gedicht, welches nach der Ansicht des Herausgebers im
Anfänge des XV. Jahrhunderts in Thüringen verfasst worden : „der
Ritter Spiegel" ^), voll von culturhistorisch-merkwürdigen Notizen,
bringt unter andern auch eine ziemlich ausführliche Besprechung
über die ritterlichen Wappen, und da die von dem Verfasser ausge-
sprochenen Ansichten wohl von den modernen Schriftstellern über
Heraldik berücksichtigt zu werden verdienen, so halte ich es für
nicht unnütz, auf dieses Werk Kenner der Wappenkunde aufmerksam
zu machen und die merkwürdigsten Stellen des Werkes herauszu-
heben.
i) Von diesem steht in einiger Zeit ein eigenes Sagen- wie ein für
sich abgeschlossenes Geschichtenbuch der Stadt Regens-
burg in Aussicht, voll des bezaubernsten Inhaltes.
Bibliothek des literarischen Vereines in Stuttgart. UH. Stuttgart 1860.
Nachdem der Dichter, auf die Meinung der Vorfahren sich
berufend, ausgesprochen hat, dass jeder Ritter, der ein freies Lehen-
gut besitze, ein Wappen haben müsse, nach dem oder nach seinem
Wohnsitze er den Namen führen solle, stellt er den Satz auf, in
dem Schilde eines jeden Ritters müsse Gold oder Silber Vorkommen.
Werne desir zweier varwe gebricht
Adir eme daz feit ist grüne,
Dem ist ez danne kein woppin nicht
Wi menlich her si adir wi kune.
(Vers 565 — 600).
Ein Schild in dem nur zwei Farben Vorkommen, deren eine
Gold ist, hat einen hohen Werth. Geringer zu achten ist ein Wappen,
in dem drei Farben oder unedle Dinge Vorkommen.
I mer ein schilt der varwe had,
I minner der woppin werdit geacht;
I minner bilde do havin stad,
I edelichir si sint gemacht.
(Vers 600 — 615).
Die folgende Stelle (615—616) ist verderbt. Aus dem Nach-
stehenden ergibt sich, dass, wenn ein Schild halbirt ist der Länge
[der Quere (di twernist)], die goldene Färbung der rechten Seite
auf eine kühne, im Solde des Königs verübte That zu deuten ist.
Wenn die Wappenthiere die Augen verbunden oder das Antlitz
verdeckt haben.
„So was di mutir an erin nackit,
Do eme daz woppin wart fundin".
(Vers 613—630).
Eben so bezeichnet ein Strich, der mit anderer Farbe über das
Wappen gezogen ist (den Bastardfaden und Einbruch der heutigen
Heraldik), dass seinem Adel irgend ein Makel anhafte. Ein „scheme-
liches woppin" deutet darauf, dass sich der Inhaber desselben gegen
das Reich und die heilige Christenheit vergangen. Wilde Thiere
bedeuten rechte Mannheit, zumal wenn sie auf goldenem Felde auf-
gelegt sind (sint si mit golde ummeleid); ein goldenes Feld ist mehr
werth, als ein goldenes Wappenbild; dasselbe gilt vom Silber. Wenn
ein Mann mit Tapferkeit oder List in den Ritterstand eintritt, so ist
desshalb das Silber, welches er in seinem Wappen führt, noch nicht
golden geworden. Übt einer nicht Ritterschaft, so soll er statt Gold
Gelb führen. Zahme Thiere bedeuten Sanftmuth eben so die Vögel,
die Fische Sanftmuth, Rath und Weisheit. Blumen kurz und lange
bedeuten guten Ruf; Blätter, Früchte, Bäume, feine Sitte und Zucht,
Feld in Feld (?) „gestuckilt adir gestreift" deutet auf alten Adel,
wenn nur zwei Farben vorhanden; dagegen
„Furit man abir gezowe (Werkzeuge)
Adir andirlei ding und huesrad
Daz bedutit ein drowe (Drohung).
Mit einer schedelichin tad".
Des Kaisers Adler sieht nach beiden Seiten, des Königs gerade
aus. (Vers 630—688).
Diese Verse basiren auf älteren Quellen und der Verfasser der
ganzen etwas trockenen didaktischen Compilation hat möglichst
viel zusammen getragen, um einen wahren Ritterspiegel zu schaffen.
Die Auslegung der Wappen, die durch die Spruchsprecher im
XV. Jahrhundert so allgemein wurde, wo Dichter es sich zur Auf-
gabe machten, in Versen die Wappen der turnirenden Geschlechter
zu besingen, scheint hier noch in der Kindheit zu liegen. Je mehr
jedoch die Ansichten des alten Heraldikers von denen der neuern
Schriftsteller wie Siebmacher, Trier, v. Maier abweichen, desto
mehr Interesse müssen sie für jeden haben, dem es um eine wissen-
schaftliche Erforschung der edlen Heroldskunst zu thun ist.
Alwin Schultz.
976 bis 985) wurde dessen Sohn, der nacbherige deutsche Kaiser,
theiis von dem Bischöfe Abraham zu Freising, theiis von dem Bischöfe
Wolfgang in Regensburg erzogen und nach dem Ableben seines
Vaters 995 von den bayerischen Landständen zum Herzoge erwählt.
In Schöppner's Sagenbuch wurden olfenbar Vater und Sohn verwech-
selt. Um bald Klarheit zu schaffen, wollen wir nun hören, was der
um die Geschicbts- und Sagenforschung Regensburgs verdiente
Karl W o 1 d e m a r N e u m a n n i) , unter Benützung der bay-
rischen Geschichte von Zschokke und der Gaudershofer'schen
Chronik von Abbach, über diesen Steinsitz sagt:
„Als Herzog Heinrich II. von Bayern, den man seiner Streitlust
wegen auch den Zänker nannte, im Jahre 985 nach längerer
Gefangenschaft und viel seltsamen Abenteuern sein Herzogthum
wieder gewonnen, sagte er allen stolzen Entwürfen ab, lebte fried-
lich auf seiner grossen Burg Abbach bei Regensburg, deren runde
Wartthürme tief in's olfene Nordgau sahen. Zehn Jahre lang diente
er treu dem Kaiser, im Wendenkriege mit bojoarisehem Heerbann,
im Frieden mit klugem Rath oder beim Feiermahle als Erbtruchsess.
Jedem that er recht. Der Priesterschaft war er lieb, ein andächtiger
Christ. Allnächtlich ging er von seiner Burg Abbach zu Fuss nach
Regensburg, zehntausend Schritte weit, auch im strengsten Winter,
um in St. Emerams Gotteshaus mit andern Ordensmännern die
Mette zu singen. Man sieht noch bis auf diese Stunde einen sehr
grossen Stein als Sessel ausgehauen, auf welchem der fromme Fürst
auszuruhen gepflegt, bis die Kirchenthüren eröffnet worden, welchen
Dienst mehrmalen die heiligen Engel verrichtet, damit er deslo
eher seiner Andacht abwarten konnte. — Es war aber zur selbigen
Zeit das Kloster St. Emeram noch nicht mit den Ringmauern der
Stadt umfangen, sondern stund ganz frei, also dass Heinrich von
Abbach frei und unbemerkt hinzu gelangen konnte. Wo er im
Leben so gerne weilte — in der Kirche des heiligen Emeram — da
sollte er auch nach dem Tode (995) sein Ruhebett ßnden. Ein
herrliches Denkmal bedeckt sein Asche, auf deren Hochplatte
desselben ist die edle Figur des frommen Bayernherzogs erhaben
gcmeisselt. In der Linken den treuen Schild, in der Rechten das
ruhmreiche Banner haltend, scheint er einer fröhlichen Aufer-
stehung muthig entgegen zu harren".
Seit undenklichen Zeiten also, von Jahrhundert zu Jahrhundert
traditionell sich fortpflanzend, wird dieser Steinsitz, Herzog Hein-
richsstuhl genannt, bis endlich durch fortgesetzte Verstümmelungen
nur mehr wenige Trümmer dessen ehemalige Existenz bezeugen
werden.
Hans W e i n i n g e r.
Zur HeraMik des deutschen Mittetalters.
Ein neuerdings von Dr. Karl Bartsch zum ersten Male publi-
cirtes Gedicht, welches nach der Ansicht des Herausgebers im
Anfänge des XV. Jahrhunderts in Thüringen verfasst worden : „der
Ritter Spiegel" ^), voll von culturhistorisch-merkwürdigen Notizen,
bringt unter andern auch eine ziemlich ausführliche Besprechung
über die ritterlichen Wappen, und da die von dem Verfasser ausge-
sprochenen Ansichten wohl von den modernen Schriftstellern über
Heraldik berücksichtigt zu werden verdienen, so halte ich es für
nicht unnütz, auf dieses Werk Kenner der Wappenkunde aufmerksam
zu machen und die merkwürdigsten Stellen des Werkes herauszu-
heben.
i) Von diesem steht in einiger Zeit ein eigenes Sagen- wie ein für
sich abgeschlossenes Geschichtenbuch der Stadt Regens-
burg in Aussicht, voll des bezaubernsten Inhaltes.
Bibliothek des literarischen Vereines in Stuttgart. UH. Stuttgart 1860.
Nachdem der Dichter, auf die Meinung der Vorfahren sich
berufend, ausgesprochen hat, dass jeder Ritter, der ein freies Lehen-
gut besitze, ein Wappen haben müsse, nach dem oder nach seinem
Wohnsitze er den Namen führen solle, stellt er den Satz auf, in
dem Schilde eines jeden Ritters müsse Gold oder Silber Vorkommen.
Werne desir zweier varwe gebricht
Adir eme daz feit ist grüne,
Dem ist ez danne kein woppin nicht
Wi menlich her si adir wi kune.
(Vers 565 — 600).
Ein Schild in dem nur zwei Farben Vorkommen, deren eine
Gold ist, hat einen hohen Werth. Geringer zu achten ist ein Wappen,
in dem drei Farben oder unedle Dinge Vorkommen.
I mer ein schilt der varwe had,
I minner der woppin werdit geacht;
I minner bilde do havin stad,
I edelichir si sint gemacht.
(Vers 600 — 615).
Die folgende Stelle (615—616) ist verderbt. Aus dem Nach-
stehenden ergibt sich, dass, wenn ein Schild halbirt ist der Länge
[der Quere (di twernist)], die goldene Färbung der rechten Seite
auf eine kühne, im Solde des Königs verübte That zu deuten ist.
Wenn die Wappenthiere die Augen verbunden oder das Antlitz
verdeckt haben.
„So was di mutir an erin nackit,
Do eme daz woppin wart fundin".
(Vers 613—630).
Eben so bezeichnet ein Strich, der mit anderer Farbe über das
Wappen gezogen ist (den Bastardfaden und Einbruch der heutigen
Heraldik), dass seinem Adel irgend ein Makel anhafte. Ein „scheme-
liches woppin" deutet darauf, dass sich der Inhaber desselben gegen
das Reich und die heilige Christenheit vergangen. Wilde Thiere
bedeuten rechte Mannheit, zumal wenn sie auf goldenem Felde auf-
gelegt sind (sint si mit golde ummeleid); ein goldenes Feld ist mehr
werth, als ein goldenes Wappenbild; dasselbe gilt vom Silber. Wenn
ein Mann mit Tapferkeit oder List in den Ritterstand eintritt, so ist
desshalb das Silber, welches er in seinem Wappen führt, noch nicht
golden geworden. Übt einer nicht Ritterschaft, so soll er statt Gold
Gelb führen. Zahme Thiere bedeuten Sanftmuth eben so die Vögel,
die Fische Sanftmuth, Rath und Weisheit. Blumen kurz und lange
bedeuten guten Ruf; Blätter, Früchte, Bäume, feine Sitte und Zucht,
Feld in Feld (?) „gestuckilt adir gestreift" deutet auf alten Adel,
wenn nur zwei Farben vorhanden; dagegen
„Furit man abir gezowe (Werkzeuge)
Adir andirlei ding und huesrad
Daz bedutit ein drowe (Drohung).
Mit einer schedelichin tad".
Des Kaisers Adler sieht nach beiden Seiten, des Königs gerade
aus. (Vers 630—688).
Diese Verse basiren auf älteren Quellen und der Verfasser der
ganzen etwas trockenen didaktischen Compilation hat möglichst
viel zusammen getragen, um einen wahren Ritterspiegel zu schaffen.
Die Auslegung der Wappen, die durch die Spruchsprecher im
XV. Jahrhundert so allgemein wurde, wo Dichter es sich zur Auf-
gabe machten, in Versen die Wappen der turnirenden Geschlechter
zu besingen, scheint hier noch in der Kindheit zu liegen. Je mehr
jedoch die Ansichten des alten Heraldikers von denen der neuern
Schriftsteller wie Siebmacher, Trier, v. Maier abweichen, desto
mehr Interesse müssen sie für jeden haben, dem es um eine wissen-
schaftliche Erforschung der edlen Heroldskunst zu thun ist.
Alwin Schultz.