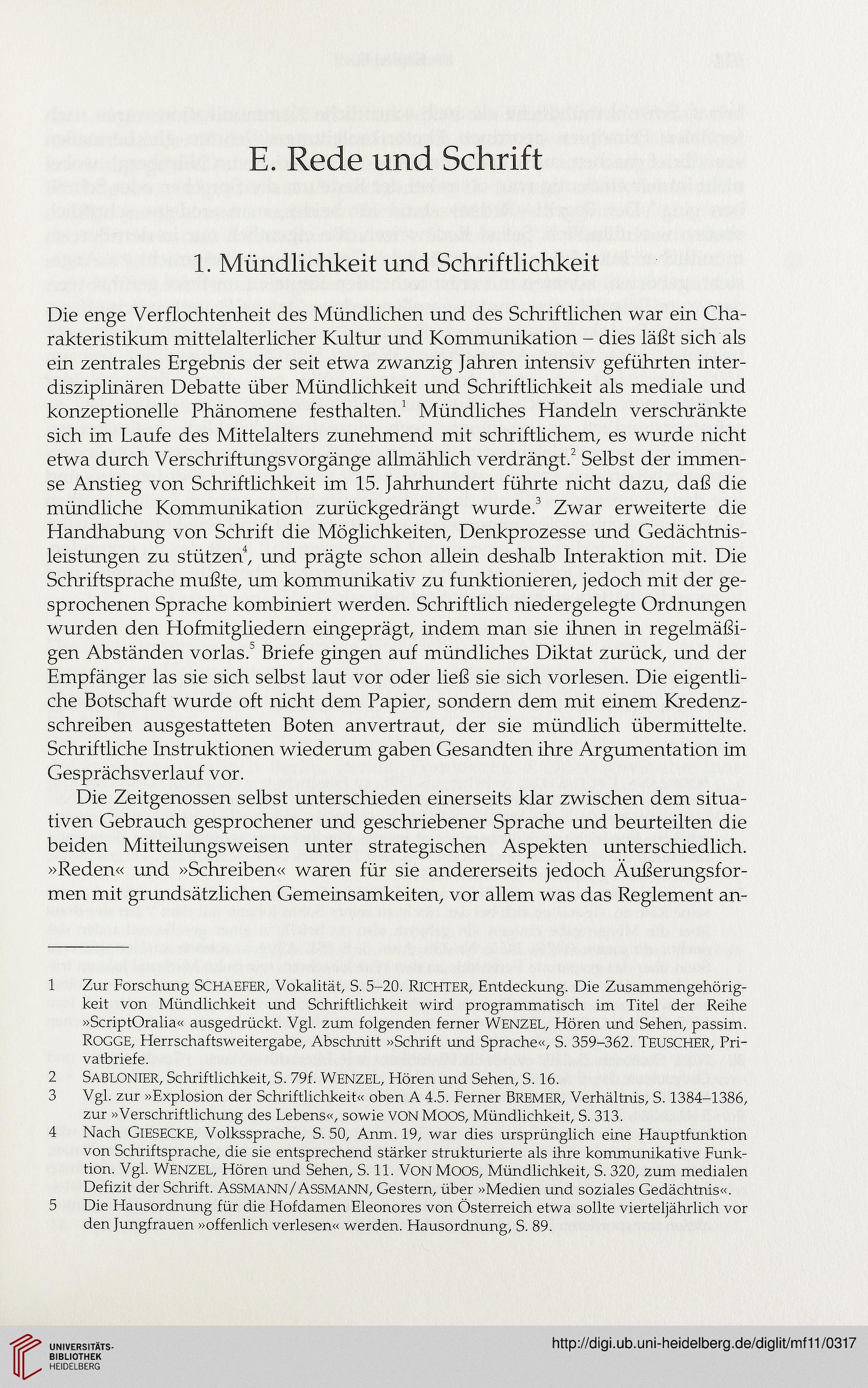E. Rede und Schrift
1. Mündlichkeit und Schriftlichkeit
Die enge Verflochtenheit des Mündlichen und des Schriftlichen war ein Cha-
rakteristikum mittelalterlicher Kultur und Kommunikation - dies läßt sich als
ein zentrales Ergebnis der seit etwa zwanzig Jahren intensiv geführten inter-
disziplinären Debatte über Mündlichkeit und Schriftlichkeit als mediale und
konzeptionelle Phänomene festhaltenf Mündliches Handeln verschränkte
sich im Laufe des Mittelalters zunehmend mit schriftlichem, es wurde nicht
etwa durch Verschriftungsvorgänge allmählich verdrängt.* Selbst der immen-
se Anstieg von Schriftlichkeit im 15. Jahrhundert führte nicht dazu, daß die
mündliche Kommunikation zurückgedrängt wurdet Zwar erweiterte die
Handhabung von Schrift die Möglichkeiten, Denkprozesse und Gedächtnis-
leistungen zu stützen*, und prägte schon allein deshalb Interaktion mit. Die
Schriftsprache mußte, um kommunikativ zu funktionieren, jedoch mit der ge-
sprochenen Sprache kombiniert werden. Schriftlich niedergelegte Ordnungen
wurden den Hofmitgliedern eingeprägt, indem man sie ihnen in regelmäßi-
gen Abständen vorlas.' Briefe gingen auf mündliches Diktat zurück, und der
Empfänger las sie sich selbst laut vor oder ließ sie sich vorlesen. Die eigentli-
che Botschaft wurde oft nicht dem Papier, sondern dem mit einem Kredenz-
schreiben ausgestatteten Boten anvertraut, der sie mündlich übermittelte.
Schriftliche Instruktionen wiederum gaben Gesandten ihre Argumentation im
Gesprächsverlauf vor.
Die Zeitgenossen selbst unterschieden einerseits klar zwischen dem situa-
tiven Gebrauch gesprochener und geschriebener Sprache und beurteilten die
beiden Mitteilungsweisen unter strategischen Aspekten unterschiedlich.
»Reden« und »Schreiben« waren für sie andererseits jedoch Äußerungsfor-
men mit grundsätzlichen Gemeinsamkeiten, vor allem was das Reglement an-
1 Zur Forschung SCHAEFER, Vokalität, S. 5-20. RICHTER, Entdeckung. Die Zusammengehörig-
keit von Mündlichkeit und Schriftlichkeit wird programmatisch im Titel der Reihe
»ScriptOralia« ausgedrückt. Vgl. zum folgenden ferner WENZEL, Hören und Sehen, passim.
ROGGE, Herrschaftsweitergabe, Abschnitt »Schrift und Sprache«, S. 359-362. TEUSCHER, Pri-
vatbriefe.
2 SABLONIER, Schriftlichkeit, S. 79f. WENZEL, Hören und Sehen, S. 16.
3 Vgl. zur »Explosion der Schriftlichkeit« oben A 4.5. Ferner BREMER, Verhältnis, S. 1384-1386,
zur »Verschriftlichung des Lebens«, sowie VON MOOS, Mündlichkeit, S. 313.
4 Nach GlESECKE, Volkssprache, S. 50, Anm. 19, war dies ursprünglich eine Hauptfunktion
von Schriftsprache, die sie entsprechend stärker strukturierte als ihre kommunikative Funk-
tion. Vgl. WENZEL, Hören und Sehen, S. 11. VON MOOS, Mündlichkeit, S. 320, zum medialen
Defizit der Schrift. ASSMANN/ASSMANN, Gestern, über »Medien und soziales Gedächtnis«.
5 Die Hausordnung für die Hofdamen Eleonores von Österreich etwa sollte vierteljährlich vor
den Jungfrauen »offenlich verlesen« werden. Hausordnung, S. 89.
1. Mündlichkeit und Schriftlichkeit
Die enge Verflochtenheit des Mündlichen und des Schriftlichen war ein Cha-
rakteristikum mittelalterlicher Kultur und Kommunikation - dies läßt sich als
ein zentrales Ergebnis der seit etwa zwanzig Jahren intensiv geführten inter-
disziplinären Debatte über Mündlichkeit und Schriftlichkeit als mediale und
konzeptionelle Phänomene festhaltenf Mündliches Handeln verschränkte
sich im Laufe des Mittelalters zunehmend mit schriftlichem, es wurde nicht
etwa durch Verschriftungsvorgänge allmählich verdrängt.* Selbst der immen-
se Anstieg von Schriftlichkeit im 15. Jahrhundert führte nicht dazu, daß die
mündliche Kommunikation zurückgedrängt wurdet Zwar erweiterte die
Handhabung von Schrift die Möglichkeiten, Denkprozesse und Gedächtnis-
leistungen zu stützen*, und prägte schon allein deshalb Interaktion mit. Die
Schriftsprache mußte, um kommunikativ zu funktionieren, jedoch mit der ge-
sprochenen Sprache kombiniert werden. Schriftlich niedergelegte Ordnungen
wurden den Hofmitgliedern eingeprägt, indem man sie ihnen in regelmäßi-
gen Abständen vorlas.' Briefe gingen auf mündliches Diktat zurück, und der
Empfänger las sie sich selbst laut vor oder ließ sie sich vorlesen. Die eigentli-
che Botschaft wurde oft nicht dem Papier, sondern dem mit einem Kredenz-
schreiben ausgestatteten Boten anvertraut, der sie mündlich übermittelte.
Schriftliche Instruktionen wiederum gaben Gesandten ihre Argumentation im
Gesprächsverlauf vor.
Die Zeitgenossen selbst unterschieden einerseits klar zwischen dem situa-
tiven Gebrauch gesprochener und geschriebener Sprache und beurteilten die
beiden Mitteilungsweisen unter strategischen Aspekten unterschiedlich.
»Reden« und »Schreiben« waren für sie andererseits jedoch Äußerungsfor-
men mit grundsätzlichen Gemeinsamkeiten, vor allem was das Reglement an-
1 Zur Forschung SCHAEFER, Vokalität, S. 5-20. RICHTER, Entdeckung. Die Zusammengehörig-
keit von Mündlichkeit und Schriftlichkeit wird programmatisch im Titel der Reihe
»ScriptOralia« ausgedrückt. Vgl. zum folgenden ferner WENZEL, Hören und Sehen, passim.
ROGGE, Herrschaftsweitergabe, Abschnitt »Schrift und Sprache«, S. 359-362. TEUSCHER, Pri-
vatbriefe.
2 SABLONIER, Schriftlichkeit, S. 79f. WENZEL, Hören und Sehen, S. 16.
3 Vgl. zur »Explosion der Schriftlichkeit« oben A 4.5. Ferner BREMER, Verhältnis, S. 1384-1386,
zur »Verschriftlichung des Lebens«, sowie VON MOOS, Mündlichkeit, S. 313.
4 Nach GlESECKE, Volkssprache, S. 50, Anm. 19, war dies ursprünglich eine Hauptfunktion
von Schriftsprache, die sie entsprechend stärker strukturierte als ihre kommunikative Funk-
tion. Vgl. WENZEL, Hören und Sehen, S. 11. VON MOOS, Mündlichkeit, S. 320, zum medialen
Defizit der Schrift. ASSMANN/ASSMANN, Gestern, über »Medien und soziales Gedächtnis«.
5 Die Hausordnung für die Hofdamen Eleonores von Österreich etwa sollte vierteljährlich vor
den Jungfrauen »offenlich verlesen« werden. Hausordnung, S. 89.