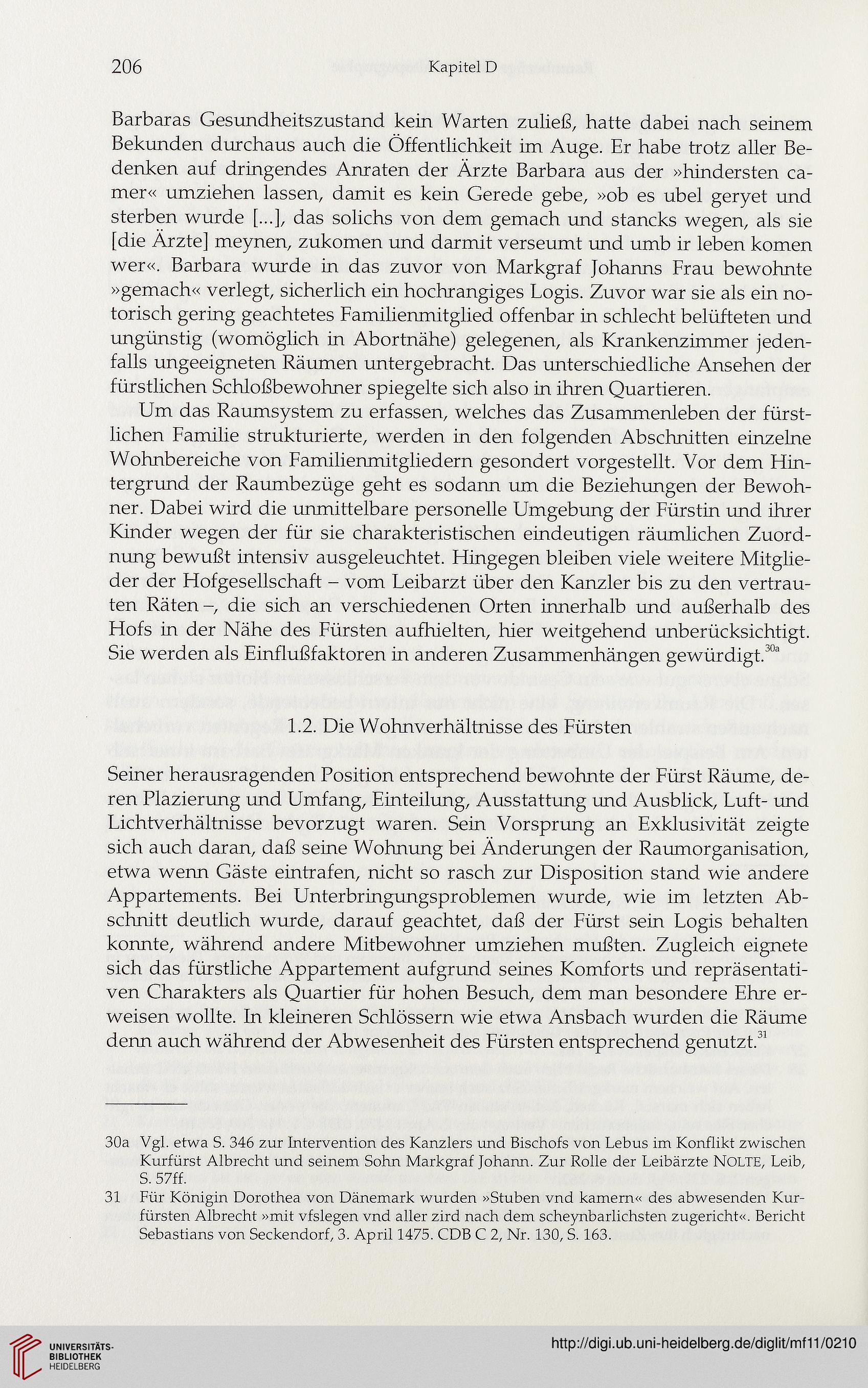206
KapitelD
Barbaras Gesundheitszustand kein Warten zuließ, hatte dabei nach seinem
Bekunden durchaus auch die Öffentlichkeit im Auge. Er habe trotz aller Be-
denken auf dringendes Anraten der Ärzte Barbara aus der »hindersten ca-
mer« umziehen lassen, damit es kein Gerede gebe, »ob es übel geryet und
sterben wurde das solichs von dem gemach und stancks wegen, als sie
[die Ärzte] meynen, zukomen und darmit verseumt und umb ir leben körnen
wer«. Barbara wurde in das zuvor von Markgraf Johanns Frau bewohnte
»gemach« verlegt, sicherlich ein hochrangiges Logis. Zuvor war sie als ein no-
torisch gering geachtetes Familienmitglied offenbar in schlecht belüfteten und
ungünstig (womöglich in Abortnähe) gelegenen, als Krankenzimmer jeden-
falls ungeeigneten Räumen untergebracht. Das unterschiedliche Ansehen der
fürstlichen Schloßbewohner spiegelte sich also in ihren Quartieren.
Um das Raumsystem zu erfassen, welches das Zusammenleben der fürst-
lichen Familie strukturierte, werden in den folgenden Abschnitten einzelne
Wohnbereiche von Familienmitgliedern gesondert vorgestellt. Vor dem Hin-
tergrund der Raumbezüge geht es sodann um die Beziehungen der Bewoh-
ner. Dabei wird die unmittelbare personelle Umgebung der Fürstin und ihrer
Kinder wegen der für sie charakteristischen eindeutigen räumlichen Zuord-
nung bewußt intensiv ausgeleuchtet. Hingegen bleiben viele weitere Mitglie-
der der Hofgesellschaft - vom Leibarzt über den Kanzler bis zu den vertrau-
ten Räten-, die sich an verschiedenen Orten innerhalb und außerhalb des
Hofs in der Nähe des Fürsten aufhielten, hier weitgehend unberücksichtigt.
Sie werden als Einflußfaktoren in anderen Zusammenhängen gewürdigt/"
1.2. Die Wohnverhältnisse des Fürsten
Seiner herausragenden Position entsprechend bewohnte der Fürst Räume, de-
ren Plazierung und Umfang, Einteilung, Ausstattung und Ausblick, Luft- und
Lichtverhältnisse bevorzugt waren. Sein Vorsprung an Exklusivität zeigte
sich auch daran, daß seine Wohnung bei Änderungen der Raumorganisation,
etwa wenn Gäste eintrafen, nicht so rasch zur Disposition stand wie andere
Appartements. Bei Unterbringungsproblemen wurde, wie im letzten Ab-
schnitt deutlich wurde, darauf geachtet, daß der Fürst sein Logis behalten
konnte, während andere Mitbewohner umziehen mußten. Zugleich eignete
sich das fürstliche Appartement aufgrund seines Komforts und repräsentati-
ven Charakters als Quartier für hohen Besuch, dem man besondere Ehre er-
weisen wollte. In kleineren Schlössern wie etwa Ansbach wurden die Räume
denn auch während der Abwesenheit des Fürsten entsprechend genutzt/'
30a Vgl. etwa S. 346 zur Intervention des Kanzlers und Bischofs von Lebus im Konflikt zwischen
Kurfürst Albrecht und seinem Sohn Markgraf Johann. Zur Rolle der Leibärzte NOLTE, Leib,
S. 57ff.
31 Für Königin Dorothea von Dänemark wurden »Stuben vnd kamern« des abwesenden Kur-
fürsten Albrecht »mit vfslegen vnd aller zird nach dem scheynbarlichsten zugericht«. Bericht
Sebastians von Seckendorf, 3. April 1475. CDB C 2, Nr. 130, S. 163.
KapitelD
Barbaras Gesundheitszustand kein Warten zuließ, hatte dabei nach seinem
Bekunden durchaus auch die Öffentlichkeit im Auge. Er habe trotz aller Be-
denken auf dringendes Anraten der Ärzte Barbara aus der »hindersten ca-
mer« umziehen lassen, damit es kein Gerede gebe, »ob es übel geryet und
sterben wurde das solichs von dem gemach und stancks wegen, als sie
[die Ärzte] meynen, zukomen und darmit verseumt und umb ir leben körnen
wer«. Barbara wurde in das zuvor von Markgraf Johanns Frau bewohnte
»gemach« verlegt, sicherlich ein hochrangiges Logis. Zuvor war sie als ein no-
torisch gering geachtetes Familienmitglied offenbar in schlecht belüfteten und
ungünstig (womöglich in Abortnähe) gelegenen, als Krankenzimmer jeden-
falls ungeeigneten Räumen untergebracht. Das unterschiedliche Ansehen der
fürstlichen Schloßbewohner spiegelte sich also in ihren Quartieren.
Um das Raumsystem zu erfassen, welches das Zusammenleben der fürst-
lichen Familie strukturierte, werden in den folgenden Abschnitten einzelne
Wohnbereiche von Familienmitgliedern gesondert vorgestellt. Vor dem Hin-
tergrund der Raumbezüge geht es sodann um die Beziehungen der Bewoh-
ner. Dabei wird die unmittelbare personelle Umgebung der Fürstin und ihrer
Kinder wegen der für sie charakteristischen eindeutigen räumlichen Zuord-
nung bewußt intensiv ausgeleuchtet. Hingegen bleiben viele weitere Mitglie-
der der Hofgesellschaft - vom Leibarzt über den Kanzler bis zu den vertrau-
ten Räten-, die sich an verschiedenen Orten innerhalb und außerhalb des
Hofs in der Nähe des Fürsten aufhielten, hier weitgehend unberücksichtigt.
Sie werden als Einflußfaktoren in anderen Zusammenhängen gewürdigt/"
1.2. Die Wohnverhältnisse des Fürsten
Seiner herausragenden Position entsprechend bewohnte der Fürst Räume, de-
ren Plazierung und Umfang, Einteilung, Ausstattung und Ausblick, Luft- und
Lichtverhältnisse bevorzugt waren. Sein Vorsprung an Exklusivität zeigte
sich auch daran, daß seine Wohnung bei Änderungen der Raumorganisation,
etwa wenn Gäste eintrafen, nicht so rasch zur Disposition stand wie andere
Appartements. Bei Unterbringungsproblemen wurde, wie im letzten Ab-
schnitt deutlich wurde, darauf geachtet, daß der Fürst sein Logis behalten
konnte, während andere Mitbewohner umziehen mußten. Zugleich eignete
sich das fürstliche Appartement aufgrund seines Komforts und repräsentati-
ven Charakters als Quartier für hohen Besuch, dem man besondere Ehre er-
weisen wollte. In kleineren Schlössern wie etwa Ansbach wurden die Räume
denn auch während der Abwesenheit des Fürsten entsprechend genutzt/'
30a Vgl. etwa S. 346 zur Intervention des Kanzlers und Bischofs von Lebus im Konflikt zwischen
Kurfürst Albrecht und seinem Sohn Markgraf Johann. Zur Rolle der Leibärzte NOLTE, Leib,
S. 57ff.
31 Für Königin Dorothea von Dänemark wurden »Stuben vnd kamern« des abwesenden Kur-
fürsten Albrecht »mit vfslegen vnd aller zird nach dem scheynbarlichsten zugericht«. Bericht
Sebastians von Seckendorf, 3. April 1475. CDB C 2, Nr. 130, S. 163.