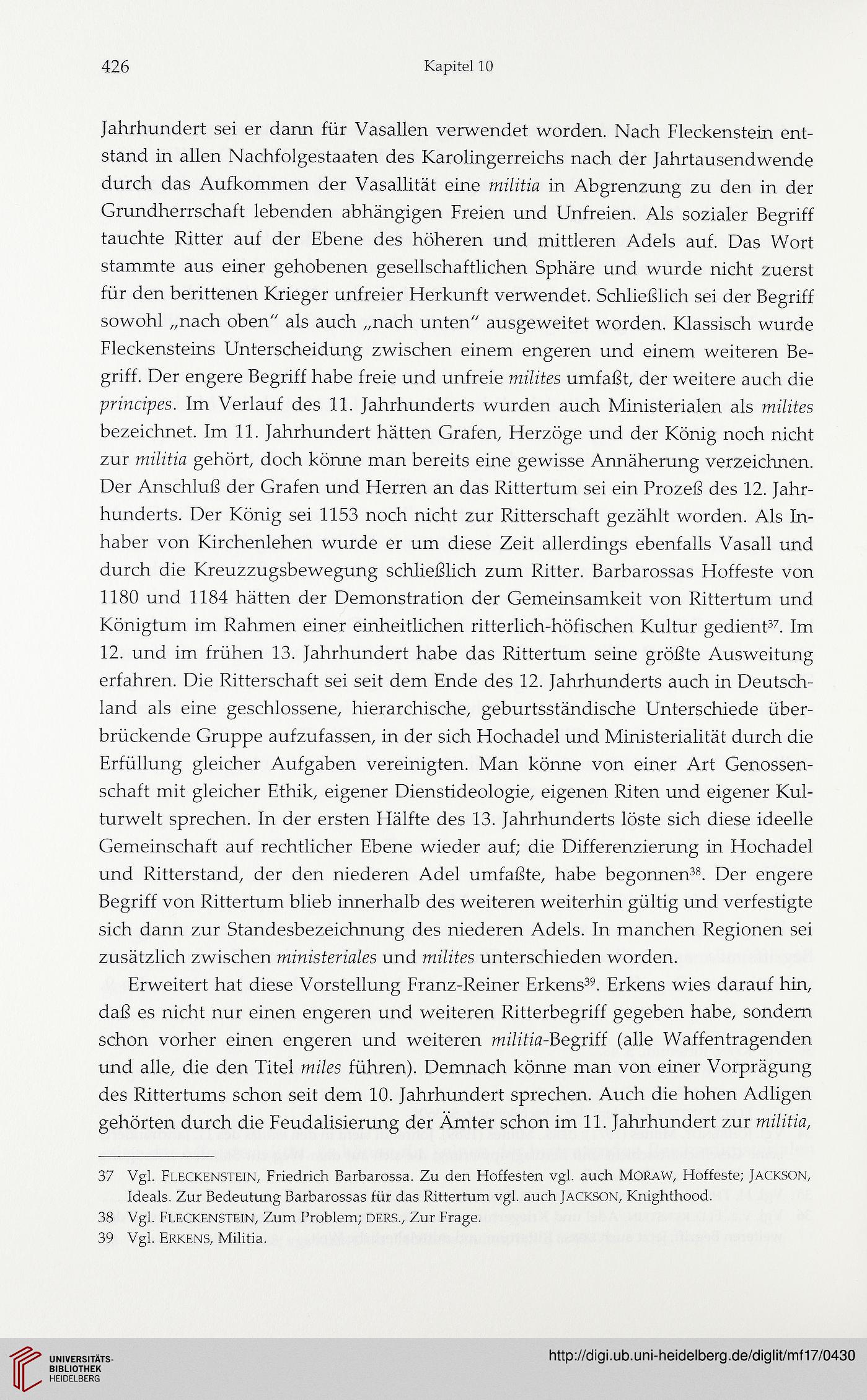426
Kapitel 10
Jahrhundert sei er dann für Vasallen verwendet worden. Nach Fleckenstein ent-
stand in allen Nachfolgestaaten des Karolingerreichs nach der Jahrtausend wende
durch das Aufkommen der Vasallität eine fnzZziza in Abgrenzung zu den in der
Grundherrschaft lebenden abhängigen Freien und Unfreien. Als sozialer Begriff
tauchte Ritter auf der Ebene des höheren und mittleren Adels auf. Das Wort
stammte aus einer gehobenen gesellschaftlichen Sphäre und wurde nicht zuerst
für den berittenen Krieger unfreier Herkunft verwendet. Schließlich sei der Begriff
sowohl „nach oben" als auch „nach unten" ausgeweitet worden. Klassisch wurde
Fleckensteins Unterscheidung zwischen einem engeren und einem weiteren Be-
griff. Der engere Begriff habe freie und unfreie ztzzlzUs umfaßt, der weitere auch die
prz'rzcz'pgs. Im Verlauf des 11. Jahrhunderts wurden auch Ministerialen als pzzlz'Us
bezeichnet. Im 11. Jahrhundert hätten Grafen, Herzoge und der König noch nicht
zur ztzz'üfzü gehört, doch könne man bereits eine gewisse Annäherung verzeichnen.
Der Anschluß der Grafen und Herren an das Rittertum sei ein Prozeß des 12. Jahr-
hunderts. Der König sei 1153 noch nicht zur Ritterschaft gezählt worden. Als In-
haber von Kirchenlehen wurde er um diese Zeit allerdings ebenfalls Vasall und
durch die Kreuzzugsbewegung schließlich zum Ritter. Barbarossas Hoffeste von
1180 und 1184 hätten der Demonstration der Gemeinsamkeit von Rittertum und
Königtum im Rahmen einer einheitlichen ritterlich-höfischen Kultur gedient^. Im
12. und im frühen 13. Jahrhundert habe das Rittertum seine größte Ausweitung
erfahren. Die Ritterschaft sei seit dem Ende des 12. Jahrhunderts auch in Deutsch-
land als eine geschlossene, hierarchische, geburtsständische Unterschiede über-
brückende Gruppe aufzufassen, in der sich Hochadel und Ministerialität durch die
Erfüllung gleicher Aufgaben vereinigten. Man könne von einer Art Genossen-
schaft mit gleicher Ethik, eigener Dienstideologie, eigenen Riten und eigener Kul-
turwelt sprechen. In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts löste sich diese ideelle
Gemeinschaft auf rechtlicher Ebene wieder auf; die Differenzierung in Hochadel
und Ritterstand, der den niederen Adel umfaßte, habe begonnen^. Der engere
Begriff von Rittertum blieb innerhalb des weiteren weiterhin gültig und verfestigte
sich dann zur Standesbezeichnung des niederen Adels. In manchen Regionen sei
zusätzlich zwischen rnzTzzsUrzcigs und mzlz'fgs unterschieden worden.
Erweitert hat diese Vorstellung Franz-Reiner ErkensU Erkens wies darauf hin,
daß es nicht nur einen engeren und weiteren Ritterbegriff gegeben habe, sondern
schon vorher einen engeren und weiteren zrzz'üü'a-Begriff (alle Waffentragenden
und alle, die den Titel zrzzlgs führen). Demnach könne man von einer Vorprägung
des Rittertums schon seit dem 10. Jahrhundert sprechen. Auch die hohen Adligen
gehörten durch die Feudalisierung der Ämter schon im 11. Jahrhundert zur ztzzlzhü,
37 Vgl. FLECKENSTEIN, Friedrich Barbarossa. Zu den Hoffesten vgl. auch MORAW, Hoffeste; JACKSON,
Ideals. Zur Bedeutung Barbarossas für das Rittertum vgl. auch JACKSON, Knighthood.
38 Vgl. FLECKENSTEIN, Zum Problem; DERS., Zur Frage.
39 Vgl. ERKENS, Militia.
Kapitel 10
Jahrhundert sei er dann für Vasallen verwendet worden. Nach Fleckenstein ent-
stand in allen Nachfolgestaaten des Karolingerreichs nach der Jahrtausend wende
durch das Aufkommen der Vasallität eine fnzZziza in Abgrenzung zu den in der
Grundherrschaft lebenden abhängigen Freien und Unfreien. Als sozialer Begriff
tauchte Ritter auf der Ebene des höheren und mittleren Adels auf. Das Wort
stammte aus einer gehobenen gesellschaftlichen Sphäre und wurde nicht zuerst
für den berittenen Krieger unfreier Herkunft verwendet. Schließlich sei der Begriff
sowohl „nach oben" als auch „nach unten" ausgeweitet worden. Klassisch wurde
Fleckensteins Unterscheidung zwischen einem engeren und einem weiteren Be-
griff. Der engere Begriff habe freie und unfreie ztzzlzUs umfaßt, der weitere auch die
prz'rzcz'pgs. Im Verlauf des 11. Jahrhunderts wurden auch Ministerialen als pzzlz'Us
bezeichnet. Im 11. Jahrhundert hätten Grafen, Herzoge und der König noch nicht
zur ztzz'üfzü gehört, doch könne man bereits eine gewisse Annäherung verzeichnen.
Der Anschluß der Grafen und Herren an das Rittertum sei ein Prozeß des 12. Jahr-
hunderts. Der König sei 1153 noch nicht zur Ritterschaft gezählt worden. Als In-
haber von Kirchenlehen wurde er um diese Zeit allerdings ebenfalls Vasall und
durch die Kreuzzugsbewegung schließlich zum Ritter. Barbarossas Hoffeste von
1180 und 1184 hätten der Demonstration der Gemeinsamkeit von Rittertum und
Königtum im Rahmen einer einheitlichen ritterlich-höfischen Kultur gedient^. Im
12. und im frühen 13. Jahrhundert habe das Rittertum seine größte Ausweitung
erfahren. Die Ritterschaft sei seit dem Ende des 12. Jahrhunderts auch in Deutsch-
land als eine geschlossene, hierarchische, geburtsständische Unterschiede über-
brückende Gruppe aufzufassen, in der sich Hochadel und Ministerialität durch die
Erfüllung gleicher Aufgaben vereinigten. Man könne von einer Art Genossen-
schaft mit gleicher Ethik, eigener Dienstideologie, eigenen Riten und eigener Kul-
turwelt sprechen. In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts löste sich diese ideelle
Gemeinschaft auf rechtlicher Ebene wieder auf; die Differenzierung in Hochadel
und Ritterstand, der den niederen Adel umfaßte, habe begonnen^. Der engere
Begriff von Rittertum blieb innerhalb des weiteren weiterhin gültig und verfestigte
sich dann zur Standesbezeichnung des niederen Adels. In manchen Regionen sei
zusätzlich zwischen rnzTzzsUrzcigs und mzlz'fgs unterschieden worden.
Erweitert hat diese Vorstellung Franz-Reiner ErkensU Erkens wies darauf hin,
daß es nicht nur einen engeren und weiteren Ritterbegriff gegeben habe, sondern
schon vorher einen engeren und weiteren zrzz'üü'a-Begriff (alle Waffentragenden
und alle, die den Titel zrzzlgs führen). Demnach könne man von einer Vorprägung
des Rittertums schon seit dem 10. Jahrhundert sprechen. Auch die hohen Adligen
gehörten durch die Feudalisierung der Ämter schon im 11. Jahrhundert zur ztzzlzhü,
37 Vgl. FLECKENSTEIN, Friedrich Barbarossa. Zu den Hoffesten vgl. auch MORAW, Hoffeste; JACKSON,
Ideals. Zur Bedeutung Barbarossas für das Rittertum vgl. auch JACKSON, Knighthood.
38 Vgl. FLECKENSTEIN, Zum Problem; DERS., Zur Frage.
39 Vgl. ERKENS, Militia.