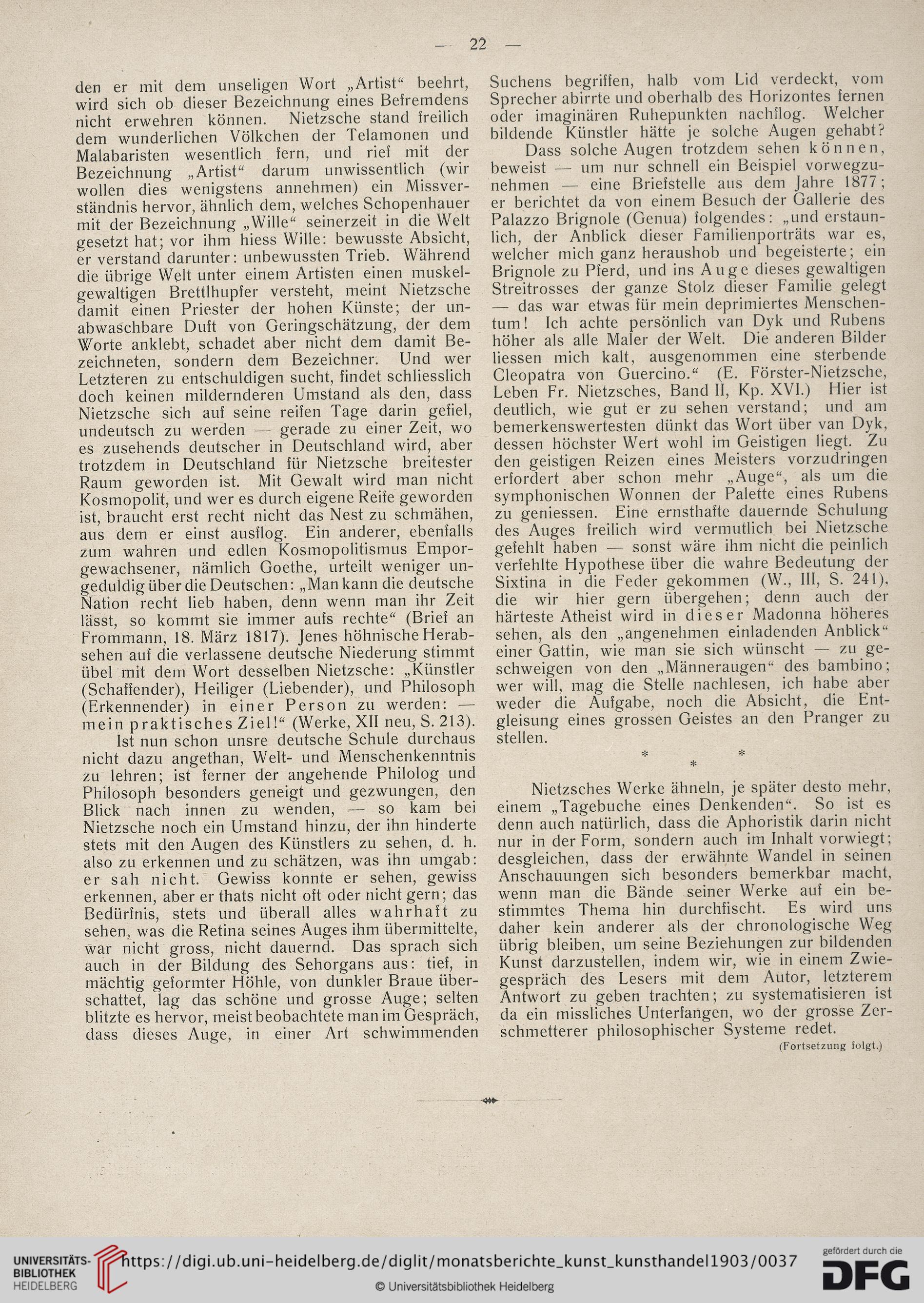22
den er mit dem unseligen Wort „Artist“ beehrt,
wird sich ob dieser Bezeichnung eines Befremdens
nicht erwehren können. Nietzsche stand freilich
dem wunderlichen Völkchen der Telamonen und
Malabaristen wesentlich fern, und rief mit der
Bezeichnung „Artist“ darum unwissentlich (wir
wollen dies wenigstens annehmen) ein Missver-
ständnis hervor, ähnlich dem, welches Schopenhauer
mit der Bezeichnung „Wille“ seinerzeit in die Welt
gesetzt hat; vor ihm hiess Wille: bewusste Absicht,
er verstand darunter: unbewussten Trieb. Während
die übrige Welt unter einem Artisten einen muskel-
gewaltigen Brettlhupfer versteht, meint Nietzsche
damit einen Priester der hohen Künste; der un-
abwaschbare Duft von Geringschätzung, der dem
Worte anklebt, schadet aber nicht dem damit Be-
zeichneten, sondern dem Bezeichner. Und wer
Letzteren zu entschuldigen sucht, findet schliesslich
doch keinen mildernderen Umstand als den, dass
Nietzsche sich auf seine reifen Tage darin gefiel,
undeutsch zu werden — gerade zu einer Zeit, wo
es zusehends deutscher in Deutschland wird, aber
trotzdem in Deutschland für Nietzsche breitester
Raum geworden ist. Mit Gewalt wird man nicht
Kosmopolit, und wer es durch eigene Reife geworden
ist, braucht erst recht nicht das Nest zu schmähen,
aus dem er einst ausflog. Ein anderer, ebenfalls
zum wahren und edlen Kosmopolitismus Empor-
gewachsener, nämlich Goethe, urteilt weniger un-
geduldig über die Deutschen: „Man kann die deutsche
Nation recht lieb haben, denn wenn man ihr Zeit
lässt, so kommt sie immer aufs rechte“ (Brief an
Frommann, 18. März 1817). Jenes höhnische Herab-
sehen auf die verlassene deutsche Niederung stimmt
übel mit dem Wort desselben Nietzsche: „Künstler
(Schaffender), Heiliger (Liebender), und Philosoph
(Erkennender) in einer Person zu werden: —
mein praktisches Ziel!“ (Werke, XII neu, S. 213).
Ist nun schon unsre deutsche Schule durchaus
nicht dazu angethan, Welt- und Menschenkenntnis
zu lehren; ist ferner der angehende Philolog und
Philosoph besonders geneigt und gezwungen, den
Blick nach innen zu wenden, — so kam bei
Nietzsche noch ein Umstand hinzu, der ihn hinderte
stets mit den Augen des Künstlers zu sehen, d. h.
also zu erkennen und zu schätzen, was ihn umgab:
er sah nicht. Gewiss konnte er sehen, gewiss
erkennen, aber er thats nicht oft oder nicht gern; das
Bedürfnis, stets und überall alles wahrhaft zu
sehen, was die Retina seines Auges ihm übermittelte,
war nicht gross, nicht dauernd. Das sprach sich
auch in der Bildung des Sehorgans aus: tief, in
mächtig geformter Höhle, von dunkler Braue über-
schattet, lag das schöne und grosse Auge; selten
blitzte es hervor, meist beobachtete man im Gespräch,
dass dieses Auge, in einer Art schwimmenden
Suchens begriffen, halb vom Lid verdeckt, vom
Sprecher abirrte und oberhalb des Horizontes fernen
oder imaginären Ruhepunkten nachflog. Welcher
bildende Künstler hätte je solche Augen gehabt?
Dass solche Augen trotzdem sehen können,
beweist — um nur schnell ein Beispiel vorwegzu-
nehmen — eine Briefstelle aus dem Jahre 1877;
er berichtet da von einem Besuch der Gallerie des
Palazzo Brignole (Genua) folgendes: „und erstaun-
lich, der Anblick dieser Familienporträts war es,
welcher mich ganz heraushob und begeisterte; ein
Brignole zu Pferd, und ins Auge dieses gewaltigen
Streitrosses der ganze Stolz dieser Familie gelegt
— das war etwas für mein deprimiertes Menschen-
tum! Ich achte persönlich van Dyk und Rubens
höher als alle Maler der Welt. Die anderen Bilder
liessen mich kalt, ausgenommen eine sterbende
Cleopatra von Guercino.“ (E. Förster-Nietzsche,
Leben Fr. Nietzsches, Band II, Kp. XVI.) Hier ist
deutlich, wie gut er zu sehen verstand; und am
bemerkenswertesten dünkt das Wort über van Dyk,
dessen höchster Wert wohl im Geistigen liegt. Zu
den geistigen Reizen eines Meisters vorzudringen
erfordert aber schon mehr „Auge“, als um die
symphonischen Wonnen der Palette eines Rubens
zu geniessen. Eine ernsthafte dauernde Schulung
des Auges freilich wird vermutlich bei Nietzsche
gefehlt haben — sonst wäre ihm nicht die peinlich
verfehlte Hypothese über die wahre Bedeutung der
Sixtina in die Feder gekommen (W., III, S. 241),
die wir hier gern übergehen; denn auch der
härteste Atheist wird in dieser Madonna höheres
sehen, als den „angenehmen einladenden Anblick“
einer Gattin, wie man sie sich wünscht — zu ge-
schweigen von den „Männeraugen“ des bambino;
wer will, mag die Stelle nachlesen, ich habe aber
weder die Aufgabe, noch die Absicht, die Ent-
gleisung eines grossen Geistes an den Pranger zu
stellen.
❖ *
*
Nietzsches Werke ähneln, je später desto mehr,
einem „Tagebuche eines Denkenden“. So ist es
denn auch natürlich, dass die Aphoristik darin nicht
nur in der Form, sondern auch im Inhalt vorwiegt;
desgleichen, dass der erwähnte Wandel in seinen
Anschauungen sich besonders bemerkbar macht,
wenn man die Bände seiner Werke auf ein be-
stimmtes Thema hin durchfischt. Es wird uns
daher kein anderer als der chronologische Weg
übrig bleiben, um seine Beziehungen zur bildenden
Kunst darzustellen, indem wir, wie in einem Zwie-
gespräch des Lesers mit dem Autor, letzterem
Antwort zu geben trachten; zu systematisieren ist
da ein missliches Unterfangen, wo der grosse Zer-
schmetterer philosophischer Systeme redet.
(Fortsetzung folgt.)
den er mit dem unseligen Wort „Artist“ beehrt,
wird sich ob dieser Bezeichnung eines Befremdens
nicht erwehren können. Nietzsche stand freilich
dem wunderlichen Völkchen der Telamonen und
Malabaristen wesentlich fern, und rief mit der
Bezeichnung „Artist“ darum unwissentlich (wir
wollen dies wenigstens annehmen) ein Missver-
ständnis hervor, ähnlich dem, welches Schopenhauer
mit der Bezeichnung „Wille“ seinerzeit in die Welt
gesetzt hat; vor ihm hiess Wille: bewusste Absicht,
er verstand darunter: unbewussten Trieb. Während
die übrige Welt unter einem Artisten einen muskel-
gewaltigen Brettlhupfer versteht, meint Nietzsche
damit einen Priester der hohen Künste; der un-
abwaschbare Duft von Geringschätzung, der dem
Worte anklebt, schadet aber nicht dem damit Be-
zeichneten, sondern dem Bezeichner. Und wer
Letzteren zu entschuldigen sucht, findet schliesslich
doch keinen mildernderen Umstand als den, dass
Nietzsche sich auf seine reifen Tage darin gefiel,
undeutsch zu werden — gerade zu einer Zeit, wo
es zusehends deutscher in Deutschland wird, aber
trotzdem in Deutschland für Nietzsche breitester
Raum geworden ist. Mit Gewalt wird man nicht
Kosmopolit, und wer es durch eigene Reife geworden
ist, braucht erst recht nicht das Nest zu schmähen,
aus dem er einst ausflog. Ein anderer, ebenfalls
zum wahren und edlen Kosmopolitismus Empor-
gewachsener, nämlich Goethe, urteilt weniger un-
geduldig über die Deutschen: „Man kann die deutsche
Nation recht lieb haben, denn wenn man ihr Zeit
lässt, so kommt sie immer aufs rechte“ (Brief an
Frommann, 18. März 1817). Jenes höhnische Herab-
sehen auf die verlassene deutsche Niederung stimmt
übel mit dem Wort desselben Nietzsche: „Künstler
(Schaffender), Heiliger (Liebender), und Philosoph
(Erkennender) in einer Person zu werden: —
mein praktisches Ziel!“ (Werke, XII neu, S. 213).
Ist nun schon unsre deutsche Schule durchaus
nicht dazu angethan, Welt- und Menschenkenntnis
zu lehren; ist ferner der angehende Philolog und
Philosoph besonders geneigt und gezwungen, den
Blick nach innen zu wenden, — so kam bei
Nietzsche noch ein Umstand hinzu, der ihn hinderte
stets mit den Augen des Künstlers zu sehen, d. h.
also zu erkennen und zu schätzen, was ihn umgab:
er sah nicht. Gewiss konnte er sehen, gewiss
erkennen, aber er thats nicht oft oder nicht gern; das
Bedürfnis, stets und überall alles wahrhaft zu
sehen, was die Retina seines Auges ihm übermittelte,
war nicht gross, nicht dauernd. Das sprach sich
auch in der Bildung des Sehorgans aus: tief, in
mächtig geformter Höhle, von dunkler Braue über-
schattet, lag das schöne und grosse Auge; selten
blitzte es hervor, meist beobachtete man im Gespräch,
dass dieses Auge, in einer Art schwimmenden
Suchens begriffen, halb vom Lid verdeckt, vom
Sprecher abirrte und oberhalb des Horizontes fernen
oder imaginären Ruhepunkten nachflog. Welcher
bildende Künstler hätte je solche Augen gehabt?
Dass solche Augen trotzdem sehen können,
beweist — um nur schnell ein Beispiel vorwegzu-
nehmen — eine Briefstelle aus dem Jahre 1877;
er berichtet da von einem Besuch der Gallerie des
Palazzo Brignole (Genua) folgendes: „und erstaun-
lich, der Anblick dieser Familienporträts war es,
welcher mich ganz heraushob und begeisterte; ein
Brignole zu Pferd, und ins Auge dieses gewaltigen
Streitrosses der ganze Stolz dieser Familie gelegt
— das war etwas für mein deprimiertes Menschen-
tum! Ich achte persönlich van Dyk und Rubens
höher als alle Maler der Welt. Die anderen Bilder
liessen mich kalt, ausgenommen eine sterbende
Cleopatra von Guercino.“ (E. Förster-Nietzsche,
Leben Fr. Nietzsches, Band II, Kp. XVI.) Hier ist
deutlich, wie gut er zu sehen verstand; und am
bemerkenswertesten dünkt das Wort über van Dyk,
dessen höchster Wert wohl im Geistigen liegt. Zu
den geistigen Reizen eines Meisters vorzudringen
erfordert aber schon mehr „Auge“, als um die
symphonischen Wonnen der Palette eines Rubens
zu geniessen. Eine ernsthafte dauernde Schulung
des Auges freilich wird vermutlich bei Nietzsche
gefehlt haben — sonst wäre ihm nicht die peinlich
verfehlte Hypothese über die wahre Bedeutung der
Sixtina in die Feder gekommen (W., III, S. 241),
die wir hier gern übergehen; denn auch der
härteste Atheist wird in dieser Madonna höheres
sehen, als den „angenehmen einladenden Anblick“
einer Gattin, wie man sie sich wünscht — zu ge-
schweigen von den „Männeraugen“ des bambino;
wer will, mag die Stelle nachlesen, ich habe aber
weder die Aufgabe, noch die Absicht, die Ent-
gleisung eines grossen Geistes an den Pranger zu
stellen.
❖ *
*
Nietzsches Werke ähneln, je später desto mehr,
einem „Tagebuche eines Denkenden“. So ist es
denn auch natürlich, dass die Aphoristik darin nicht
nur in der Form, sondern auch im Inhalt vorwiegt;
desgleichen, dass der erwähnte Wandel in seinen
Anschauungen sich besonders bemerkbar macht,
wenn man die Bände seiner Werke auf ein be-
stimmtes Thema hin durchfischt. Es wird uns
daher kein anderer als der chronologische Weg
übrig bleiben, um seine Beziehungen zur bildenden
Kunst darzustellen, indem wir, wie in einem Zwie-
gespräch des Lesers mit dem Autor, letzterem
Antwort zu geben trachten; zu systematisieren ist
da ein missliches Unterfangen, wo der grosse Zer-
schmetterer philosophischer Systeme redet.
(Fortsetzung folgt.)