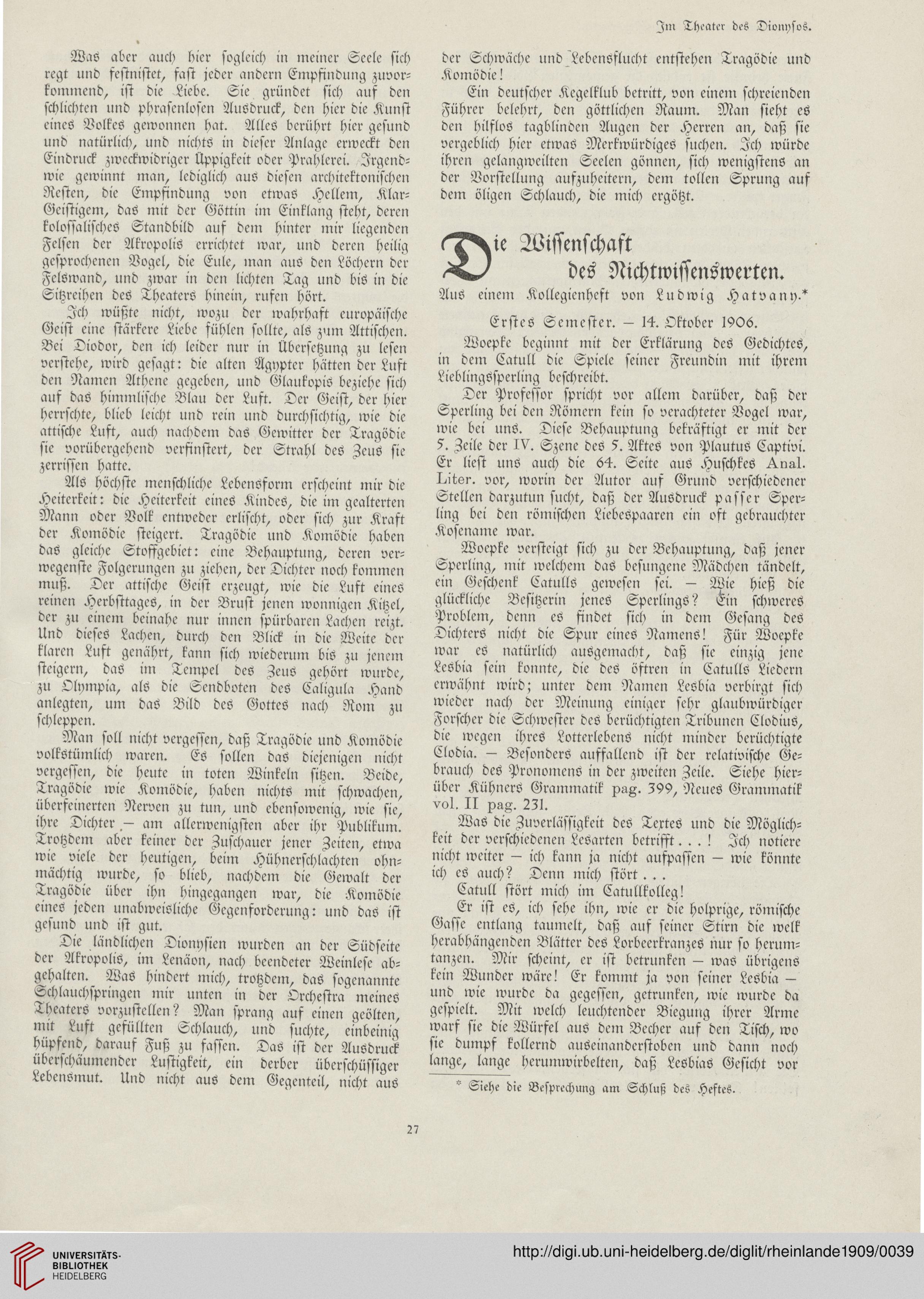Was aber auch hier sogleich in meiner Seele sich
regt und sestniftet, sast jcder andern Empfindung zuvor-
kommend, ift die Liebe. Sie gründet sich auf den
schlichten und phrasenlosen AuSdruck, den hier die Kunft
eines Volkes gewonnen hat. AlleS berührt hier gesund
und natürlich, und nichtS in dicser Anlagc erweckt den
Eindruck zweckwidriger Üppigkeit oder Prahlerei. Jrgend-
wie gewinnt man, lediglich aus diesen architektonischen
Reften, die Empfindung von etwas Hellem, Klar-
Geiftigem, das mit der Göttin im Einklang fteht, deren
kolossalisches Standbild auf dem hinter mir liegenden
Felsen der Akropolis errichtet war, und deren heilig
gesprochenen Vogel, die Eule, man auö den Löchern der
Felswand, und zwar in den lichten Tag und bis in die
Sitzreihen des Theaters hinein, rusen hört.
Jch wüßte nicht, wozu der wahrhast europäische
Geist eine ftärkere Liebe sühlen sollte, als zum Attischen.
Bei Diodor, den ich leidcr nur in Übersetzung zu lesen
verftehe, wird gesagt: die alten Agypter hätten der Luft
den Namen Athene gegeben, und Glaukopis beziehe sich
aus das himmlische Blau der Luft. Der Geist, der hier
herrschte, blieb leicht und rein und durchsichtig, wie die
attische Luft, auch nachdem das Gewitter der Tragödie
sie vorübergehend verfinstert, der Strahl des Ieus sie
zerriffen hatte.
Alö höchfte menschliche Lebenssorm erscheint mir die
Heiterkeit: die Heiterkeit eineö Kindes, die im gealterten
Mann oder Volk entweder erlischt, oder sich zur Kraft
der Komödie fteigert. Tragödie und Komödie haben
das gleiche Stoffgebiet: eine Behauptung, deren ver-
wegenste Folgerungen zu ziehen, der Dichter noch kommen
muß. Der attische Geift erzeugt, wie die Luft eineS
reinen Herbsttages, in der Brust jenen wonnigen Kitzel,
der zu einem beinahe nur innen spürbaren Lachen reizt.
ünd dicseö Lachen, durch dcn Blick in dic Wcitc dcr
klaren Luft genährt, kann sich wiederum bis zu jenem
steigern, das im Tempel des Zeus gehört wurde,
zu Olympia, als dic Sendboten des Caligula Hand
anlegten, um das Bild des Gottes nach Rom zu
schleppen.
Man soll nicht vergessen, daß Tragödie und Komödie
volkstümlich waren. Eö sollen das dicjenigen nicht
vergessen, die heute in toten Winkeln sitzen. Beide,
Tragödie wie Komödie, haben nichtö mit schwachen,
überfcinerten Nerven zu tun, und ebensowenig, wie sie,
ihre Dichteram allerwenigsten aber ihr Publikum.
Trotzdem aber keiner der Iuschauer jener Ieiten, etwa
wie viele der heutigen, beim Hühnerschlachten ohn-
mächtig wurde, so blieb, nachdem die Gewalt der
Tragödie über ihn hingegangen war, die Komödie
eines jeden unabweisliche Gegensorderung: und das ift
gesund und ist gut.
Die ländlichen Dionysien wurden an der Südseite
der Akropolis, im Lenäon, nach beendeter Weinlese ab-
gehalten. Waö hindert mich, trotzdem, das sogenannte
Schlauchspringen mir unten in der Orchestra meines
TheaterS vorzustellen? Man sprang aus einen geölten,
mit Luft gesülltcn Schlauch, mid suchte, einbeinig
hüpfcnd, daraus Fuß zu fasscn. Das ist der AuSdruck
übcrschäumendcr Lustigkeit, cin derber übcrschüssiger
Lebensmut. Und nicht aus dem Gegenteil, nicht aus
Jm Thcater des Dionysos.
der Schwäche und Lebensflucht entftehen Tragödie und
Komödie!
Ein deutscher Kegelklub betritt, von einem schreienden
Führer belehrt, den göttlichen Raum. Man sieht eö
den hilflos tagblinden Augen der Herren an, daß sie
vergeblich hier etwaö Merkwürdiges suchen. Jch würde
ihren gelangweilten Seelen gönnen, sich wenigstenS an
der Vorstellung aufzuheitern, dem tollen Sprung aus
dem öligen Schlauch, die mich ergötzt.
ie Wijsenschaft
des Nichtwistenswerten.
Aus einem Kollegienheft von Ludwig Hatvany.*
Erstes Scmester. — 14. Oktobcr I9O6.
Woepke beginnt mit der Erklärung des Gedichtcs,
in dem Catull die Spiele seiner Freundin mit ihrem
Lieblingssperling beschreibt.
Der Profcssor spricht vor allcni darüber, daß der
Sperling bei den Römern kein so verachteter Vogel war,
wie bei uns. Diese Behauptung bekräftigt er mit der
5. Ieile der IO. Szene des 5. Aktes von Plautus Captivi.
Er lieft uns auch die 64. Seite aus Huschkes ^iml.
Ditor. vor, worin der Autor aus Grund verschiedener
Stellen darzutun sucht, daß der Ausdruck passcr Sper-
ling bei den römischen Liebespaaren ein ost gebrauchter
Koscname war.
Woepke versteigt sich zu der Behauptung, daß jener
Sperling, nnt welchem das besungene Mädchen tändelt,
ein Geschenk Catullö gewesen sei. — Wie hieß die
glückliche Besitzerin jenes Sperlings? Än schweres
Problem, denn es findet sich in dem Gesang deS
Dichtcrs nicht dic Spur cines Namens! Für Woepke
war eö natürlich ausgemacht, daß sie einzig jene
Lesbia sein konnte, die des öftren in Catulls Liedern
erwähnt wird; untcr dcm Namc» Lesbia vcrbirgt sich
wieder nach der Meinung einiger sehr glaubwürdiger
Forscher die Schwefter des berüchtigten Tribunen Clodius,
die wegen ihres Lotterlebenö nicht minder berüchtigte
Clodia. — Besonders ausfallend ist der relativische Ge-
brauch des Pronomens in der zweiten Ieile. Siehe hier-
über Kühncrs Grammatik paZ. Z99, Neues Granimatik
vol. II png. 2Zl.
Was die Iuverlässigkeit des Textes und die Möglich-
keit der verschiedenen Lesarten betrifft. . . ! Jch notiere
nicht weiter — ich kann ja nicht aufpassen — wie könnte
ich es auch? Denn mich stört. ..
Catull stört mich im Catullkolleg!
Er ist es, ich sehe ihn, wie er die holprige, römische
Gasse entlang taumelt, daß auf seiner Stirn die welk
herabhängenden Blätter dcs Lorbecrkranzes nur so hcrum-
tanzen. Mir scheint, er ist betrunken — was übrigens
kein Wundcr wärc! Er kommt ja yon sciner Leöbia —
und wie wurde da gegessen, getrunken, wie wurde da
gespielt. Mit welch leuchtender Biegung ihrer Arme
warf sie die Würfel aus dem Becher auf den Tisch, wo
sie dumpf kollernd auseinanderstoben und dann noch
lange, lange herumwirbelten, daß Lesbias Gesicht vor
" Siehe die Besprechung am Schluß des Heftes.
27
regt und sestniftet, sast jcder andern Empfindung zuvor-
kommend, ift die Liebe. Sie gründet sich auf den
schlichten und phrasenlosen AuSdruck, den hier die Kunft
eines Volkes gewonnen hat. AlleS berührt hier gesund
und natürlich, und nichtS in dicser Anlagc erweckt den
Eindruck zweckwidriger Üppigkeit oder Prahlerei. Jrgend-
wie gewinnt man, lediglich aus diesen architektonischen
Reften, die Empfindung von etwas Hellem, Klar-
Geiftigem, das mit der Göttin im Einklang fteht, deren
kolossalisches Standbild auf dem hinter mir liegenden
Felsen der Akropolis errichtet war, und deren heilig
gesprochenen Vogel, die Eule, man auö den Löchern der
Felswand, und zwar in den lichten Tag und bis in die
Sitzreihen des Theaters hinein, rusen hört.
Jch wüßte nicht, wozu der wahrhast europäische
Geist eine ftärkere Liebe sühlen sollte, als zum Attischen.
Bei Diodor, den ich leidcr nur in Übersetzung zu lesen
verftehe, wird gesagt: die alten Agypter hätten der Luft
den Namen Athene gegeben, und Glaukopis beziehe sich
aus das himmlische Blau der Luft. Der Geist, der hier
herrschte, blieb leicht und rein und durchsichtig, wie die
attische Luft, auch nachdem das Gewitter der Tragödie
sie vorübergehend verfinstert, der Strahl des Ieus sie
zerriffen hatte.
Alö höchfte menschliche Lebenssorm erscheint mir die
Heiterkeit: die Heiterkeit eineö Kindes, die im gealterten
Mann oder Volk entweder erlischt, oder sich zur Kraft
der Komödie fteigert. Tragödie und Komödie haben
das gleiche Stoffgebiet: eine Behauptung, deren ver-
wegenste Folgerungen zu ziehen, der Dichter noch kommen
muß. Der attische Geift erzeugt, wie die Luft eineS
reinen Herbsttages, in der Brust jenen wonnigen Kitzel,
der zu einem beinahe nur innen spürbaren Lachen reizt.
ünd dicseö Lachen, durch dcn Blick in dic Wcitc dcr
klaren Luft genährt, kann sich wiederum bis zu jenem
steigern, das im Tempel des Zeus gehört wurde,
zu Olympia, als dic Sendboten des Caligula Hand
anlegten, um das Bild des Gottes nach Rom zu
schleppen.
Man soll nicht vergessen, daß Tragödie und Komödie
volkstümlich waren. Eö sollen das dicjenigen nicht
vergessen, die heute in toten Winkeln sitzen. Beide,
Tragödie wie Komödie, haben nichtö mit schwachen,
überfcinerten Nerven zu tun, und ebensowenig, wie sie,
ihre Dichteram allerwenigsten aber ihr Publikum.
Trotzdem aber keiner der Iuschauer jener Ieiten, etwa
wie viele der heutigen, beim Hühnerschlachten ohn-
mächtig wurde, so blieb, nachdem die Gewalt der
Tragödie über ihn hingegangen war, die Komödie
eines jeden unabweisliche Gegensorderung: und das ift
gesund und ist gut.
Die ländlichen Dionysien wurden an der Südseite
der Akropolis, im Lenäon, nach beendeter Weinlese ab-
gehalten. Waö hindert mich, trotzdem, das sogenannte
Schlauchspringen mir unten in der Orchestra meines
TheaterS vorzustellen? Man sprang aus einen geölten,
mit Luft gesülltcn Schlauch, mid suchte, einbeinig
hüpfcnd, daraus Fuß zu fasscn. Das ist der AuSdruck
übcrschäumendcr Lustigkeit, cin derber übcrschüssiger
Lebensmut. Und nicht aus dem Gegenteil, nicht aus
Jm Thcater des Dionysos.
der Schwäche und Lebensflucht entftehen Tragödie und
Komödie!
Ein deutscher Kegelklub betritt, von einem schreienden
Führer belehrt, den göttlichen Raum. Man sieht eö
den hilflos tagblinden Augen der Herren an, daß sie
vergeblich hier etwaö Merkwürdiges suchen. Jch würde
ihren gelangweilten Seelen gönnen, sich wenigstenS an
der Vorstellung aufzuheitern, dem tollen Sprung aus
dem öligen Schlauch, die mich ergötzt.
ie Wijsenschaft
des Nichtwistenswerten.
Aus einem Kollegienheft von Ludwig Hatvany.*
Erstes Scmester. — 14. Oktobcr I9O6.
Woepke beginnt mit der Erklärung des Gedichtcs,
in dem Catull die Spiele seiner Freundin mit ihrem
Lieblingssperling beschreibt.
Der Profcssor spricht vor allcni darüber, daß der
Sperling bei den Römern kein so verachteter Vogel war,
wie bei uns. Diese Behauptung bekräftigt er mit der
5. Ieile der IO. Szene des 5. Aktes von Plautus Captivi.
Er lieft uns auch die 64. Seite aus Huschkes ^iml.
Ditor. vor, worin der Autor aus Grund verschiedener
Stellen darzutun sucht, daß der Ausdruck passcr Sper-
ling bei den römischen Liebespaaren ein ost gebrauchter
Koscname war.
Woepke versteigt sich zu der Behauptung, daß jener
Sperling, nnt welchem das besungene Mädchen tändelt,
ein Geschenk Catullö gewesen sei. — Wie hieß die
glückliche Besitzerin jenes Sperlings? Än schweres
Problem, denn es findet sich in dem Gesang deS
Dichtcrs nicht dic Spur cines Namens! Für Woepke
war eö natürlich ausgemacht, daß sie einzig jene
Lesbia sein konnte, die des öftren in Catulls Liedern
erwähnt wird; untcr dcm Namc» Lesbia vcrbirgt sich
wieder nach der Meinung einiger sehr glaubwürdiger
Forscher die Schwefter des berüchtigten Tribunen Clodius,
die wegen ihres Lotterlebenö nicht minder berüchtigte
Clodia. — Besonders ausfallend ist der relativische Ge-
brauch des Pronomens in der zweiten Ieile. Siehe hier-
über Kühncrs Grammatik paZ. Z99, Neues Granimatik
vol. II png. 2Zl.
Was die Iuverlässigkeit des Textes und die Möglich-
keit der verschiedenen Lesarten betrifft. . . ! Jch notiere
nicht weiter — ich kann ja nicht aufpassen — wie könnte
ich es auch? Denn mich stört. ..
Catull stört mich im Catullkolleg!
Er ist es, ich sehe ihn, wie er die holprige, römische
Gasse entlang taumelt, daß auf seiner Stirn die welk
herabhängenden Blätter dcs Lorbecrkranzes nur so hcrum-
tanzen. Mir scheint, er ist betrunken — was übrigens
kein Wundcr wärc! Er kommt ja yon sciner Leöbia —
und wie wurde da gegessen, getrunken, wie wurde da
gespielt. Mit welch leuchtender Biegung ihrer Arme
warf sie die Würfel aus dem Becher auf den Tisch, wo
sie dumpf kollernd auseinanderstoben und dann noch
lange, lange herumwirbelten, daß Lesbias Gesicht vor
" Siehe die Besprechung am Schluß des Heftes.
27