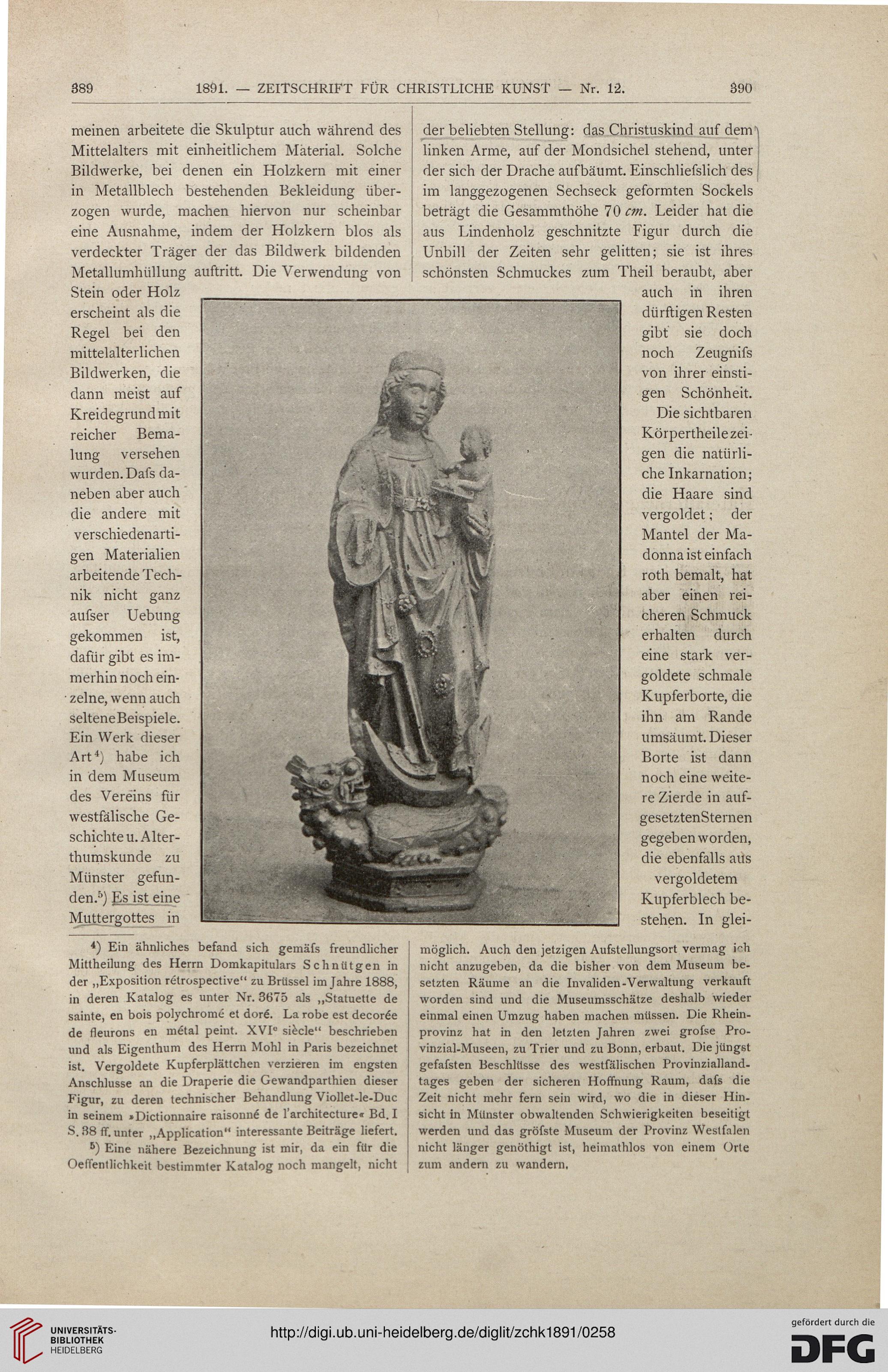1891.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.
390
meinen arbeitete die Skulptur auch während des
Mittelalters mit einheitlichem Material. Solche
Bildwerke, bei denen ein Holzkern mit einer
in Metallblech bestehenden Bekleidung über-
zogen wurde, machen hiervon nur scheinbar
eine Ausnahme, indem der Holzkern blos als
verdeckter Träger der das Bildwerk bildenden
Metallumhüllung auftritt. Die Verwendung von
Stein oder Holz
erscheint als die
Regel bei den
mittelalterlichen
Bildwerken, die
dann meist auf
Kreidegrund mit
reicher Bema-
lung versehen
wurden. Dafs da-
neben aber auch
die andere mit
verschiedenarti-
gen Materialien
arbeitende Tech-
nik nicht ganz
aufser Uebung
gekommen ist,
dafür gibt es im-
merhin noch ein-
■ zelne, wenn auch
selteneBeispiele.
Ein Werk dieser
Art4) habe ich
in dem Museum
des Vereins für
westfälische Ge-
schichte u.Alter-
thumskunde zu
Münster gefun-
den.5) Es ist eine
Muttergottes in
*) Ein ähnliches befand sich gemäfs freundlicher
Mittheilung des Herrn Domkapitulars Schnütgen in
der „Exposition relrospective" zu Brüssel im Jahre 1888,
in deren Katalog es unter Nr. 3675 als „Statuette de
sainte, en bois polychrome et dore\ La robe est decore'e
de fleurons en metal peint. XVI" siecle" beschrieben
und als Eigenlhum des Herrn Mohl in Paris bezeichnet
ist. Vergoldete Kupferplättchen verzieren im engsten
Anschlüsse an die Draperie die Gewandparthien dieser
Figur, zu deren technischer Behandlung Viollet-le-Duc
in seinem »Dictionnaire raisonne de l'architecture« Bd. I
S. 38 ff. unter „Application" interessante Beiträge liefert.
5) Eine nähere Bezeichnung ist mir, da ein für die
Öffentlichkeit bestimmter Katalog noch mangelt, nicht
der beliebten Stellung: das Christuskind auf dem^
linken Arme, auf der Mondsichel stehend, unter
der sich der Drache aufbäumt. Einschliefslich des
im langgezogenen Sechseck geformten Sockels
beträgt die Gesammthöhe 70 cm. Leider hat die
aus Lindenholz geschnitzte Figur durch die
Unbill der Zeiten sehr gelitten; sie ist ihres
schönsten Schmuckes zum Theil beraubt, aber
auch in ihren
dürftigen Resten
gibt sie doch
noch Zeugnifs
von ihrer einsti-
gen Schönheit.
Die sichtbaren
Körpertheilezei-
gen die natürli-
che Inkarnation;
die Haare sind
vergoldet; der
Mantel der Ma-
donna ist einfach
roth bemalt, hat
aber einen rei-
cheren Schmuck
erhalten durch
eine stark ver-
goldete schmale
Kupferborte, die
ihn am Rande
umsäumt. Dieser
Borte ist dann
noch eine weite-
re Zierde in auf-
gesetztenSternen
gegeben worden,
die ebenfalls aus
vergoldetem
Kupferblech be-
stehen. In glei-
möglich. Auch den jetzigen Aufstellungsort vermag i'-h
nicht anzugeben, da die bisher von dem Museum be-
setzten Räume an die Invaliden-Verwaltung verkauft
worden sind und die Museumsschätze deshalb wieder
einmal einen Umzug haben machen müssen. Die Rhein-
provinz hat in den letzten Jahren zwei grofse Pro-
vinzial-Museen, zu Trier und zu Bonn, erbaut. Die jüngst
gefafsten Beschlüsse des westfälischen Provinzialland-
tages geben der sicheren Hoffnung Raum, dafs die
Zeit nicht mehr fern sein wird, wo die in dieser Hin-
sicht in Münster obwaltenden Schwierigkeiten beseitigt
werden und das gröfste Museum der Provinz Westfalen
nicht länger genöthigt ist, heimathlos von einem Orte
zum andern zu wandern.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.
390
meinen arbeitete die Skulptur auch während des
Mittelalters mit einheitlichem Material. Solche
Bildwerke, bei denen ein Holzkern mit einer
in Metallblech bestehenden Bekleidung über-
zogen wurde, machen hiervon nur scheinbar
eine Ausnahme, indem der Holzkern blos als
verdeckter Träger der das Bildwerk bildenden
Metallumhüllung auftritt. Die Verwendung von
Stein oder Holz
erscheint als die
Regel bei den
mittelalterlichen
Bildwerken, die
dann meist auf
Kreidegrund mit
reicher Bema-
lung versehen
wurden. Dafs da-
neben aber auch
die andere mit
verschiedenarti-
gen Materialien
arbeitende Tech-
nik nicht ganz
aufser Uebung
gekommen ist,
dafür gibt es im-
merhin noch ein-
■ zelne, wenn auch
selteneBeispiele.
Ein Werk dieser
Art4) habe ich
in dem Museum
des Vereins für
westfälische Ge-
schichte u.Alter-
thumskunde zu
Münster gefun-
den.5) Es ist eine
Muttergottes in
*) Ein ähnliches befand sich gemäfs freundlicher
Mittheilung des Herrn Domkapitulars Schnütgen in
der „Exposition relrospective" zu Brüssel im Jahre 1888,
in deren Katalog es unter Nr. 3675 als „Statuette de
sainte, en bois polychrome et dore\ La robe est decore'e
de fleurons en metal peint. XVI" siecle" beschrieben
und als Eigenlhum des Herrn Mohl in Paris bezeichnet
ist. Vergoldete Kupferplättchen verzieren im engsten
Anschlüsse an die Draperie die Gewandparthien dieser
Figur, zu deren technischer Behandlung Viollet-le-Duc
in seinem »Dictionnaire raisonne de l'architecture« Bd. I
S. 38 ff. unter „Application" interessante Beiträge liefert.
5) Eine nähere Bezeichnung ist mir, da ein für die
Öffentlichkeit bestimmter Katalog noch mangelt, nicht
der beliebten Stellung: das Christuskind auf dem^
linken Arme, auf der Mondsichel stehend, unter
der sich der Drache aufbäumt. Einschliefslich des
im langgezogenen Sechseck geformten Sockels
beträgt die Gesammthöhe 70 cm. Leider hat die
aus Lindenholz geschnitzte Figur durch die
Unbill der Zeiten sehr gelitten; sie ist ihres
schönsten Schmuckes zum Theil beraubt, aber
auch in ihren
dürftigen Resten
gibt sie doch
noch Zeugnifs
von ihrer einsti-
gen Schönheit.
Die sichtbaren
Körpertheilezei-
gen die natürli-
che Inkarnation;
die Haare sind
vergoldet; der
Mantel der Ma-
donna ist einfach
roth bemalt, hat
aber einen rei-
cheren Schmuck
erhalten durch
eine stark ver-
goldete schmale
Kupferborte, die
ihn am Rande
umsäumt. Dieser
Borte ist dann
noch eine weite-
re Zierde in auf-
gesetztenSternen
gegeben worden,
die ebenfalls aus
vergoldetem
Kupferblech be-
stehen. In glei-
möglich. Auch den jetzigen Aufstellungsort vermag i'-h
nicht anzugeben, da die bisher von dem Museum be-
setzten Räume an die Invaliden-Verwaltung verkauft
worden sind und die Museumsschätze deshalb wieder
einmal einen Umzug haben machen müssen. Die Rhein-
provinz hat in den letzten Jahren zwei grofse Pro-
vinzial-Museen, zu Trier und zu Bonn, erbaut. Die jüngst
gefafsten Beschlüsse des westfälischen Provinzialland-
tages geben der sicheren Hoffnung Raum, dafs die
Zeit nicht mehr fern sein wird, wo die in dieser Hin-
sicht in Münster obwaltenden Schwierigkeiten beseitigt
werden und das gröfste Museum der Provinz Westfalen
nicht länger genöthigt ist, heimathlos von einem Orte
zum andern zu wandern.