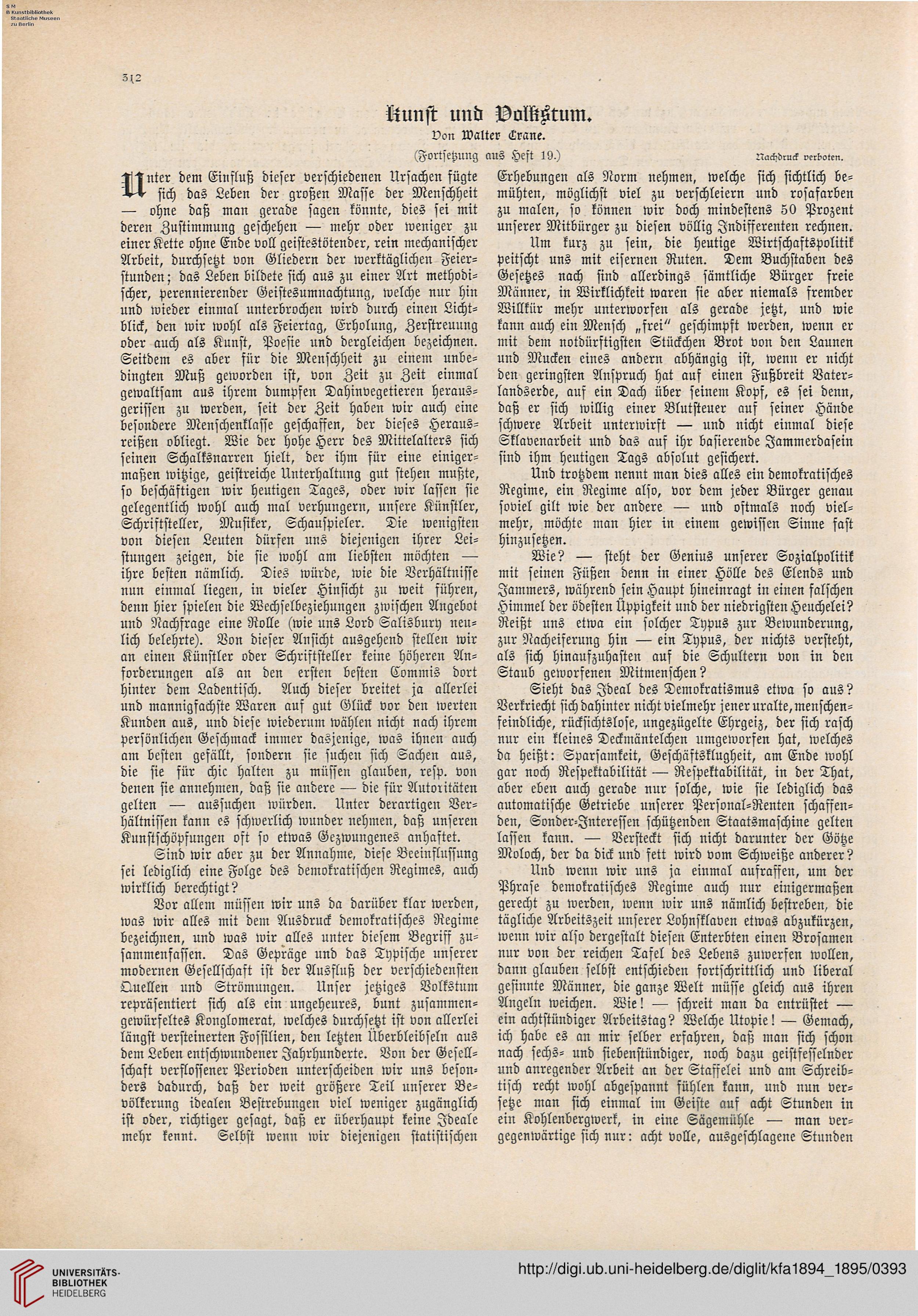312
Kunst und Volkstum.
von Walter Lrane.
(Fortsetzung aus Heft 19.) Nachdruck verboten.
nter dem Einfluß dieser verschiedenen Ursachen fügte
sich das Leben der großen Masse der Menschheit
— ohne daß man gerade sagen könnte, dies sei mit
deren Zustimmung geschehen — mehr oder weniger zu
einer Kette ohne Ende voll geistestötender, rein mechanischer
Arbeit, durchsetzt von Gliedern der werktäglichen Feier-
stunden ; das Leben bildete sich aus zu einer Art methodi-
scher, perennierender Geistesumnachtung, welche nur hin
und wieder einmal unterbrochen wird durch einen Licht-
blick, den wir wohl als Feiertag, Erholung, Zerstreuung
oder auch als Kunst, Poesie und dergleichen bezeichnen.
Seitdem es aber für die Menschheit zu einem unbe-
dingten Muß geworden ist, von Zeit zu Zeit einmal
gewaltsam aus ihrem dumpfen Dahinvegetieren heraus-
gerissen zu werden, seit der Zeit haben wir auch eine
besondere Menschenklasse geschaffen, der dieses Heraus-
reißen obliegt. Wie der hohe Herr des Mittelalters sich
seinen Schalksnarren hielt, der ihm für eine einiger-
maßen witzige, geistreiche Unterhaltung gut stehen mußte,
so beschäftigen wir heutigen Tages, oder wir lassen sie
gelegentlich Wohl auch mal verhungern, unsere Künstler,
Schriftsteller, Musiker, Schauspieler. Die wenigsten
von diesen Leuten dürfen uns diejenigen ihrer Lei-
stungen zeigen, die sie wohl am liebsten möchten —
ihre besten nämlich. Dies würde, wie die Verhältnisse
nun einmal liegen, in vieler Hinsicht zu weit führen,
denn hier spielen die Wechselbeziehungen zwischen Angebot
und Nachfrage eine Rolle (wie uns Lord Salisbury neu-
lich belehrte). Von dieser Ansicht ausgehend stellen wir
an einen Künstler oder Schriftsteller keine höheren An-
forderungen als an den ersten besten Commis dort
hinter dem Ladentisch. Auch dieser breitet ja allerlei
und mannigfachste Waren auf gut Glück vor den werten
Kunden aus, und diese wiederum wählen nicht nach ihrem
persönlichen Geschmack immer dasjenige, was ihnen auch
am besten gefällt, sondern sie suchen sich Sachen aus,
die sie für chic halten zu müssen glauben, resp. von
denen sie annehmen, daß sie andere -— die für Autoritäten
gelten — aussuchen würden. Unter derartigen Ver-
hältnissen kann es schwerlich wunder nehmen, daß unseren
Kunstschöpfungen oft so etwas Gezwungenes anhaftet.
Sind wir aber zu der Annahme, diese Beeinflussung
sei lediglich eine Folge des demokratischen Regimes, auch
wirklich berechtigt?
Vor allem müssen wir uns da darüber klar werden,
was wir alles mit dem Ausdruck demokratisches Regime
bezeichnen, und was wir alles unter diesem Begriff zu-
sammenfassen. Das Gepräge und das Typische unserer
modernen Gesellschaft ist der Ausfluß der verschiedensten
Quellen und Strömungen. Unser jetziges Volkstum
repräsentiert sich als ein ungeheures, bunt zusammen-
gewürfeltes Konglomerat, welches durchsetzt ist von allerlei
längst versteinerten Fossilien, den letzten Überbleibseln aus
dem Leben entschwundener Jahrhunderte. Von der Gesell-
schaft verflossener Perioden unterscheiden wir uns beson-
ders dadurch, daß der weit größere Teil unserer Be-
völkerung idealen Bestrebungen viel weniger zugänglich
ist oder, richtiger gesagt, daß er überhaupt keine Ideale
mehr kennt. Selbst wenn wir diejenigen statistischen
Erhebungen als Norm nehmen, welche sich sichtlich be-
mühten, möglichst viel zu verschleiern und rosafarben
zu malen, so können wir doch mindestens SO Prozent
unserer Mitbürger zu diesen völlig Indifferenten rechnen.
Um kurz zu sein, die heutige Wirtschaftspolitik
peitscht uns mit eisernen Ruten. Dem Buchstaben des
Gesetzes nach sind allerdings sämtliche Bürger freie
Männer, in Wirklichkeit waren sie aber niemals fremder
Willkür mehr unterworfen als gerade jetzt, und wie
kann auch ein Mensch „frei" geschimpft werden, wenn er
mit dem notdürftigsten Stückchen Brot von den Launen
und Mucken eines andern abhängig ist, wenn er nicht
den geringsten Anspruch hat auf einen Fußbreit Bater-
landserde, auf ein Dach über seinem Kopf, es sei denn,
daß er sich willig einer Blutsteuer auf seiner Hände
schwere Arbeit unterwirft — und nicht einmal diese
Sklavenarbeit und das auf ihr basierende Jammerdasein
sind ihm heutigen Tags absolut gesichert.
Ünd trotzdem nennt man dies alles ein demokratisches
Regime, ein Regime also, vor dem jeder Bürger genau
soviel gilt wie der andere — und oftmals noch viel-
mehr, möchte man hier in einem gewissen Sinne fast
hinzusetzen.
Wie? — steht der Genius unserer Sozialpolitik
mit seinen Füßen denn in einer Hölle des Elends und
Jammers, während sein Haupt hineinragt in einen falschen
Himmel der ödesten Üppigkeit und der niedrigsten Heuchelei?
Reißt uns etwa ein solcher Typus zur Bewunderung,
zur Nacheiferung hin — ein Typus, der nichts versteht,
als sich hinauszuhasten auf die Schultern von in den
Staub geworfenen Mitmenschen?
Sieht das Ideal des Demokratismus etwa so aus?
Verkriecht sich dahinter nicht vielmehr jener uralte, menschen-
feindliche, rücksichtslose, ungezügelte Ehrgeiz, der sich rasch
nur ein kleines Deckmäntelchen umgeworfen hat, welches
da heißt: Sparsamkeit, Geschäftsklugheit, am Ende wohl
gar noch Respektabilität — Respektabilität, in der That,
aber eben auch gerade nur solche, wie sie lediglich das
automatische Getriebe unserer Personal-Renten schaffen-
den, Sonder-Jnteressen schützenden Staatsmaschine gelten
lassen kann. — Versteckt sich nicht darunter der Götze
Moloch, der da dick und fett wird vom Schweiße anderer?
Ünd wenn wir uns ja einmal aufraffen, um der
Phrase demokratisches Regime auch nur einigermaßen
gerecht zu werden, wenn wir uns nämlich bestreben, die
tägliche Arbeitszeit unserer Lohnsklaven etwas abzukürzen,
wenn wir also dergestalt diesen Enterbten einen Brosamen
nur von der reichen Tafel des Lebens zuwerfen wollen,
dann glauben selbst entschieden fortschrittlich und liberal
gesinnte Männer, die ganze Welt müsse gleich aus ihren
Angeln weichen. Wie! — schreit man da entrüstet —
ein achtstündiger Arbeitstag? Welche Utopie! — Gemach,
ich habe es an mir selber erfahren, daß man sich schon
nach sechs- und siebenstündiger, noch dazu geistfesselnder
und anregender Arbeit an der Staffelei und am Schreib-
tisch recht wohl abgespannt fühlen kann, und nun ver-
setze man sich einmal im Geiste auf acht Stunden in
ein Kohlenbergwerk, in eine Sägemühle — man ver-
gegenwärtige sich nur: acht volle, ausgeschlagene Stunden
Kunst und Volkstum.
von Walter Lrane.
(Fortsetzung aus Heft 19.) Nachdruck verboten.
nter dem Einfluß dieser verschiedenen Ursachen fügte
sich das Leben der großen Masse der Menschheit
— ohne daß man gerade sagen könnte, dies sei mit
deren Zustimmung geschehen — mehr oder weniger zu
einer Kette ohne Ende voll geistestötender, rein mechanischer
Arbeit, durchsetzt von Gliedern der werktäglichen Feier-
stunden ; das Leben bildete sich aus zu einer Art methodi-
scher, perennierender Geistesumnachtung, welche nur hin
und wieder einmal unterbrochen wird durch einen Licht-
blick, den wir wohl als Feiertag, Erholung, Zerstreuung
oder auch als Kunst, Poesie und dergleichen bezeichnen.
Seitdem es aber für die Menschheit zu einem unbe-
dingten Muß geworden ist, von Zeit zu Zeit einmal
gewaltsam aus ihrem dumpfen Dahinvegetieren heraus-
gerissen zu werden, seit der Zeit haben wir auch eine
besondere Menschenklasse geschaffen, der dieses Heraus-
reißen obliegt. Wie der hohe Herr des Mittelalters sich
seinen Schalksnarren hielt, der ihm für eine einiger-
maßen witzige, geistreiche Unterhaltung gut stehen mußte,
so beschäftigen wir heutigen Tages, oder wir lassen sie
gelegentlich Wohl auch mal verhungern, unsere Künstler,
Schriftsteller, Musiker, Schauspieler. Die wenigsten
von diesen Leuten dürfen uns diejenigen ihrer Lei-
stungen zeigen, die sie wohl am liebsten möchten —
ihre besten nämlich. Dies würde, wie die Verhältnisse
nun einmal liegen, in vieler Hinsicht zu weit führen,
denn hier spielen die Wechselbeziehungen zwischen Angebot
und Nachfrage eine Rolle (wie uns Lord Salisbury neu-
lich belehrte). Von dieser Ansicht ausgehend stellen wir
an einen Künstler oder Schriftsteller keine höheren An-
forderungen als an den ersten besten Commis dort
hinter dem Ladentisch. Auch dieser breitet ja allerlei
und mannigfachste Waren auf gut Glück vor den werten
Kunden aus, und diese wiederum wählen nicht nach ihrem
persönlichen Geschmack immer dasjenige, was ihnen auch
am besten gefällt, sondern sie suchen sich Sachen aus,
die sie für chic halten zu müssen glauben, resp. von
denen sie annehmen, daß sie andere -— die für Autoritäten
gelten — aussuchen würden. Unter derartigen Ver-
hältnissen kann es schwerlich wunder nehmen, daß unseren
Kunstschöpfungen oft so etwas Gezwungenes anhaftet.
Sind wir aber zu der Annahme, diese Beeinflussung
sei lediglich eine Folge des demokratischen Regimes, auch
wirklich berechtigt?
Vor allem müssen wir uns da darüber klar werden,
was wir alles mit dem Ausdruck demokratisches Regime
bezeichnen, und was wir alles unter diesem Begriff zu-
sammenfassen. Das Gepräge und das Typische unserer
modernen Gesellschaft ist der Ausfluß der verschiedensten
Quellen und Strömungen. Unser jetziges Volkstum
repräsentiert sich als ein ungeheures, bunt zusammen-
gewürfeltes Konglomerat, welches durchsetzt ist von allerlei
längst versteinerten Fossilien, den letzten Überbleibseln aus
dem Leben entschwundener Jahrhunderte. Von der Gesell-
schaft verflossener Perioden unterscheiden wir uns beson-
ders dadurch, daß der weit größere Teil unserer Be-
völkerung idealen Bestrebungen viel weniger zugänglich
ist oder, richtiger gesagt, daß er überhaupt keine Ideale
mehr kennt. Selbst wenn wir diejenigen statistischen
Erhebungen als Norm nehmen, welche sich sichtlich be-
mühten, möglichst viel zu verschleiern und rosafarben
zu malen, so können wir doch mindestens SO Prozent
unserer Mitbürger zu diesen völlig Indifferenten rechnen.
Um kurz zu sein, die heutige Wirtschaftspolitik
peitscht uns mit eisernen Ruten. Dem Buchstaben des
Gesetzes nach sind allerdings sämtliche Bürger freie
Männer, in Wirklichkeit waren sie aber niemals fremder
Willkür mehr unterworfen als gerade jetzt, und wie
kann auch ein Mensch „frei" geschimpft werden, wenn er
mit dem notdürftigsten Stückchen Brot von den Launen
und Mucken eines andern abhängig ist, wenn er nicht
den geringsten Anspruch hat auf einen Fußbreit Bater-
landserde, auf ein Dach über seinem Kopf, es sei denn,
daß er sich willig einer Blutsteuer auf seiner Hände
schwere Arbeit unterwirft — und nicht einmal diese
Sklavenarbeit und das auf ihr basierende Jammerdasein
sind ihm heutigen Tags absolut gesichert.
Ünd trotzdem nennt man dies alles ein demokratisches
Regime, ein Regime also, vor dem jeder Bürger genau
soviel gilt wie der andere — und oftmals noch viel-
mehr, möchte man hier in einem gewissen Sinne fast
hinzusetzen.
Wie? — steht der Genius unserer Sozialpolitik
mit seinen Füßen denn in einer Hölle des Elends und
Jammers, während sein Haupt hineinragt in einen falschen
Himmel der ödesten Üppigkeit und der niedrigsten Heuchelei?
Reißt uns etwa ein solcher Typus zur Bewunderung,
zur Nacheiferung hin — ein Typus, der nichts versteht,
als sich hinauszuhasten auf die Schultern von in den
Staub geworfenen Mitmenschen?
Sieht das Ideal des Demokratismus etwa so aus?
Verkriecht sich dahinter nicht vielmehr jener uralte, menschen-
feindliche, rücksichtslose, ungezügelte Ehrgeiz, der sich rasch
nur ein kleines Deckmäntelchen umgeworfen hat, welches
da heißt: Sparsamkeit, Geschäftsklugheit, am Ende wohl
gar noch Respektabilität — Respektabilität, in der That,
aber eben auch gerade nur solche, wie sie lediglich das
automatische Getriebe unserer Personal-Renten schaffen-
den, Sonder-Jnteressen schützenden Staatsmaschine gelten
lassen kann. — Versteckt sich nicht darunter der Götze
Moloch, der da dick und fett wird vom Schweiße anderer?
Ünd wenn wir uns ja einmal aufraffen, um der
Phrase demokratisches Regime auch nur einigermaßen
gerecht zu werden, wenn wir uns nämlich bestreben, die
tägliche Arbeitszeit unserer Lohnsklaven etwas abzukürzen,
wenn wir also dergestalt diesen Enterbten einen Brosamen
nur von der reichen Tafel des Lebens zuwerfen wollen,
dann glauben selbst entschieden fortschrittlich und liberal
gesinnte Männer, die ganze Welt müsse gleich aus ihren
Angeln weichen. Wie! — schreit man da entrüstet —
ein achtstündiger Arbeitstag? Welche Utopie! — Gemach,
ich habe es an mir selber erfahren, daß man sich schon
nach sechs- und siebenstündiger, noch dazu geistfesselnder
und anregender Arbeit an der Staffelei und am Schreib-
tisch recht wohl abgespannt fühlen kann, und nun ver-
setze man sich einmal im Geiste auf acht Stunden in
ein Kohlenbergwerk, in eine Sägemühle — man ver-
gegenwärtige sich nur: acht volle, ausgeschlagene Stunden