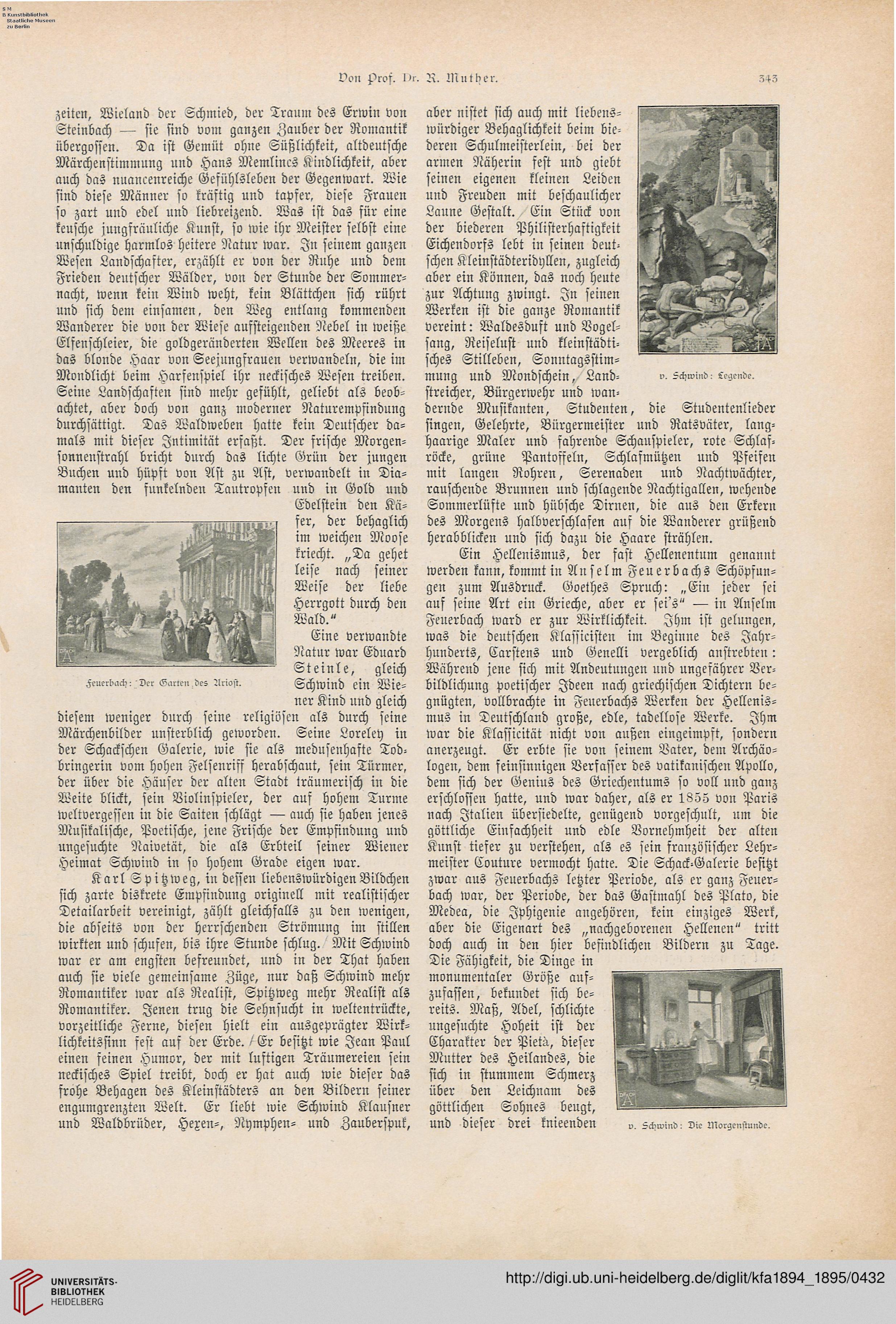Oon j)rc»f. I>r. mutker.
343
zeiten, Wieland der Schmied, der Traum des Erwin von
Steinbach — sie sind vom ganzen Zauber der Romantik
übergossen. Da ist Gemüt ohne Süßlichkeit, altdeutsche
Märchenstimmung und Hans Memlincs Kindlichkeit, aber
auch das nuancenreiche Gefühlsleben der Gegenwart. Wie
sind diese Männer so kräftig und tapfer, diese Frauen
so zart und edel und liebreizend. Was ist das für eine
keusche jungfräuliche Kunst, so wie ihr Meister selbst eine
unschuldige harmlos heitere Natur war. In seinem ganzen
Wesen Landschafter, erzählt er von der Rnhe und dem
Frieden deutscher Wälder, von der Stunde der Sommer-
nacht, wenn kein Wind weht, kein Blättchen sich rührt
und sich dem einsamen, den Weg entlang kommenden
Wanderer die von der Wiese aufsteigenden Nebel in weiße
Elfenschleier, die goldgeränderten Wellen des Meeres in
das blonde Haar von Seejungfrauen verwandeln, die im
Mondlicht beim Harfenspiel ihr neckisches Wesen treiben.
Seine Landschaften sind mehr gefühlt, geliebt als beob-
achtet, aber doch von ganz moderner Naturempfindung
durchsättigt. Das Waldweben hatte kein Deutscher da-
mals mit dieser Intimität erfaßt. Der frische Morgen-
sonnenstrahl bricht durch das lichte Grün der jungen
Buchen und hüpft von Ast zu Ast, verwandelt in Dia-
manten den funkelnden Tautropfen und in Gold und
Edelstein den Kä-
fer, der behaglich
im weichen Moose
kriecht. „Da gehet
leise nach seiner
Weise der liebe
Herrgott durch den
Wald."
Eine verwandte
Natur war Eduard
Steinle, gleich
Schwind ein Wie-
ner Kind und gleich
diesem weniger durch seine religiösen als durch seine
Märchenbilder unsterblich geworden. Seine Loreley in
der Schackschen Galerie, wie sie als medusenhafte Tod-
bringerin vom hohen Felsenriff herabschaut, sein Türmer,
der über die Häuser der alten Stadt träumerisch in die
Weite blickt, sein Violinspieler, der auf hohem Turme
weltvergessen in die Saiten schlägt — auch sie haben jenes
Musikalische, Poetische, jene Frische der Empfindung und
ungesuchte Naivetät, die als Erbteil seiner Wiener
Heimat Schwind in so hohem Grade eigen war.
Karl Spitzweg, in dessen liebenswürdigen Bildchen
sich zarte diskrete Empfindung originell mit realistischer
Detailarbeit vereinigt, zählt gleichfalls zu den wenigen,
die abseits von der herrschenden Strömung im stillen
wirkten und schufen, bis ihre Stunde schlug. Mit Schwind
war er am engsten befreundet, und in der That haben
auch sie viele gemeinsame Züge, nur daß Schwind mehr
Romantiker war als Realist, Spitzweg mehr Realist als
Romantiker. Jenen trug die Sehnsucht in weltentrückte,
vorzeitliche Ferne, diesen hielt ein ausgeprägter Wirk-
lichkeitssinn fest auf der Erde. / Er besitzt wie Jean Paul
einen feinen Humor, der mit luftigen Träumereien sein
neckisches Spiel treibt, doch er hat auch wie dieser das
frohe Behagen des Kleinstädters an den Bildern seiner
engumgrenzten Welt. Er liebt wie Schwind Klausner
und Waldbrüder, Hexen-, Nymphen- und Zauberspuk,
aber nistet sich auch mit liebens-
würdiger Behaglichkeit beim bie-
deren Schulmeisterlein, bei der
armen Näherin fest und giebt
seinen eigenen kleinen Leiden
und Freuden mit beschaulicher
Laune Gestalt. Ein Stück von
der biederen Philisterhaftigkeit
Eichendorfs lebt in seinen deut-
schen Kleinstädteridyllen, zugleich
aber ein Können, das noch heute
zur Achtung zwingt. In seinen
Werken ist die ganze Romantik
vereint: Waldesduft und Vogel-
fang, Reiselust und kleinstädti-
sches Stilleben, Sonntagsstim-
mung und Mondschein, Land-
streicher, Bürgerwehr und wan-
dernde Musikanten, Studenten, die Studentenlieder
singen, Gelehrte, Bürgermeister und Ratsväter, lang-
haarige Maler und fahrende Schauspieler, rote Schlaf-
röcke, grüne Pantoffeln, Schlafmützen und Pfeifen
mit langen Rohren, Serenaden und Nachtwächter,
rauschende Brunnen und schlagende Nachtigallen, wehende
Sommerlüfte und hübsche Dirnen, die aus den Erkern
des Morgens halbverschlafen ans die Wanderer grüßend
herabblicken und sich dazu die Haare strählen.
Ein Hellenismus, der fast Hellenentum genannt
werden kann, kommt in Anselm Feuer bachs Schöpfun-
gen zum Ausdruck. Goethes Spruch: „Ein jeder sei
auf seine Art ein Grieche, aber er sei's" — in Anselm
Feuerbach ward er zur Wirklichkeit. Ihm ist gelungen,
was die deutschen Klafficisten im Beginne des Jahr-
hunderts, Carstens und Genelli vergeblich anstrebten:
Während jene sich mit Andeutungen und ungefährer Ver-
bildlichung poetischer Ideen nach griechischen Dichtern be-
gnügten, vollbrachte in Feuerbachs Werken der Hellenis-
mus in Deutschland große, edle, tadellose Werke. Ihm
war die Klassicität nicht von außen eingeimpft, sondern
anerzeugt. Er erbte sie von seinem Vater, dem Archäo-
logen, dem feinsinnigen Verfasser des vatikanischen Apollo,
dem sich der Genius des Griechentums so voll und ganz
erschlossen hatte, und war daher, als er 1855 von Paris
nach Italien übersiedelte, genügend vorgeschult, um die
göttliche Einfachheit und edle Vornehmheit der alten
Kunst tiefer zu verstehen, als es sein französischer Lehr-
meister Couture vermocht hatte. Die Schack-Galerie besitzt
zwar aus Feuerbachs letzter Periode, als er ganz Feuer-
bach war, der Periode, der das Gastmahl des Plato, die
Medea, die Iphigenie angehören, kein einziges Werk,
aber die Eigenart des „nachgeborenen Hellenen" tritt
doch auch in den hier befindlichen Bildern zu Tage.
Die Fähigkeit, die Dinge in
monumentaler Größe auf-
zufassen, bekundet sich be-
reits. Maß, Adel, schlichte
ungesuchte Hoheit ist der
Charakter der PietL, dieser
Mutter des Heilandes, die
sich in stummem Schmerz
über den Leichnam des
göttlichen Sohnes beugt,
und dieser drei knieenden v. Schwind: Die Morgenstunde.
343
zeiten, Wieland der Schmied, der Traum des Erwin von
Steinbach — sie sind vom ganzen Zauber der Romantik
übergossen. Da ist Gemüt ohne Süßlichkeit, altdeutsche
Märchenstimmung und Hans Memlincs Kindlichkeit, aber
auch das nuancenreiche Gefühlsleben der Gegenwart. Wie
sind diese Männer so kräftig und tapfer, diese Frauen
so zart und edel und liebreizend. Was ist das für eine
keusche jungfräuliche Kunst, so wie ihr Meister selbst eine
unschuldige harmlos heitere Natur war. In seinem ganzen
Wesen Landschafter, erzählt er von der Rnhe und dem
Frieden deutscher Wälder, von der Stunde der Sommer-
nacht, wenn kein Wind weht, kein Blättchen sich rührt
und sich dem einsamen, den Weg entlang kommenden
Wanderer die von der Wiese aufsteigenden Nebel in weiße
Elfenschleier, die goldgeränderten Wellen des Meeres in
das blonde Haar von Seejungfrauen verwandeln, die im
Mondlicht beim Harfenspiel ihr neckisches Wesen treiben.
Seine Landschaften sind mehr gefühlt, geliebt als beob-
achtet, aber doch von ganz moderner Naturempfindung
durchsättigt. Das Waldweben hatte kein Deutscher da-
mals mit dieser Intimität erfaßt. Der frische Morgen-
sonnenstrahl bricht durch das lichte Grün der jungen
Buchen und hüpft von Ast zu Ast, verwandelt in Dia-
manten den funkelnden Tautropfen und in Gold und
Edelstein den Kä-
fer, der behaglich
im weichen Moose
kriecht. „Da gehet
leise nach seiner
Weise der liebe
Herrgott durch den
Wald."
Eine verwandte
Natur war Eduard
Steinle, gleich
Schwind ein Wie-
ner Kind und gleich
diesem weniger durch seine religiösen als durch seine
Märchenbilder unsterblich geworden. Seine Loreley in
der Schackschen Galerie, wie sie als medusenhafte Tod-
bringerin vom hohen Felsenriff herabschaut, sein Türmer,
der über die Häuser der alten Stadt träumerisch in die
Weite blickt, sein Violinspieler, der auf hohem Turme
weltvergessen in die Saiten schlägt — auch sie haben jenes
Musikalische, Poetische, jene Frische der Empfindung und
ungesuchte Naivetät, die als Erbteil seiner Wiener
Heimat Schwind in so hohem Grade eigen war.
Karl Spitzweg, in dessen liebenswürdigen Bildchen
sich zarte diskrete Empfindung originell mit realistischer
Detailarbeit vereinigt, zählt gleichfalls zu den wenigen,
die abseits von der herrschenden Strömung im stillen
wirkten und schufen, bis ihre Stunde schlug. Mit Schwind
war er am engsten befreundet, und in der That haben
auch sie viele gemeinsame Züge, nur daß Schwind mehr
Romantiker war als Realist, Spitzweg mehr Realist als
Romantiker. Jenen trug die Sehnsucht in weltentrückte,
vorzeitliche Ferne, diesen hielt ein ausgeprägter Wirk-
lichkeitssinn fest auf der Erde. / Er besitzt wie Jean Paul
einen feinen Humor, der mit luftigen Träumereien sein
neckisches Spiel treibt, doch er hat auch wie dieser das
frohe Behagen des Kleinstädters an den Bildern seiner
engumgrenzten Welt. Er liebt wie Schwind Klausner
und Waldbrüder, Hexen-, Nymphen- und Zauberspuk,
aber nistet sich auch mit liebens-
würdiger Behaglichkeit beim bie-
deren Schulmeisterlein, bei der
armen Näherin fest und giebt
seinen eigenen kleinen Leiden
und Freuden mit beschaulicher
Laune Gestalt. Ein Stück von
der biederen Philisterhaftigkeit
Eichendorfs lebt in seinen deut-
schen Kleinstädteridyllen, zugleich
aber ein Können, das noch heute
zur Achtung zwingt. In seinen
Werken ist die ganze Romantik
vereint: Waldesduft und Vogel-
fang, Reiselust und kleinstädti-
sches Stilleben, Sonntagsstim-
mung und Mondschein, Land-
streicher, Bürgerwehr und wan-
dernde Musikanten, Studenten, die Studentenlieder
singen, Gelehrte, Bürgermeister und Ratsväter, lang-
haarige Maler und fahrende Schauspieler, rote Schlaf-
röcke, grüne Pantoffeln, Schlafmützen und Pfeifen
mit langen Rohren, Serenaden und Nachtwächter,
rauschende Brunnen und schlagende Nachtigallen, wehende
Sommerlüfte und hübsche Dirnen, die aus den Erkern
des Morgens halbverschlafen ans die Wanderer grüßend
herabblicken und sich dazu die Haare strählen.
Ein Hellenismus, der fast Hellenentum genannt
werden kann, kommt in Anselm Feuer bachs Schöpfun-
gen zum Ausdruck. Goethes Spruch: „Ein jeder sei
auf seine Art ein Grieche, aber er sei's" — in Anselm
Feuerbach ward er zur Wirklichkeit. Ihm ist gelungen,
was die deutschen Klafficisten im Beginne des Jahr-
hunderts, Carstens und Genelli vergeblich anstrebten:
Während jene sich mit Andeutungen und ungefährer Ver-
bildlichung poetischer Ideen nach griechischen Dichtern be-
gnügten, vollbrachte in Feuerbachs Werken der Hellenis-
mus in Deutschland große, edle, tadellose Werke. Ihm
war die Klassicität nicht von außen eingeimpft, sondern
anerzeugt. Er erbte sie von seinem Vater, dem Archäo-
logen, dem feinsinnigen Verfasser des vatikanischen Apollo,
dem sich der Genius des Griechentums so voll und ganz
erschlossen hatte, und war daher, als er 1855 von Paris
nach Italien übersiedelte, genügend vorgeschult, um die
göttliche Einfachheit und edle Vornehmheit der alten
Kunst tiefer zu verstehen, als es sein französischer Lehr-
meister Couture vermocht hatte. Die Schack-Galerie besitzt
zwar aus Feuerbachs letzter Periode, als er ganz Feuer-
bach war, der Periode, der das Gastmahl des Plato, die
Medea, die Iphigenie angehören, kein einziges Werk,
aber die Eigenart des „nachgeborenen Hellenen" tritt
doch auch in den hier befindlichen Bildern zu Tage.
Die Fähigkeit, die Dinge in
monumentaler Größe auf-
zufassen, bekundet sich be-
reits. Maß, Adel, schlichte
ungesuchte Hoheit ist der
Charakter der PietL, dieser
Mutter des Heilandes, die
sich in stummem Schmerz
über den Leichnam des
göttlichen Sohnes beugt,
und dieser drei knieenden v. Schwind: Die Morgenstunde.