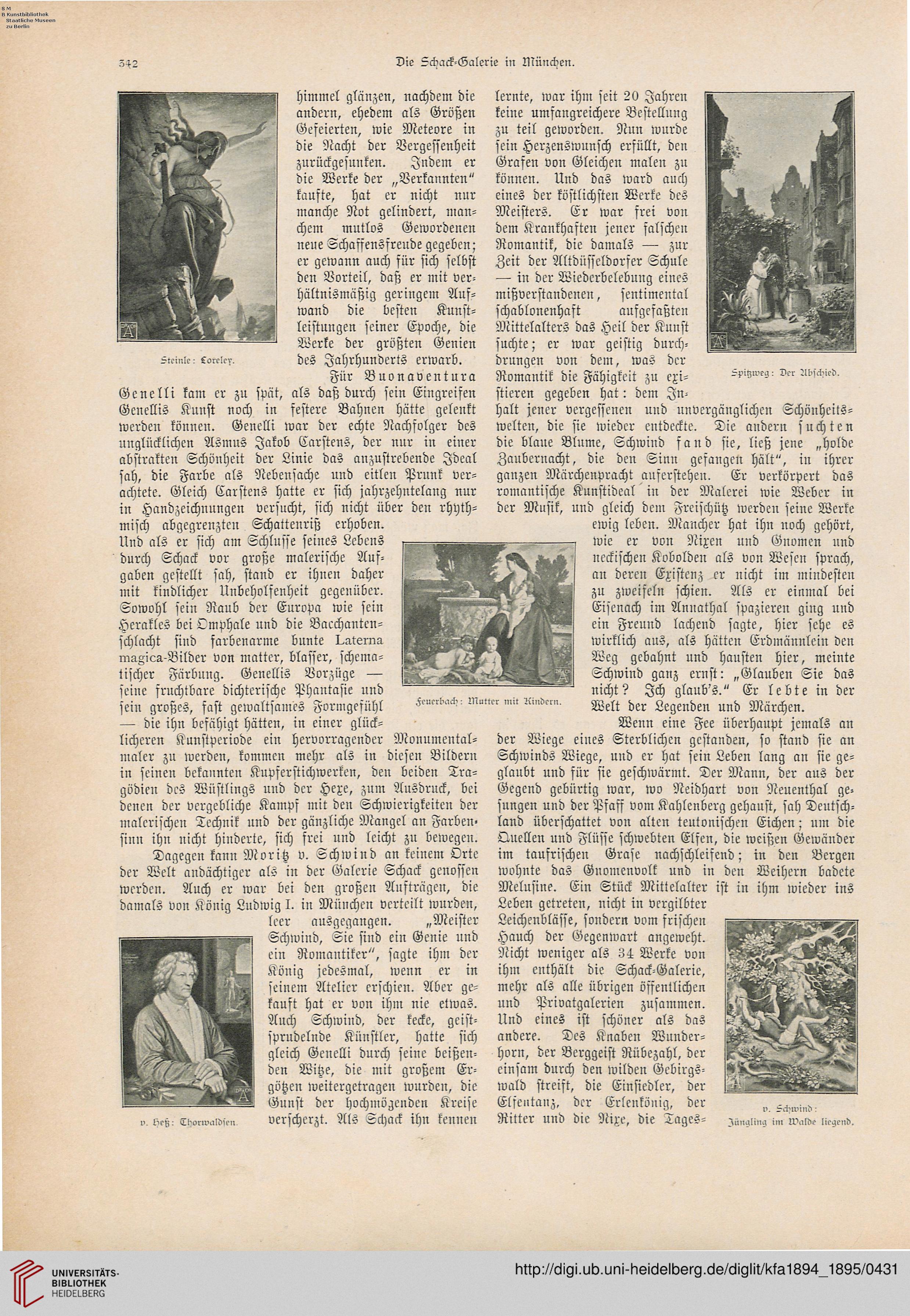Die 5cback-(8alerie in München.
Himmel glänzen, nachdem die
andern, ehedem als Größen
Gefeierten, wie Meteore in
die Nacht der Vergessenheit
zurückgesunken. Indem er
die Werke der „Verkannten"
kaufte, hat er nicht nur
manche Not gelindert, man-
chem mutlos Gewordenen
neue Schaffensfreude gegeben;
er gewann auch für sich selbst
den Vorteil, daß er mit ver-
hältnismäßig geringem Auf-
wand die besten Kunst-
leistungen seiner Epoche, die
Werke der größten Genien
des Jahrhunderts erwarb.
Für Buonaventura
Genelli kam er zu spät, als daß durch sein Eingreifen
Genellis Kunst noch in festere Bahnen hätte gelenkt
werden können. Genelli war der echte Nachfolger des
unglücklichen Asmus Jakob Carstens, der nur in einer
abstrakten Schönheit der Linie das anzustrebende Ideal
sah, die Farbe als Nebensache und eitlen Prunk ver-
achtete. Gleich Carstens hatte er sich jahrzehntelang nur
in Handzeichnungen versucht, sich nicht über den rhyth-
misch abgegrenzten Schattenriß erhoben.
Und als er sich am Schlüsse seines Lebens
durch Schack vor große malerische Auf-
gaben gestellt sah, stand er ihnen daher
mit kindlicher Unbeholfenheit gegenüber.
Sowohl sein Raub der Europa wie sein
Herakles bei Omphale und die Bacchanten-
schlacht sind farbenarme bunte Uaterna
maZica-Bilder von matter, blasser, schema-
tischer Färbung. Genellis Vorzüge —
seine fruchtbare dichterische Phantasie und
sein großes, fast gewaltsames Formgefühl
— die ihn befähigt hätten, in einer glück-
licheren Kunstperiode ein hervorragender Monumental-
maler zu werden, kommen mehr als in diesen Bildern
in seinen bekannten Kupferstichwerken, den beiden Tra-
gödien des Wüstlings und der Hexe, zum Ausdruck, bei
denen der vergebliche Kampf mit den Schwierigkeiten der
malerischen Technik und der gänzliche Mangel an Farben-
sinn ihn nicht hinderte, sich frei und leicht zu bewegen.
Dagegen kann Moritz v. Schwind an keinem Orte
der Welt andächtiger als in der Galerie Schack genossen
werden. Auch er war bei den großen Aufträgen, die
damals von König Ludwig I. in München verteilt wurden,
leer ausgegangen. „Meister
Schwind, Sie sind ein Genie und
ein Romantiker", sagte ihm der
König jedesmal, wenn er in
seinem Atelier erschien. Aber ge-
kauft hat er von ihm nie etwas.
Auch Schwind, der kecke, geist-
sprudelnde Künstler, hatte sich
gleich Genelli durch seine beißen-
den Witze, die mit großem Er-
götzen weitergetragen wurden, die
Gunst der hochmögenden Kreise
verscherzt. Als Schack ihn kennen
lernte, war ihm seit 20 Jahren
keine umfangreichere Bestellung
zu teil geworden. Nun wurde
sein Herzenswunsch erfüllt, den
Grafen von Gleichen malen zu
können. Und das ward auch
eines der köstlichsten Werke des
Meisters. Er war frei von
dem Krankhaften jener falschen
Romantik, die damals — zur
Zeit der Altdüsseldorfer Schule
— in der Wiederbelebung eines
mißverstandenen, sentimental
schablonenhaft aufgefaßten
Mittelalters das Heil der Kunst
suchte; er war geistig durch-
drungen von dem, was der
Romantik die Fähigkeit zu exi-
stieren gegeben hat: dem In-
halt jener vergessenen und unvergänglichen Schönheits-
welten, die sie wieder entdeckte. Die andern suchten
die blaue Blume, Schwind fand sie, ließ jene „holde
Zaubernacht, die den Sinn gefangen hält", in ihrer
ganzen Märchenpracht auserstehen. Er verkörpert das
romantische Kunstideal in der Malerei wie Weber in
der Musik, und gleich dem Freischütz werden seine Werke
ewig leben. Mancher hat ihn noch gehört,
wie er von Nixen und Gnomen und
neckischen Kobolden als von Wesen sprach,
an deren Existenz er nicht im mindesten
zu zweifeln schien. Als er einmal bei
Eisenach im Annathal spazieren ging und
ein Freund lachend sagte, hier sehe es
wirklich aus, als hätten Erdmännlein den
Weg gebahnt und hausten hier, meinte
Schwind ganz ernst: „Glauben Sie das
nicht? Ich glaub's." Er lebte in der
Welt der Legenden und Märchen.
Wenn eine Fee überhaupt jemals an
der Wiege eines Sterblichen gestanden, so stand sie an
Schwinds Wiege, und er hat sein Leben lang an sie ge-
glaubt und für sie geschwärmt. Der Mann, der aus der
Gegend gebürtig war, wo Neidhart von Neuenthal ge-
sungen und der Pfaff vom Kahlenberg gehaust, sah Deutsch-
land überschattet von alten teutonischen Eichen; um die
Quellen und Flüsse schwebten Elfen, die weißen Gewänder
im taufrischen Grase nachschleifend; in den Bergen
wohnte das Gnomenvolk und in den Weihern badete
Melusine. Ein Stück Mittelalter ist in ihm wieder ins
Leben getreten, nicht in vergilbter
Leichenblässe, sondern vom frischen
Hauch der Gegenwart angeweht.
Nicht weniger als 34 Werke von
ihm enthält die Schack-Galerie,
mehr als alle übrigen öffentlichen
und Privatgalerien zusammen.
Und eines ist schöner als das
andere. Des Knaben Wunder-
horn, der Berggeist Rübezahl, der
einsam durch den wilden Gcbirgs-
wald streift, die Einsiedler, der
Elfentanz, der Erlenkönig, der
Ritter und die Nixe, die ^.ages- im
342
Himmel glänzen, nachdem die
andern, ehedem als Größen
Gefeierten, wie Meteore in
die Nacht der Vergessenheit
zurückgesunken. Indem er
die Werke der „Verkannten"
kaufte, hat er nicht nur
manche Not gelindert, man-
chem mutlos Gewordenen
neue Schaffensfreude gegeben;
er gewann auch für sich selbst
den Vorteil, daß er mit ver-
hältnismäßig geringem Auf-
wand die besten Kunst-
leistungen seiner Epoche, die
Werke der größten Genien
des Jahrhunderts erwarb.
Für Buonaventura
Genelli kam er zu spät, als daß durch sein Eingreifen
Genellis Kunst noch in festere Bahnen hätte gelenkt
werden können. Genelli war der echte Nachfolger des
unglücklichen Asmus Jakob Carstens, der nur in einer
abstrakten Schönheit der Linie das anzustrebende Ideal
sah, die Farbe als Nebensache und eitlen Prunk ver-
achtete. Gleich Carstens hatte er sich jahrzehntelang nur
in Handzeichnungen versucht, sich nicht über den rhyth-
misch abgegrenzten Schattenriß erhoben.
Und als er sich am Schlüsse seines Lebens
durch Schack vor große malerische Auf-
gaben gestellt sah, stand er ihnen daher
mit kindlicher Unbeholfenheit gegenüber.
Sowohl sein Raub der Europa wie sein
Herakles bei Omphale und die Bacchanten-
schlacht sind farbenarme bunte Uaterna
maZica-Bilder von matter, blasser, schema-
tischer Färbung. Genellis Vorzüge —
seine fruchtbare dichterische Phantasie und
sein großes, fast gewaltsames Formgefühl
— die ihn befähigt hätten, in einer glück-
licheren Kunstperiode ein hervorragender Monumental-
maler zu werden, kommen mehr als in diesen Bildern
in seinen bekannten Kupferstichwerken, den beiden Tra-
gödien des Wüstlings und der Hexe, zum Ausdruck, bei
denen der vergebliche Kampf mit den Schwierigkeiten der
malerischen Technik und der gänzliche Mangel an Farben-
sinn ihn nicht hinderte, sich frei und leicht zu bewegen.
Dagegen kann Moritz v. Schwind an keinem Orte
der Welt andächtiger als in der Galerie Schack genossen
werden. Auch er war bei den großen Aufträgen, die
damals von König Ludwig I. in München verteilt wurden,
leer ausgegangen. „Meister
Schwind, Sie sind ein Genie und
ein Romantiker", sagte ihm der
König jedesmal, wenn er in
seinem Atelier erschien. Aber ge-
kauft hat er von ihm nie etwas.
Auch Schwind, der kecke, geist-
sprudelnde Künstler, hatte sich
gleich Genelli durch seine beißen-
den Witze, die mit großem Er-
götzen weitergetragen wurden, die
Gunst der hochmögenden Kreise
verscherzt. Als Schack ihn kennen
lernte, war ihm seit 20 Jahren
keine umfangreichere Bestellung
zu teil geworden. Nun wurde
sein Herzenswunsch erfüllt, den
Grafen von Gleichen malen zu
können. Und das ward auch
eines der köstlichsten Werke des
Meisters. Er war frei von
dem Krankhaften jener falschen
Romantik, die damals — zur
Zeit der Altdüsseldorfer Schule
— in der Wiederbelebung eines
mißverstandenen, sentimental
schablonenhaft aufgefaßten
Mittelalters das Heil der Kunst
suchte; er war geistig durch-
drungen von dem, was der
Romantik die Fähigkeit zu exi-
stieren gegeben hat: dem In-
halt jener vergessenen und unvergänglichen Schönheits-
welten, die sie wieder entdeckte. Die andern suchten
die blaue Blume, Schwind fand sie, ließ jene „holde
Zaubernacht, die den Sinn gefangen hält", in ihrer
ganzen Märchenpracht auserstehen. Er verkörpert das
romantische Kunstideal in der Malerei wie Weber in
der Musik, und gleich dem Freischütz werden seine Werke
ewig leben. Mancher hat ihn noch gehört,
wie er von Nixen und Gnomen und
neckischen Kobolden als von Wesen sprach,
an deren Existenz er nicht im mindesten
zu zweifeln schien. Als er einmal bei
Eisenach im Annathal spazieren ging und
ein Freund lachend sagte, hier sehe es
wirklich aus, als hätten Erdmännlein den
Weg gebahnt und hausten hier, meinte
Schwind ganz ernst: „Glauben Sie das
nicht? Ich glaub's." Er lebte in der
Welt der Legenden und Märchen.
Wenn eine Fee überhaupt jemals an
der Wiege eines Sterblichen gestanden, so stand sie an
Schwinds Wiege, und er hat sein Leben lang an sie ge-
glaubt und für sie geschwärmt. Der Mann, der aus der
Gegend gebürtig war, wo Neidhart von Neuenthal ge-
sungen und der Pfaff vom Kahlenberg gehaust, sah Deutsch-
land überschattet von alten teutonischen Eichen; um die
Quellen und Flüsse schwebten Elfen, die weißen Gewänder
im taufrischen Grase nachschleifend; in den Bergen
wohnte das Gnomenvolk und in den Weihern badete
Melusine. Ein Stück Mittelalter ist in ihm wieder ins
Leben getreten, nicht in vergilbter
Leichenblässe, sondern vom frischen
Hauch der Gegenwart angeweht.
Nicht weniger als 34 Werke von
ihm enthält die Schack-Galerie,
mehr als alle übrigen öffentlichen
und Privatgalerien zusammen.
Und eines ist schöner als das
andere. Des Knaben Wunder-
horn, der Berggeist Rübezahl, der
einsam durch den wilden Gcbirgs-
wald streift, die Einsiedler, der
Elfentanz, der Erlenkönig, der
Ritter und die Nixe, die ^.ages- im
342