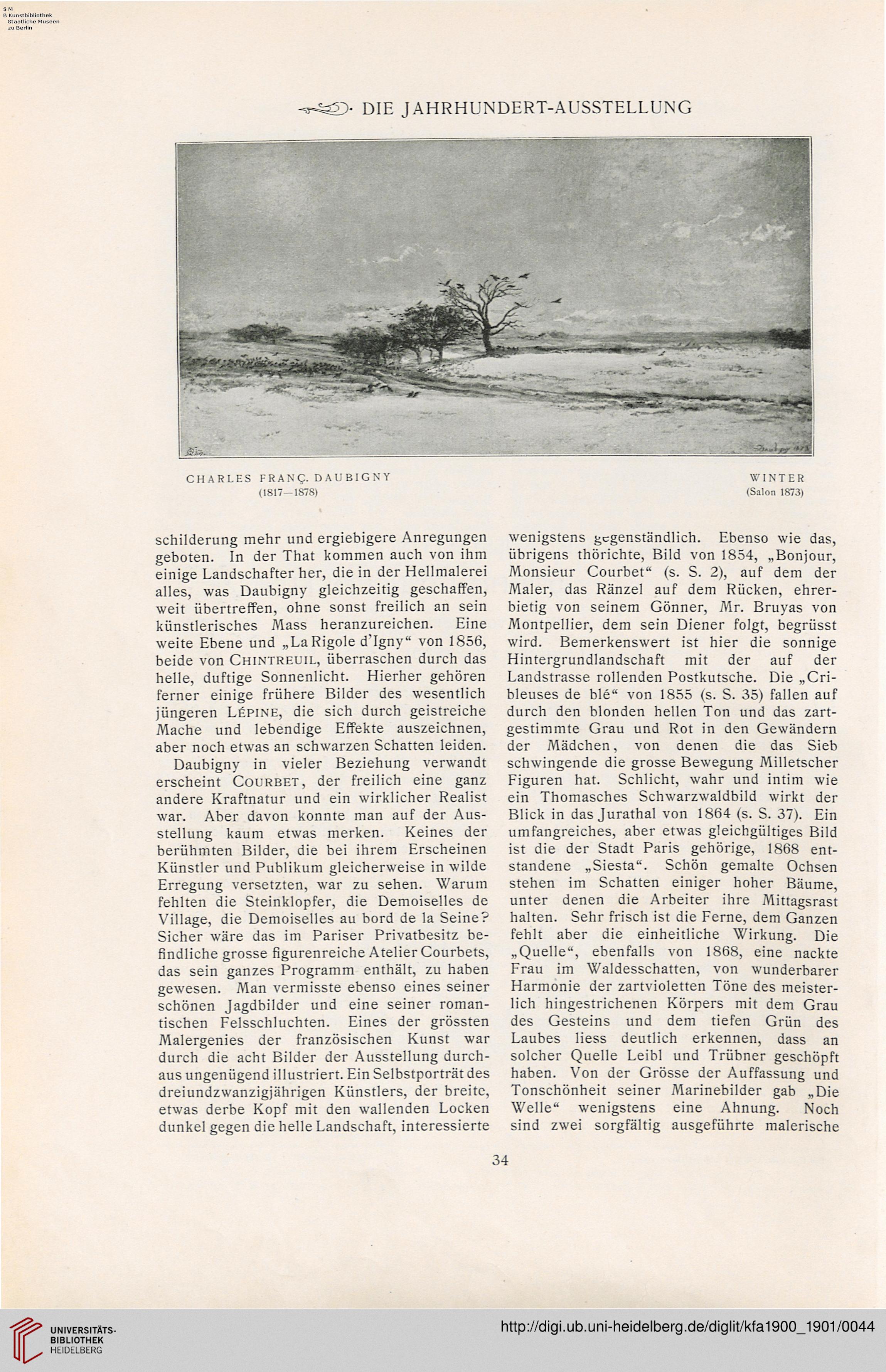-*-4Ö> DIE JAHRHUNDERT-AUSSTELLUNG
Schilderung mehr und ergiebigere Anregungen
geboten. In der That kommen auch von ihm
einige Landschafter her, die in der Hellmalerei
alles, was Daubigny gleichzeitig geschaffen,
weit übertreffen, ohne sonst freilich an sein
künstlerisches Mass heranzureichen. Eine
weite Ebene und „LaRigole dTgny" von 1856,
beide von Chintreuil, überraschen durch das
helle, duftige Sonnenlicht. Hierher gehören
ferner einige frühere Bilder des wesentlich
jüngeren Lepine, die sich durch geistreiche
Mache und lebendige Effekte auszeichnen,
aber noch etwas an schwarzen Schatten leiden.
Daubigny in vieler Beziehung verwandt
erscheint Courbet, der freilich eine ganz
andere Kraftnatur und ein wirklicher Realist
war. Aber davon konnte man auf der Aus-
stellung kaum etwas merken. Keines der
berühmten Bilder, die bei ihrem Erscheinen
Künstler und Publikum gleicherweise in wilde
Erregung versetzten, war zu sehen. Warum
fehlten die Steinklopfer, die Demoiselles de
Village, die Demoiselles au bord de la Seine?
Sicher wäre das im Pariser Privatbesitz be-
findliche grosse figurenreiche Atelier Courbets,
das sein ganzes Programm enthält, zu haben
gewesen. Man vermisste ebenso eines seiner
schönen Jagdbilder und eine seiner roman-
tischen Felsschluchten. Eines der grössten
Malergenies der französischen Kunst war
durch die acht Bilder der Ausstellung durch-
aus ungenügend illustriert. Ein Selbstporträt des
dreiundzwanzigjährigen Künstlers, der breite,
etwas derbe Kopf mit den wallenden Locken
dunkel gegen die helle Landschaft, interessierte
wenigstens gegenständlich. Ebenso wie das,
übrigens thörichte, Bild von 1854, „Bonjour,
Monsieur Courbet" (s. S. 2), auf dem der
Maler, das Ränzel auf dem Rücken, ehrer-
bietig von seinem Gönner, Mr. Bruyas von
Montpellier, dem sein Diener folgt, begrüsst
wird. Bemerkenswert ist hier die sonnige
Hintergrundlandschaft mit der auf der
Landstrasse rollenden Postkutsche. Die „Cri-
bleuses de ble" von 1855 (s. S. 35) fallen auf
durch den blonden hellen Ton und das zart-
gestimmte Grau und Rot in den Gewändern
der Mädchen, von denen die das Sieb
schwingende die grosse Bewegung Milletscher
Figuren hat. Schlicht, wahr und intim wie
ein Thomasches Schwarzwaldbild wirkt der
Blick in das Jurathal von 1864 (s. S. 37). Ein
umfangreiches, aber etwas gleichgültiges Bild
ist die der Stadt Paris gehörige, 1868 ent-
standene „Siesta". Schön gemalte Ochsen
stehen im Schatten einiger hoher Bäume,
unter denen die Arbeiter ihre Mittagsrast
halten. Sehr frisch ist die Ferne, dem Ganzen
fehlt aber die einheitliche Wirkung. Die
„Quelle", ebenfalls von 1868, eine nackte
Frau im Waldesschatten, von wunderbarer
Harmonie der zartvioletten Töne des meister-
lich hingestrichenen Körpers mit dem Grau
des Gesteins und dem tiefen Grün des
Laubes Hess deutlich erkennen, dass an
solcher Quelle Leibi und Trübner geschöpft
haben. Von der Grösse der Auffassung und
Tonschönheit seiner Marinebilder gab „Die
Welle" wenigstens eine Ahnung. Noch
sind zwei sorgfältig ausgeführte malerische
34
Schilderung mehr und ergiebigere Anregungen
geboten. In der That kommen auch von ihm
einige Landschafter her, die in der Hellmalerei
alles, was Daubigny gleichzeitig geschaffen,
weit übertreffen, ohne sonst freilich an sein
künstlerisches Mass heranzureichen. Eine
weite Ebene und „LaRigole dTgny" von 1856,
beide von Chintreuil, überraschen durch das
helle, duftige Sonnenlicht. Hierher gehören
ferner einige frühere Bilder des wesentlich
jüngeren Lepine, die sich durch geistreiche
Mache und lebendige Effekte auszeichnen,
aber noch etwas an schwarzen Schatten leiden.
Daubigny in vieler Beziehung verwandt
erscheint Courbet, der freilich eine ganz
andere Kraftnatur und ein wirklicher Realist
war. Aber davon konnte man auf der Aus-
stellung kaum etwas merken. Keines der
berühmten Bilder, die bei ihrem Erscheinen
Künstler und Publikum gleicherweise in wilde
Erregung versetzten, war zu sehen. Warum
fehlten die Steinklopfer, die Demoiselles de
Village, die Demoiselles au bord de la Seine?
Sicher wäre das im Pariser Privatbesitz be-
findliche grosse figurenreiche Atelier Courbets,
das sein ganzes Programm enthält, zu haben
gewesen. Man vermisste ebenso eines seiner
schönen Jagdbilder und eine seiner roman-
tischen Felsschluchten. Eines der grössten
Malergenies der französischen Kunst war
durch die acht Bilder der Ausstellung durch-
aus ungenügend illustriert. Ein Selbstporträt des
dreiundzwanzigjährigen Künstlers, der breite,
etwas derbe Kopf mit den wallenden Locken
dunkel gegen die helle Landschaft, interessierte
wenigstens gegenständlich. Ebenso wie das,
übrigens thörichte, Bild von 1854, „Bonjour,
Monsieur Courbet" (s. S. 2), auf dem der
Maler, das Ränzel auf dem Rücken, ehrer-
bietig von seinem Gönner, Mr. Bruyas von
Montpellier, dem sein Diener folgt, begrüsst
wird. Bemerkenswert ist hier die sonnige
Hintergrundlandschaft mit der auf der
Landstrasse rollenden Postkutsche. Die „Cri-
bleuses de ble" von 1855 (s. S. 35) fallen auf
durch den blonden hellen Ton und das zart-
gestimmte Grau und Rot in den Gewändern
der Mädchen, von denen die das Sieb
schwingende die grosse Bewegung Milletscher
Figuren hat. Schlicht, wahr und intim wie
ein Thomasches Schwarzwaldbild wirkt der
Blick in das Jurathal von 1864 (s. S. 37). Ein
umfangreiches, aber etwas gleichgültiges Bild
ist die der Stadt Paris gehörige, 1868 ent-
standene „Siesta". Schön gemalte Ochsen
stehen im Schatten einiger hoher Bäume,
unter denen die Arbeiter ihre Mittagsrast
halten. Sehr frisch ist die Ferne, dem Ganzen
fehlt aber die einheitliche Wirkung. Die
„Quelle", ebenfalls von 1868, eine nackte
Frau im Waldesschatten, von wunderbarer
Harmonie der zartvioletten Töne des meister-
lich hingestrichenen Körpers mit dem Grau
des Gesteins und dem tiefen Grün des
Laubes Hess deutlich erkennen, dass an
solcher Quelle Leibi und Trübner geschöpft
haben. Von der Grösse der Auffassung und
Tonschönheit seiner Marinebilder gab „Die
Welle" wenigstens eine Ahnung. Noch
sind zwei sorgfältig ausgeführte malerische
34