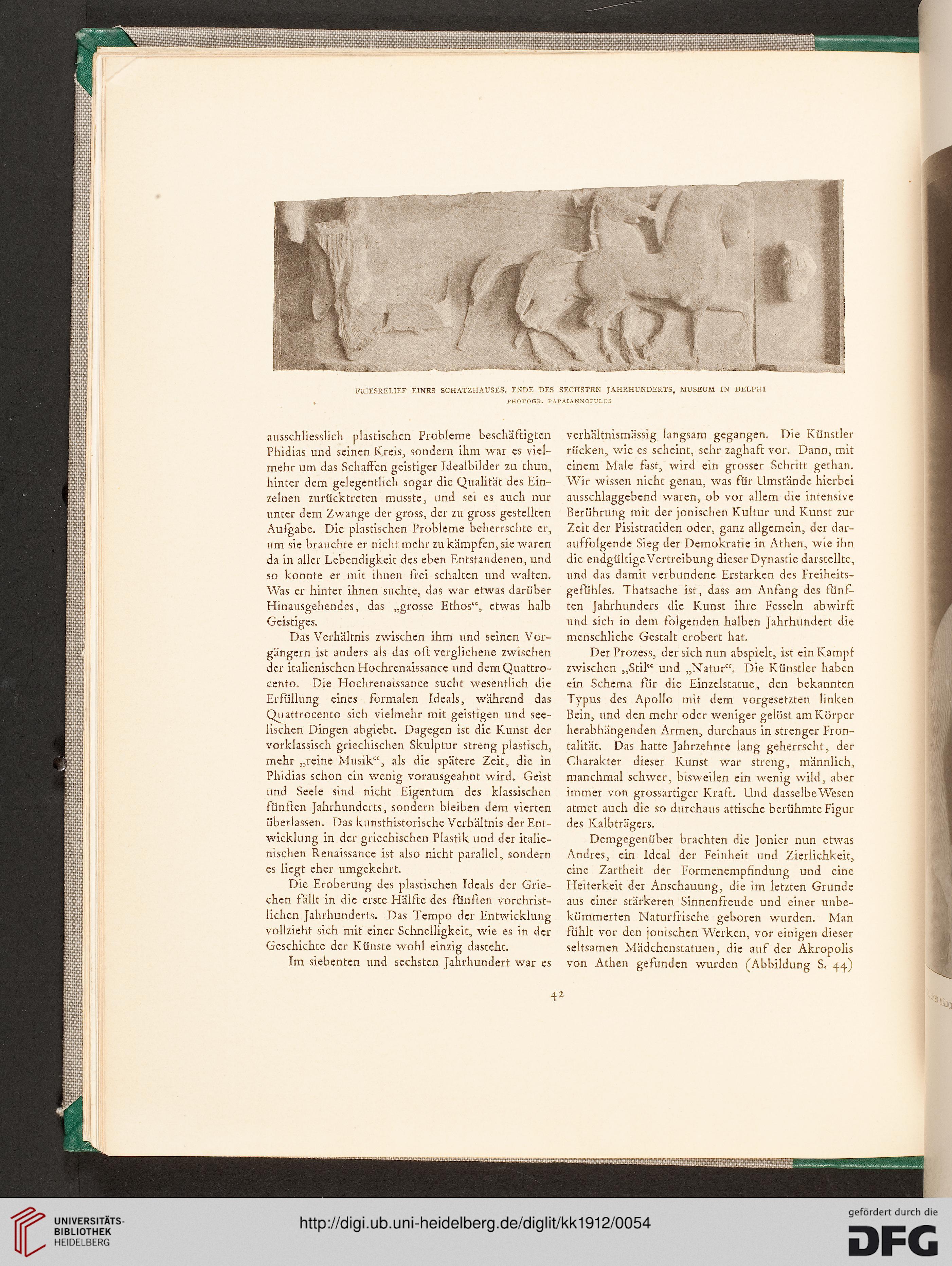Ei-triaHE&rwnBStiS
BQffl
•;•■;
1
FRIESRELIEF EINES SCHATZHAUSES. ENDE DES SECHSTEN JAHRHUNDERTS, MUSEUM IN DELPHI
PHOTOGR. TAPAIANNOrULOS
m
na
ausschliesslich plastischen Probleme beschäftigten
Phidias und seinen Kreis, sondern ihm war es viel-
mehr um das Schaffen geistiger Idealbilder zu thun,
hinter dem gelegentlich sogar die Qualität des Ein-
zelnen zurücktreten musste, und sei es auch nur
unter dem Zwange der gross, der zu gross gestellten
Aufgabe. Die plastischen Probleme beherrschte er,
um sie brauchte er nicht mehr zu kämpfen, sie waren
da in aller Lebendigkeit des eben Entstandenen, und
so konnte er mit ihnen frei schalten und walten.
Was er hinter ihnen suchte, das war etwas darüber
Hinausgehendes, das „grosse Ethos", etwas halb
Geistiges.
Das Verhältnis zwischen ihm und seinen Vor-
gängern ist anders als das oft verglichene zwischen
der italienischen Hochrenaissance und dem Quattro-
cento. Die Hochrenaissance sucht wesentlich die
Erfüllung eines formalen Ideals, während das
Quattrocento sich vielmehr mit geistigen und see-
lischen Dingen abgiebt. Dagegen ist die Kunst der
vorklassisch griechischen Skulptur streng plastisch,
mehr „reine Musik", als die spätere Zeit, die in
Phidias schon ein wenig vorausgeahnt wird. Geist
und Seele sind nicht Eigentum des klassischen
fünften Jahrhunderts, sondern bleiben dem vierten
überlassen. Das kunsthistorische Verhältnis der Ent-
wicklung in der griechischen Plastik und der italie-
nischen Renaissance ist also nicht parallel, sondern
es liegt eher umgekehrt.
Die Eroberung des plastischen Ideals der Grie-
chen fällt in die erste Hälfte des fünften vorchrist-
lichen Jahrhunderts. Das Tempo der Entwicklung
vollzieht sich mit einer Schnelligkeit, wie es in der
Geschichte der Künste wohl einzig dasteht.
Im siebenten und sechsten Jahrhundert war es
verhältnismässig langsam gegangen. Die Künstler
rücken, wie es scheint, sehr zaghaft vor. Dann, mit
einem Male fast, wird ein grosser Schritt gethan.
Wir wissen nicht genau, was für Umstände hierbei
ausschlaggebend waren, ob vor allem die intensive
Berührung mit der jonischen Kultur und Kunst zur
Zeit der Pisistratiden oder, ganz allgemein, der dar-
auffolgende Sieg der Demokratie in Athen, wie ihn
die endgültige Vertreibung dieser Dynastie darstellte,
und das damit verbundene Erstarken des Freiheits-
gefühles. Thatsache ist, dass am Anfang des fünf-
ten Jahrhunders die Kunst ihre Fesseln abwirft
und sich in dem folgenden halben Jahrhundert die
menschliche Gestalt erobert hat.
DerProzess, der sich nun abspielt, ist ein Kampf
zwischen „Stil" und „Natur". Die Künstler haben
ein Schema für die Einzelstatue, den bekannten
Typus des Apollo mit dem vorgesetzten linken
Bein, und den mehr oder weniger gelöst am Körper
herabhängenden Armen, durchaus in strenger Fron-
talität. Das hatte Jahrzehnte lang geherrscht, der
Charakter dieser Kunst war streng, männlich,
manchmal schwer, bisweilen ein wenig wild, aber
immer von grossartiger Kraft. Und dasselbeWesen
atmet auch die so durchaus attische berühmte Figur
des Kalbträgers.
Demgegenüber brachten die Jonier nun etwas
Andres, ein Ideal der Feinheit und Zierlichkeit,
eine Zartheit der Formenempfindung und eine
Heiterkeit der Anschauung, die im letzten Grunde
aus einer stärkeren Sinnenfreude und einer unbe-
kümmerten Naturfrische geboren wurden. Man
fühlt vor den jonischen Werken, vor einigen dieser
seltsamen Mädchenstatuen, die auf der Akropolis
von Athen gefunden wurden (Abbildung S. 44)
BQffl
•;•■;
1
FRIESRELIEF EINES SCHATZHAUSES. ENDE DES SECHSTEN JAHRHUNDERTS, MUSEUM IN DELPHI
PHOTOGR. TAPAIANNOrULOS
m
na
ausschliesslich plastischen Probleme beschäftigten
Phidias und seinen Kreis, sondern ihm war es viel-
mehr um das Schaffen geistiger Idealbilder zu thun,
hinter dem gelegentlich sogar die Qualität des Ein-
zelnen zurücktreten musste, und sei es auch nur
unter dem Zwange der gross, der zu gross gestellten
Aufgabe. Die plastischen Probleme beherrschte er,
um sie brauchte er nicht mehr zu kämpfen, sie waren
da in aller Lebendigkeit des eben Entstandenen, und
so konnte er mit ihnen frei schalten und walten.
Was er hinter ihnen suchte, das war etwas darüber
Hinausgehendes, das „grosse Ethos", etwas halb
Geistiges.
Das Verhältnis zwischen ihm und seinen Vor-
gängern ist anders als das oft verglichene zwischen
der italienischen Hochrenaissance und dem Quattro-
cento. Die Hochrenaissance sucht wesentlich die
Erfüllung eines formalen Ideals, während das
Quattrocento sich vielmehr mit geistigen und see-
lischen Dingen abgiebt. Dagegen ist die Kunst der
vorklassisch griechischen Skulptur streng plastisch,
mehr „reine Musik", als die spätere Zeit, die in
Phidias schon ein wenig vorausgeahnt wird. Geist
und Seele sind nicht Eigentum des klassischen
fünften Jahrhunderts, sondern bleiben dem vierten
überlassen. Das kunsthistorische Verhältnis der Ent-
wicklung in der griechischen Plastik und der italie-
nischen Renaissance ist also nicht parallel, sondern
es liegt eher umgekehrt.
Die Eroberung des plastischen Ideals der Grie-
chen fällt in die erste Hälfte des fünften vorchrist-
lichen Jahrhunderts. Das Tempo der Entwicklung
vollzieht sich mit einer Schnelligkeit, wie es in der
Geschichte der Künste wohl einzig dasteht.
Im siebenten und sechsten Jahrhundert war es
verhältnismässig langsam gegangen. Die Künstler
rücken, wie es scheint, sehr zaghaft vor. Dann, mit
einem Male fast, wird ein grosser Schritt gethan.
Wir wissen nicht genau, was für Umstände hierbei
ausschlaggebend waren, ob vor allem die intensive
Berührung mit der jonischen Kultur und Kunst zur
Zeit der Pisistratiden oder, ganz allgemein, der dar-
auffolgende Sieg der Demokratie in Athen, wie ihn
die endgültige Vertreibung dieser Dynastie darstellte,
und das damit verbundene Erstarken des Freiheits-
gefühles. Thatsache ist, dass am Anfang des fünf-
ten Jahrhunders die Kunst ihre Fesseln abwirft
und sich in dem folgenden halben Jahrhundert die
menschliche Gestalt erobert hat.
DerProzess, der sich nun abspielt, ist ein Kampf
zwischen „Stil" und „Natur". Die Künstler haben
ein Schema für die Einzelstatue, den bekannten
Typus des Apollo mit dem vorgesetzten linken
Bein, und den mehr oder weniger gelöst am Körper
herabhängenden Armen, durchaus in strenger Fron-
talität. Das hatte Jahrzehnte lang geherrscht, der
Charakter dieser Kunst war streng, männlich,
manchmal schwer, bisweilen ein wenig wild, aber
immer von grossartiger Kraft. Und dasselbeWesen
atmet auch die so durchaus attische berühmte Figur
des Kalbträgers.
Demgegenüber brachten die Jonier nun etwas
Andres, ein Ideal der Feinheit und Zierlichkeit,
eine Zartheit der Formenempfindung und eine
Heiterkeit der Anschauung, die im letzten Grunde
aus einer stärkeren Sinnenfreude und einer unbe-
kümmerten Naturfrische geboren wurden. Man
fühlt vor den jonischen Werken, vor einigen dieser
seltsamen Mädchenstatuen, die auf der Akropolis
von Athen gefunden wurden (Abbildung S. 44)