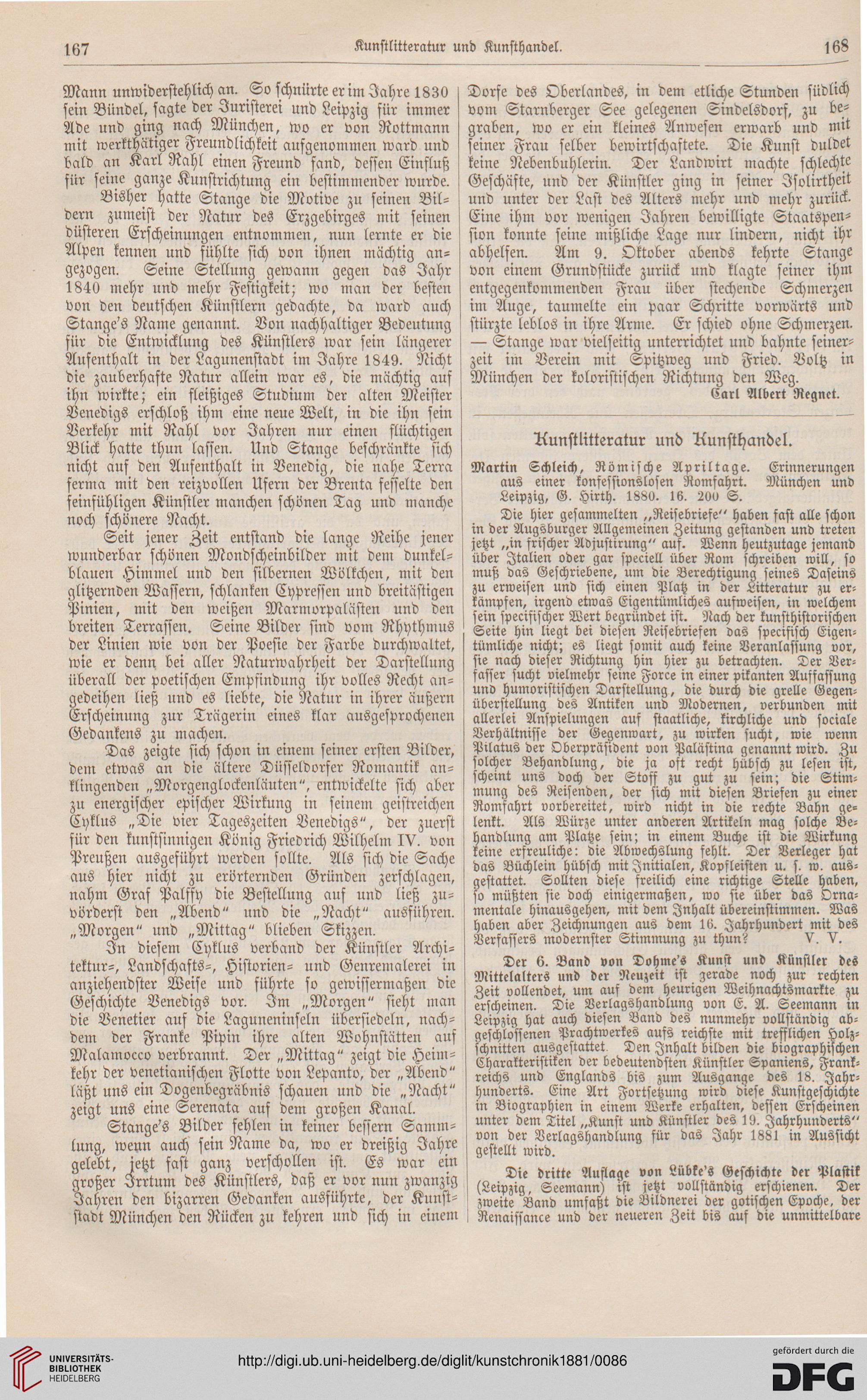167
Kunstlitteratur und Kunsthandel.
168
Mann unwiderstehlich an. So schnürte er im Jahre 1830
sein Bündel, sagte der Juristerei und Leipzig für immer
Ade und ging nach München, wo er von Rottmann
mit werkthätiger Freundlichkeit aufgenommen ward und
bald an Karl Rahl einen Freund fand, dessen Einfluß
für seine ganze Kunstrichtung ein bestimmender wurde.
Bisher hatte Stange die Motive zu seinen Bil-
dern zumeist der Natur des Erzgebirges mit seinen
düsteren Erscheinungen entnommen, nun lernte er die
Alpen kennen und fühlte sich von ihnen mächtig an-
gezogen. Seine Stellung gewann gegen das Jahr
1840 mehr und mehr Festigkeit; wo man der besten
von den deutschen Knnstlern gedachte, da ward auch
Stange's Name genannt. Von nachhaltiger Bedeutung
für die Entwicklung des Künstlers war sein längerer
Aufenthalt in der Lagunenstadt im Jahre 1849. Nicht
die zauberhafte Natur allein war es, die mächtig anf
ihn wirkte; ein fleißiges Studium der alten Meister
Venedigs erschloß ihm eine neue Welt, in die ihn sein
Verkehr mit Rahl vor Jahren nur einen flüchtigen
Blick hatte thun lassen. Und Stange beschränkte sich
nicht auf den Aufenthalt in Venedig, die nahe Terra
serma mit den reizvollen Ufern der Brenta fesselte den
feinfühligen Künstler manchen schönen Tag und manche
noch schönere Nacht.
Seit jener Zeit entstand die lange Reihe jener
wunderbar schönen Mondscheinbilder mit dem dunkel-
blauen Himmel und den silbernen Wölkchen, mit den
glitzernden Wassern, schlanken Cypressen und breitästigen
Pinien, mit den weißen Marmorpalästen und den
breiten Terrassen. Seine Bilder sind vom Rhythmus
der Linien wie von der Poesie der Farbe durchwaltet,
wie er denn bei aller Naturwahrheit der Darstellung
überall der poetischen Empfindung ihr volles Recht an-
gedeihen ließ und es liebte, die Natur in ihrer änßern
Erscheinung zur Trägerin eines klar ausgesprochenen
Gedankens zu machen.
Das zeigte sich schon in einem seiner ersten Bilder,
dem etwas an die ältere Düffeldorfer Nomantik an-
klingenden „Morgenglockenläuten", entwickelte sich aber
zu energischer epischer Wirkung in seinem geistreichen
Cyklus „Die vier Tageszeiten Venedigs", der zuerst
für den kunstsinnigen König Friedrich Wilhelm IV. von
Preußen ausgeführt werden sollte. Als sich die Sache
aus hier nicht zn erörternden Gründen zerschlagen,
nahm Graf Palffy die Bestellung auf und ließ zu-
vörderst den „Abend" und die „Nacht" ausfiihren.
„Morgen" und „Mittag" blieben Skizzen.
Jn diesem Cyklus verband der Künstler Archi-
tektur-, Landschafts-, Historien- und Genremalerei in
anziehendster Weise und führte so gewissermaßen die
Geschichte Venedigs vor. Jm „Morgen" sieht man
die Venetier auf die Laguneninseln übersiedeln, nach-
dem der Franke Pipin ihre alten Wohnstätten auf
Malamocco verbrannt. Der „Mittag" zeigt die Heim-
kehr der venetianischen Flotte von Lepanto, der „Abend"
läßt uns ein Dogenbegräbnis schauen und die „Nacht"
zeigt uns eine Serenata anf dem großen Kanal.
Stange's Bilder fehlen in keiner bessern Samm-
lung, wenn auch sein Name da, wo er dreißig Jahre
gelebt, jetzt fast ganz verschollen ist. Es war ein
großer Jrrtum des Künstlers, daß er vor nun zwanzig
Jahren den bizarren Gedanken ausführte, der Kunst-
stadt München den Rücken zu kehren und sich in einem
Dorfe des Oberlandes, in dem etliche Stunden südlich
vom Starnberger See gelegenen Sindelsdorf, zu be-
graben, wo er ein kleines Anwesen erwarb und nsit
seiner Frau selber bewirtschaftete. Die Kunst duldet
keine Nebenbuhlerin. Der Landwirt machte schlechte
Geschäfte, und der Künstler ging in seiner Jsolirtheit
und unter der Last des Alters mehr und mehr zurück-
Eine ihm vor wenigen Jahren bewilligte Staatspen-
sion konnte seine mißliche Lage nur lindern, nicht ihr
abhelfen. Am 9. Oktober abends kehrte Stange
von einem Grundstücke zurück und klagte seiner ihm
entgegenkommenden Frau über stechende Schmerzen
im Auge, taumelte ein paar Schritte vorwärts und
stürzte leblos in ihre Arme. Er schied ohne Schmerzen.
— Stange war vielseitig unterrichtet und bahnte seiner-
zeit im Verein mit Spitzweg und Fried. Voltz in
München der koloristischen Richtung den Weg.
Carl Albert Regnet.
Aunstlitteratur und Aunsthandel.
Martin Schleich, Römische Apriltage. Erinnerungen
aus einer konfessionslosen Romfahrt. München und
Leipzig, G. Hirth. 1880. 16. 200 S.
Die hier gesammelten „Reisebriefe" haben fast alle schon
in der Augsburger Allgemeinen Zeitung gestanden und treten
jetzt „in frischer Adjustirung" auf. Wenn heutzutage jemand
über Jtalien oder gar specisll über Rom schreiben will, so
muß das Geschriebene, um die Berechtigung seines Daseins
zu erweisen und sich einen Platz in der Litteratur zu er-
kämpfen, irgend etwas Eigentümliches aufweisen, in welchem
sein specifischer Wert begründet ist. Nach der kunsthistorischen
Seite hin liegt bei diesen Reisebriesen das specifisch Eigen-
tümliche nichti es liegt somit auch keine Veranlaffung vor,
sie nach dieser Richtung hin hier zu betrachten. Der Ver-
sasser sucht vielmehr seine Force in einer pikanten Auffassung
und humoristischen Darstellung , die durch die grelle Gegen-
überstellung des Antiken und Modernen, verbunden mit
allerlei Anspielungen auf staatliche, kirchliche und sociale
Verhältnisse der Gegenwart, zu wirken sucht, wie wenn
Pilatus der Oberpräsident von Palästina genannt wird. Zu
solcher Behandlung, die ja oft rscht hübsch zu lesen ist,
scheint uns doch der Stoff zu gut zu sein; die Stim-
mung des Reisenden, der stch mit diesen Briefen zu einer
Romfahrt vorbereitet, wird nicht in die rechte Bahn ge-
lenkt. Als Würze unter anderen Artikeln mag solche Be-
handlung am Platze sein; in einem Buche ist die Wirkung
keine ersreuliche: die Abwechslung fehlt. Der Verleger hat
das Büchlein hübsch mit Jnitialen, Kopfleisten u. s. w. aus-
gestattet. Sollten diese freilich eine richtige Stelle haben,
so müßten ste doch einigermaßen, wo sie über das Orna-
mentale hinausgehen, mit dem Jnhalt übereinstimmen. Was
haben aber Zeichnungen aus dem 16. Jahrhundert mit des
Verfassers modernster Stimmung zu thun? V. V.
Der 6. Band von Dohme's Kunst und Künfller des
Mittelalters und der Neuzeit ist zerade noch zur rechten
Zeit vollendet, um auf dem heurigen Weihnachtsmarkte zu
erscheinen. Die Verlagshandlung von E. A. Seemann m
Leipzig hat auch diesen Band des nunmehr vollständig ab-
geschlossenen Prachtwerkes auss reichste mit trefflichen Holz-
schnitten ausgestattet Den Jnhalt bilden die biographischen
Charakteristiken der bedeutendsten Künstler Spaniens, Frank-
reichs und Englands bis zum Ausgange des 18. Jahr-
hunderts. Eine Art Fortsetzung wird diese Kunstgeschichte
in Biographien in einem Wsrke erhalten, dessen Erscheinen
unter dem Titel „Kunst und Künstler dss 19. Jahrhunderts"
von der Verlagshandlung für das Jahr 1881 tn Aussicht
gestellt wird.
Die dritte Auflage von Lübke's Geschichte Ler Plastik
(Leipzig, Seemann) ist jetzt vollständig erschienen. Der
zweite Band umfatzt die Bildnerei der gotischen Epoche, der
! Renaissance und der neueren Zeit bis auf die unmittelbare
Kunstlitteratur und Kunsthandel.
168
Mann unwiderstehlich an. So schnürte er im Jahre 1830
sein Bündel, sagte der Juristerei und Leipzig für immer
Ade und ging nach München, wo er von Rottmann
mit werkthätiger Freundlichkeit aufgenommen ward und
bald an Karl Rahl einen Freund fand, dessen Einfluß
für seine ganze Kunstrichtung ein bestimmender wurde.
Bisher hatte Stange die Motive zu seinen Bil-
dern zumeist der Natur des Erzgebirges mit seinen
düsteren Erscheinungen entnommen, nun lernte er die
Alpen kennen und fühlte sich von ihnen mächtig an-
gezogen. Seine Stellung gewann gegen das Jahr
1840 mehr und mehr Festigkeit; wo man der besten
von den deutschen Knnstlern gedachte, da ward auch
Stange's Name genannt. Von nachhaltiger Bedeutung
für die Entwicklung des Künstlers war sein längerer
Aufenthalt in der Lagunenstadt im Jahre 1849. Nicht
die zauberhafte Natur allein war es, die mächtig anf
ihn wirkte; ein fleißiges Studium der alten Meister
Venedigs erschloß ihm eine neue Welt, in die ihn sein
Verkehr mit Rahl vor Jahren nur einen flüchtigen
Blick hatte thun lassen. Und Stange beschränkte sich
nicht auf den Aufenthalt in Venedig, die nahe Terra
serma mit den reizvollen Ufern der Brenta fesselte den
feinfühligen Künstler manchen schönen Tag und manche
noch schönere Nacht.
Seit jener Zeit entstand die lange Reihe jener
wunderbar schönen Mondscheinbilder mit dem dunkel-
blauen Himmel und den silbernen Wölkchen, mit den
glitzernden Wassern, schlanken Cypressen und breitästigen
Pinien, mit den weißen Marmorpalästen und den
breiten Terrassen. Seine Bilder sind vom Rhythmus
der Linien wie von der Poesie der Farbe durchwaltet,
wie er denn bei aller Naturwahrheit der Darstellung
überall der poetischen Empfindung ihr volles Recht an-
gedeihen ließ und es liebte, die Natur in ihrer änßern
Erscheinung zur Trägerin eines klar ausgesprochenen
Gedankens zu machen.
Das zeigte sich schon in einem seiner ersten Bilder,
dem etwas an die ältere Düffeldorfer Nomantik an-
klingenden „Morgenglockenläuten", entwickelte sich aber
zu energischer epischer Wirkung in seinem geistreichen
Cyklus „Die vier Tageszeiten Venedigs", der zuerst
für den kunstsinnigen König Friedrich Wilhelm IV. von
Preußen ausgeführt werden sollte. Als sich die Sache
aus hier nicht zn erörternden Gründen zerschlagen,
nahm Graf Palffy die Bestellung auf und ließ zu-
vörderst den „Abend" und die „Nacht" ausfiihren.
„Morgen" und „Mittag" blieben Skizzen.
Jn diesem Cyklus verband der Künstler Archi-
tektur-, Landschafts-, Historien- und Genremalerei in
anziehendster Weise und führte so gewissermaßen die
Geschichte Venedigs vor. Jm „Morgen" sieht man
die Venetier auf die Laguneninseln übersiedeln, nach-
dem der Franke Pipin ihre alten Wohnstätten auf
Malamocco verbrannt. Der „Mittag" zeigt die Heim-
kehr der venetianischen Flotte von Lepanto, der „Abend"
läßt uns ein Dogenbegräbnis schauen und die „Nacht"
zeigt uns eine Serenata anf dem großen Kanal.
Stange's Bilder fehlen in keiner bessern Samm-
lung, wenn auch sein Name da, wo er dreißig Jahre
gelebt, jetzt fast ganz verschollen ist. Es war ein
großer Jrrtum des Künstlers, daß er vor nun zwanzig
Jahren den bizarren Gedanken ausführte, der Kunst-
stadt München den Rücken zu kehren und sich in einem
Dorfe des Oberlandes, in dem etliche Stunden südlich
vom Starnberger See gelegenen Sindelsdorf, zu be-
graben, wo er ein kleines Anwesen erwarb und nsit
seiner Frau selber bewirtschaftete. Die Kunst duldet
keine Nebenbuhlerin. Der Landwirt machte schlechte
Geschäfte, und der Künstler ging in seiner Jsolirtheit
und unter der Last des Alters mehr und mehr zurück-
Eine ihm vor wenigen Jahren bewilligte Staatspen-
sion konnte seine mißliche Lage nur lindern, nicht ihr
abhelfen. Am 9. Oktober abends kehrte Stange
von einem Grundstücke zurück und klagte seiner ihm
entgegenkommenden Frau über stechende Schmerzen
im Auge, taumelte ein paar Schritte vorwärts und
stürzte leblos in ihre Arme. Er schied ohne Schmerzen.
— Stange war vielseitig unterrichtet und bahnte seiner-
zeit im Verein mit Spitzweg und Fried. Voltz in
München der koloristischen Richtung den Weg.
Carl Albert Regnet.
Aunstlitteratur und Aunsthandel.
Martin Schleich, Römische Apriltage. Erinnerungen
aus einer konfessionslosen Romfahrt. München und
Leipzig, G. Hirth. 1880. 16. 200 S.
Die hier gesammelten „Reisebriefe" haben fast alle schon
in der Augsburger Allgemeinen Zeitung gestanden und treten
jetzt „in frischer Adjustirung" auf. Wenn heutzutage jemand
über Jtalien oder gar specisll über Rom schreiben will, so
muß das Geschriebene, um die Berechtigung seines Daseins
zu erweisen und sich einen Platz in der Litteratur zu er-
kämpfen, irgend etwas Eigentümliches aufweisen, in welchem
sein specifischer Wert begründet ist. Nach der kunsthistorischen
Seite hin liegt bei diesen Reisebriesen das specifisch Eigen-
tümliche nichti es liegt somit auch keine Veranlaffung vor,
sie nach dieser Richtung hin hier zu betrachten. Der Ver-
sasser sucht vielmehr seine Force in einer pikanten Auffassung
und humoristischen Darstellung , die durch die grelle Gegen-
überstellung des Antiken und Modernen, verbunden mit
allerlei Anspielungen auf staatliche, kirchliche und sociale
Verhältnisse der Gegenwart, zu wirken sucht, wie wenn
Pilatus der Oberpräsident von Palästina genannt wird. Zu
solcher Behandlung, die ja oft rscht hübsch zu lesen ist,
scheint uns doch der Stoff zu gut zu sein; die Stim-
mung des Reisenden, der stch mit diesen Briefen zu einer
Romfahrt vorbereitet, wird nicht in die rechte Bahn ge-
lenkt. Als Würze unter anderen Artikeln mag solche Be-
handlung am Platze sein; in einem Buche ist die Wirkung
keine ersreuliche: die Abwechslung fehlt. Der Verleger hat
das Büchlein hübsch mit Jnitialen, Kopfleisten u. s. w. aus-
gestattet. Sollten diese freilich eine richtige Stelle haben,
so müßten ste doch einigermaßen, wo sie über das Orna-
mentale hinausgehen, mit dem Jnhalt übereinstimmen. Was
haben aber Zeichnungen aus dem 16. Jahrhundert mit des
Verfassers modernster Stimmung zu thun? V. V.
Der 6. Band von Dohme's Kunst und Künfller des
Mittelalters und der Neuzeit ist zerade noch zur rechten
Zeit vollendet, um auf dem heurigen Weihnachtsmarkte zu
erscheinen. Die Verlagshandlung von E. A. Seemann m
Leipzig hat auch diesen Band des nunmehr vollständig ab-
geschlossenen Prachtwerkes auss reichste mit trefflichen Holz-
schnitten ausgestattet Den Jnhalt bilden die biographischen
Charakteristiken der bedeutendsten Künstler Spaniens, Frank-
reichs und Englands bis zum Ausgange des 18. Jahr-
hunderts. Eine Art Fortsetzung wird diese Kunstgeschichte
in Biographien in einem Wsrke erhalten, dessen Erscheinen
unter dem Titel „Kunst und Künstler dss 19. Jahrhunderts"
von der Verlagshandlung für das Jahr 1881 tn Aussicht
gestellt wird.
Die dritte Auflage von Lübke's Geschichte Ler Plastik
(Leipzig, Seemann) ist jetzt vollständig erschienen. Der
zweite Band umfatzt die Bildnerei der gotischen Epoche, der
! Renaissance und der neueren Zeit bis auf die unmittelbare