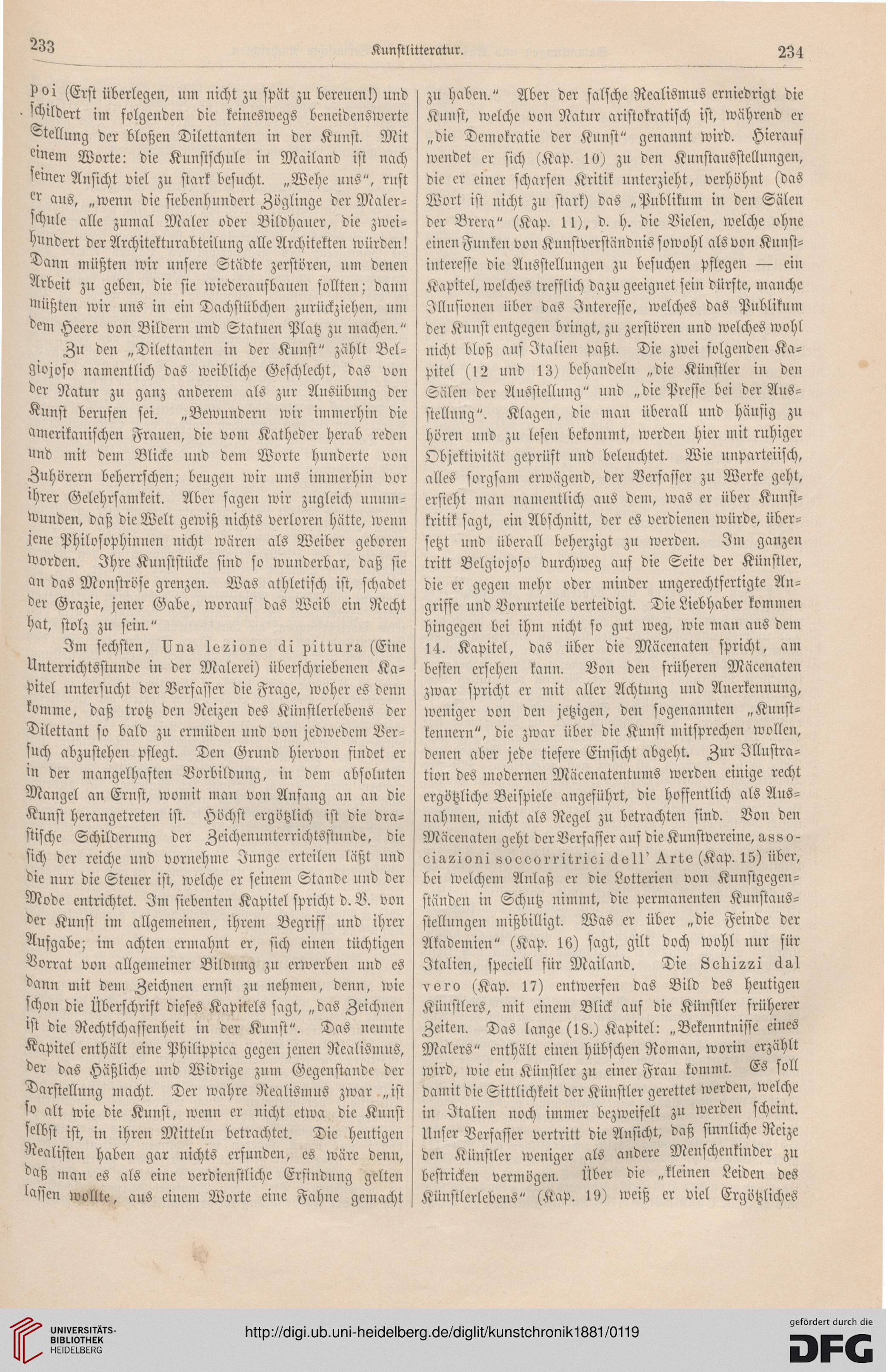Kunstlitteratur.
234
233
Pvi (Erst überlegen, um nicht zu spät zu Lereuen!) und
- ichildert im folgendeu die keineswegs bcneidenswerte
^lellung der bloßen Dilettantcn in der Kunst. Mit
^inem Worte: die Kunstschule in Mailand ist nach
inner Ansicht viel zu stark besucht. „Wehe uns", ruft
^ aus, „wenn die siebenhundert Zöglinge der Maler-
ichule alle zumal Maler oder Bildhauer, die zwei-
hnndert der Architekturabteilung alle Architekten würden!
Dann müßten wir unsere Städte zerstören, um denen
Arbeit zu geben, die sie wiederaufbauen sollten; dann
^llißten wir uns in ein Dachstübchen zurückziehen, um
^in Heere von Bildern und Statuen Platz zu machen."
Zu den „Dilettanten iu der Kunst" zählt Bel-
giojoso namentlich das weibliche Geschlecht, das vvn
der Natur zu ganz anderem als zur Ausübung der
Kunst berufen sei. „Bewundern wir immerhin die
ainerikanischen Frauen, die voni Katheder herab reden
nnd mit dem Blicke und dem Worte hunderte von
Zuhörern beherrschen; beugen wir uns immerhin vor
chrer Gelehrsamkeit. Aber sagen wir zugleich unum-
wunden, daß die Welt gewiß nichts verloren hätte, wenn
jene Philosophinnen nicht wären als Weiber geboren
llwrden. Jhre Kunststücke sind so wunderbar, daß sie
an das Monströse grenzen. Was athlelisch ist, schadet
der Grazie, jener Gabe, worauf das Weib ein Recht
hat, stolz zu scin."
Jm sechsten, IIuu lorious cki xitturs. (Eine
llnterrichtsstunde in der Malerei) überschriebenen Ka-
hitel untersucht der Verfasser die Frage, woher es denn
komme, daß trotz den Reizen des Künstlerlebens der
Dilettant so bald zu ermüden und von jedwedem Ber-
such abzustehen pflegt. Den Grund hiervon findet er
lli der mangelhaften Borbildung, in dem absoluten
Mangel an Ernst, womit man von Anfang an an die
Kunst herangetreten ist. Höchst ergötzlich ist die dra-
stische Schilderung der Zeichenunterrichtsstunde, die
sich der reiche und vornehme Junge erteilen läßt und
die nur die Steuer ist, welche er seinem Stande und der
Mode entrichtet. Jm siebenten Kapitel spricht d. V. von
der Kunst im allgemeinen, ihrem Begrisf und ihrer
2lufgabe; im achten ermahnt er, sich einen tüchtigen
Vorrat von allgemeiner Bildung zu erwerben und es
dann mit dem Zeichnen ernst zu nehmen, denn, wie
schon dic Überschrift dieses Kapitcls sagt, „das Zeichncn
ist die Rechtschaffenheit in der Kunst". Das neunte
Kapitel enthält eine Philippica gegen jenen Realismus,
^er das Häßliche und Widrige zum Gegenstande der
Darstellung macht. Der wahre Realismus zwar „ist
so alt wie die Kunst, wenn er nicht etwa die Kunst
selbst jst, in ihren Mitteln betrachtct. Dic heutigen
diealisten haben gar nichts erfundcn, es wäre denn,
^aß man es als eine verdienstliche Erfindung gelten
chssen wollte, aus einem Worte eine Fahne gemacht ^
zu haben." Aber der falsche Realismus erniedrigt die
Kunst, welche von Natur aristokratisch ist, während er
„die Demokratie der Kunst" genannt wird. Hierauf
wendet er sich (Kap. 10) zu den Kunstausstellungen,
die er einer scharfen Kritik unterzieht, verhöhnt (das
Wvrt ist nicht zu stark) das „Pnblikum in deu Sälen
der Brera" (Kap. 11), d. h. die Vielen, welche ohne
einenFunken von Kunstverständnis sowohl alsvon Kunst-
interesse die Ausstellungen zu besuchen Pflegen — eiu
Kapitel, welches trefflich dazu geeignet sein dürfte, manchc
Jllusionen über das Jnteresse, welches das Publikum
der Kunst entgegen bringt, zu zerstören und welches wohl
uicht bloß auf Jtalien paßt. Die zwei folgenden Ka-
pitel (12 und 13) behandeln „die Künstler in den
Sälen der Ausstellung" und „die Presse bei der Aus-
stellung". Klagen, die man Uberall und häufig zu
HLren und zu lesen bekommt, werden hier mit ruhiger
Objektivität geprüft und beleuchtet. Wie unparteiisch,
alles sorgsam erwägend, der Verfasser zu Werke geht,
ersieht man namentlich aus dem, was er über Kunst-
kritik sagt, ein Abschnitt, der es verdienen würde, über-
setzt und überall beherzigt zu werden. Jm ganzen
tritt Belgiojoso durchweg auf die Seite der Künstler,
die er gegen mehr oder minder ungerechtfertigte An-
griffe und Vorurteile verteidigt. Die Liebhaber kommen
hingegen bei ihm nicht so gut weg, wie man aus dem
14. Kapitel, das über die Mäcenaten spricht, am
besten ersehen kann. Von den früheren Mäcenaten
zwar spricht er mit aller Achtung und Anerkennung,
weniger von den jetzigen, den sogenannten „Kunst-
kennern", die zwar Lber die Kunst mitsprechen wvlleii,
denen aber jede tiefere Einsicht abgeht. Zur Jllustra-
tivn des mvdernen Mäcenatentums werden einige recht
ergötzliche Beispiele angeführt, die hoffentlich als Aus-
nahmen, nicht als Regel zu betrachten sind. Von den
Mäcenaten geht derVerfasser auf dieKunstvereine, asso-
oiaLioni soooorritrivi äoll' L^rts (Kap. 15) Lber,
bei welchem Anlaß er die Lotterien von Kunstgegen-
ständen in Schutz nimmt, die permanenten Kunstaus-
stellungen mißbilligt. Was er Uber „die Feinde der
Akademien" (Kap. 16) sagt, gilt doch wohl nur für
Jtalien, speciell für Mailand. Die LolliL^i äal
voro (Kap. 17) entwerfen das Bild des heutigen
Künstlers, mit einem Blick auf die Künstler früherer
Zeiten. Das lange (18.) Kapitel: „Bekenntnisse eines
Malers" enthält einen hübschen Roman, worin erzählt
wird, wie ein Künstler zu einer Frau kommt. Es soll
damit die Sittlichkeit der Küustler gcrettet werden, Welche
in Jtalien noch immer bezweifelt zu werden schcint.
Ilnser Berfasser vertritt die Ansicht, daß sinnliche Reize
dcn Kllnstler weniger als andcre Menschenkinder zu
bestricken vermögen. Über die „klcinen Leiden des
Künstlerlebens" (Kap. 19) weiß er viel Ergötzliches
234
233
Pvi (Erst überlegen, um nicht zu spät zu Lereuen!) und
- ichildert im folgendeu die keineswegs bcneidenswerte
^lellung der bloßen Dilettantcn in der Kunst. Mit
^inem Worte: die Kunstschule in Mailand ist nach
inner Ansicht viel zu stark besucht. „Wehe uns", ruft
^ aus, „wenn die siebenhundert Zöglinge der Maler-
ichule alle zumal Maler oder Bildhauer, die zwei-
hnndert der Architekturabteilung alle Architekten würden!
Dann müßten wir unsere Städte zerstören, um denen
Arbeit zu geben, die sie wiederaufbauen sollten; dann
^llißten wir uns in ein Dachstübchen zurückziehen, um
^in Heere von Bildern und Statuen Platz zu machen."
Zu den „Dilettanten iu der Kunst" zählt Bel-
giojoso namentlich das weibliche Geschlecht, das vvn
der Natur zu ganz anderem als zur Ausübung der
Kunst berufen sei. „Bewundern wir immerhin die
ainerikanischen Frauen, die voni Katheder herab reden
nnd mit dem Blicke und dem Worte hunderte von
Zuhörern beherrschen; beugen wir uns immerhin vor
chrer Gelehrsamkeit. Aber sagen wir zugleich unum-
wunden, daß die Welt gewiß nichts verloren hätte, wenn
jene Philosophinnen nicht wären als Weiber geboren
llwrden. Jhre Kunststücke sind so wunderbar, daß sie
an das Monströse grenzen. Was athlelisch ist, schadet
der Grazie, jener Gabe, worauf das Weib ein Recht
hat, stolz zu scin."
Jm sechsten, IIuu lorious cki xitturs. (Eine
llnterrichtsstunde in der Malerei) überschriebenen Ka-
hitel untersucht der Verfasser die Frage, woher es denn
komme, daß trotz den Reizen des Künstlerlebens der
Dilettant so bald zu ermüden und von jedwedem Ber-
such abzustehen pflegt. Den Grund hiervon findet er
lli der mangelhaften Borbildung, in dem absoluten
Mangel an Ernst, womit man von Anfang an an die
Kunst herangetreten ist. Höchst ergötzlich ist die dra-
stische Schilderung der Zeichenunterrichtsstunde, die
sich der reiche und vornehme Junge erteilen läßt und
die nur die Steuer ist, welche er seinem Stande und der
Mode entrichtet. Jm siebenten Kapitel spricht d. V. von
der Kunst im allgemeinen, ihrem Begrisf und ihrer
2lufgabe; im achten ermahnt er, sich einen tüchtigen
Vorrat von allgemeiner Bildung zu erwerben und es
dann mit dem Zeichnen ernst zu nehmen, denn, wie
schon dic Überschrift dieses Kapitcls sagt, „das Zeichncn
ist die Rechtschaffenheit in der Kunst". Das neunte
Kapitel enthält eine Philippica gegen jenen Realismus,
^er das Häßliche und Widrige zum Gegenstande der
Darstellung macht. Der wahre Realismus zwar „ist
so alt wie die Kunst, wenn er nicht etwa die Kunst
selbst jst, in ihren Mitteln betrachtct. Dic heutigen
diealisten haben gar nichts erfundcn, es wäre denn,
^aß man es als eine verdienstliche Erfindung gelten
chssen wollte, aus einem Worte eine Fahne gemacht ^
zu haben." Aber der falsche Realismus erniedrigt die
Kunst, welche von Natur aristokratisch ist, während er
„die Demokratie der Kunst" genannt wird. Hierauf
wendet er sich (Kap. 10) zu den Kunstausstellungen,
die er einer scharfen Kritik unterzieht, verhöhnt (das
Wvrt ist nicht zu stark) das „Pnblikum in deu Sälen
der Brera" (Kap. 11), d. h. die Vielen, welche ohne
einenFunken von Kunstverständnis sowohl alsvon Kunst-
interesse die Ausstellungen zu besuchen Pflegen — eiu
Kapitel, welches trefflich dazu geeignet sein dürfte, manchc
Jllusionen über das Jnteresse, welches das Publikum
der Kunst entgegen bringt, zu zerstören und welches wohl
uicht bloß auf Jtalien paßt. Die zwei folgenden Ka-
pitel (12 und 13) behandeln „die Künstler in den
Sälen der Ausstellung" und „die Presse bei der Aus-
stellung". Klagen, die man Uberall und häufig zu
HLren und zu lesen bekommt, werden hier mit ruhiger
Objektivität geprüft und beleuchtet. Wie unparteiisch,
alles sorgsam erwägend, der Verfasser zu Werke geht,
ersieht man namentlich aus dem, was er über Kunst-
kritik sagt, ein Abschnitt, der es verdienen würde, über-
setzt und überall beherzigt zu werden. Jm ganzen
tritt Belgiojoso durchweg auf die Seite der Künstler,
die er gegen mehr oder minder ungerechtfertigte An-
griffe und Vorurteile verteidigt. Die Liebhaber kommen
hingegen bei ihm nicht so gut weg, wie man aus dem
14. Kapitel, das über die Mäcenaten spricht, am
besten ersehen kann. Von den früheren Mäcenaten
zwar spricht er mit aller Achtung und Anerkennung,
weniger von den jetzigen, den sogenannten „Kunst-
kennern", die zwar Lber die Kunst mitsprechen wvlleii,
denen aber jede tiefere Einsicht abgeht. Zur Jllustra-
tivn des mvdernen Mäcenatentums werden einige recht
ergötzliche Beispiele angeführt, die hoffentlich als Aus-
nahmen, nicht als Regel zu betrachten sind. Von den
Mäcenaten geht derVerfasser auf dieKunstvereine, asso-
oiaLioni soooorritrivi äoll' L^rts (Kap. 15) Lber,
bei welchem Anlaß er die Lotterien von Kunstgegen-
ständen in Schutz nimmt, die permanenten Kunstaus-
stellungen mißbilligt. Was er Uber „die Feinde der
Akademien" (Kap. 16) sagt, gilt doch wohl nur für
Jtalien, speciell für Mailand. Die LolliL^i äal
voro (Kap. 17) entwerfen das Bild des heutigen
Künstlers, mit einem Blick auf die Künstler früherer
Zeiten. Das lange (18.) Kapitel: „Bekenntnisse eines
Malers" enthält einen hübschen Roman, worin erzählt
wird, wie ein Künstler zu einer Frau kommt. Es soll
damit die Sittlichkeit der Küustler gcrettet werden, Welche
in Jtalien noch immer bezweifelt zu werden schcint.
Ilnser Berfasser vertritt die Ansicht, daß sinnliche Reize
dcn Kllnstler weniger als andcre Menschenkinder zu
bestricken vermögen. Über die „klcinen Leiden des
Künstlerlebens" (Kap. 19) weiß er viel Ergötzliches