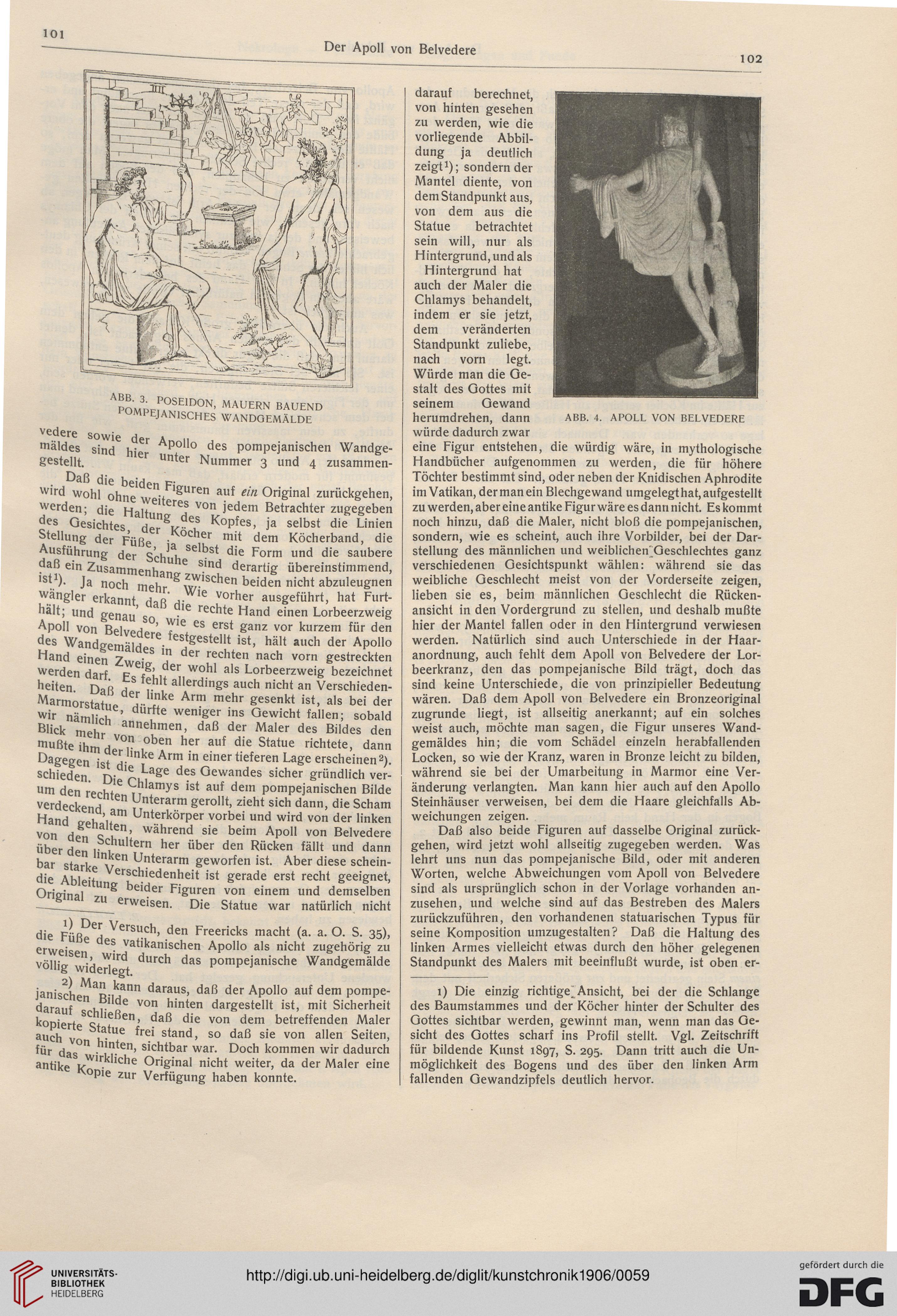101
Der Apoll von Belvedere
102
ABB. 3. POSEIDON, MAUERN BAUEND
POMPEJAN1SCHES WANDGEMÄLDE
mäldes Tind^ Vf" ^po"° des pompejanischen Wandge-
gestellt unter Nummer 3 und 4 zusammen-
wird^ohf ohn!ideniFigUren auf ein Original zurückgehen,
werden- die h We es von )edem Betrachter zugegeben
des Gesichtes, SV'u K°pfeS' * selbst die Li"ien
mit dem Köcherband, die
Stellung der Füße, ja selbst die Form und die saubere
Ausfuhrung der Schuhe sind derartig übereinstimmend,
daß ein Zusammenhang zwischen beiden nicht abzuleugnen
ist1). Ja noch mehr. Wie vorher ausgeführt, hat Furt-
wangler erkannt, daß die rechte Hand einen Lorbeerzweig
halt; und genau so, wie es erst ganz vor kurzem für den
Apoll von Belvedere festgestellt ist, hält auch der Apollo
des Wandgemäldes in der rechten nach vorn gestreckten
Hand einen Zweig, der wohl als Lorbeerzweig bezeichnet
werden darf. Es fehlt allerdings auch nicht an Verschieden-
heiten. Daß der linke Arm mehr gesenkt ist, als bei der
Marmorstatue, dürfte weniger ins Gewicht fallen; sobald
wir nämlich annehmen, daß der Maler des Bildes den
Blick mehr von oben her auf die Statue richtete, dann
mußte ihm der linke Arm in einer tieferen Lage erscheinen2).
Dagegen ist die Lage des Gewandes sicher gründlich ver-
schieden. Die Chlamys ist auf dem pompejanischen Bilde
um den rechten Unterarm gerollt, zieht sich dann, die Scham
verdeckend, am Unterkörper vorbei und wird von der linken
Hand gehalten, während sie beim Apoll von Belvedere
von den Schultern her über den Rücken fallt und dann
über den linken Unterarm geworfen ist. Aber diese schein-
bar starke Verschiedenheit ist gerade erst recht geeignet,
die Ableitung beider Figuren von einem und demselben
Original zu erweisen. Die Statue war naturlich nicht
1) Der Versuch, den Freericks macht (a. a. O. S. 35).
die Füße des vatikanischen Apollo als nicht zugehörig zu
erweisen, wird durch das pompejanische Wandgemälde
völlig widerlegt.
2) Man kann daraus, daß der Apollo auf dem P°mPe"
janischen Bilde von hinten dargestellt ist, mlt j510"""6"
darauf schließen, daß die von dem betreffenden Maler
kopierte Statue frei stand, so daß sie von allen Seiten
auch von hinten, sichtbar war. Doch kommen wir dadurcn
{ür das wirkliche Original nicht weiter, da der Maler eine
antike Kopie zur Verfügung haben konnte.
ABB. 4. APOLL VON BELVEDERE
darauf berechnet,
von hinten gesehen
zu werden, wie die
vorliegende Abbil-
dung ja deutlich
zeigt1); sondern der
Mantel diente, von
dem Standpunkt aus,
von dem aus die
Statue betrachtet
sein will, nur als
Hintergrund, und als
Hintergrund hat
auch der Maler die
Chlamys behandelt,
indem er sie jetzt,
dem veränderten
Standpunkt zuliebe,
nach vorn legt.
Würde man die Ge-
stalt des Gottes mit
seinem Gewand
herumdrehen, dann
würde dadurch zwar
eine Figur entstehen, die würdig wäre, in mythologische
Handbücher aufgenommen zu werden, die für höhere
Töchter bestimmt sind, oder neben der Knidischen Aphrodite
im Vatikan, der man ein Blechgewand umgelegt hat, aufgestellt
zu werden, aber eine antike Figur wäre es dann nicht. Es kommt
noch hinzu, daß die Maler, nicht bloß die pompejanischen,
sondern, wie es scheint, auch ihre Vorbilder, bei der Dar-
stellung des männlichen und weiblichen Geschlechtes ganz
verschiedenen Gesichtspunkt wählen: während sie das
weibliche Geschlecht meist von der Vorderseite zeigen,
lieben sie es, beim männlichen Geschlecht die Rücken-
ansicht in den Vordergrund zu stellen, und deshalb mußte
hier der Mantel fallen oder in den Hintergrund verwiesen
werden. Natürlich sind auch Unterschiede in der Haar-
anordnung, auch fehlt dem Apoll von Belvedere der Lor-
beerkranz, den das pompejanische Bild trägt, doch das
sind keine Unterschiede, die von prinzipieller Bedeutung
wären. Daß dem Apoll von Belvedere ein Bronzeoriginal
zugrunde liegt, ist allseitig anerkannt; auf ein solches
weist auch, möchte man sagen, die Figur unseres Wand-
gemäldes hin; die vom Schädel einzeln herabfallenden
Locken, so wie der Kranz, waren in Bronze leicht zu bilden,
während sie bei der Umarbeitung in Marmor eine Ver-
änderung verlangten. Man kann hier auch auf den Apollo
Steinhäuser verweisen, bei dem die Haare gleichfalls Ab-
weichungen zeigen.
Daß also beide Figuren auf dasselbe Original zurück-
gehen, wird jetzt wohl allseitig zugegeben werden. Was
lehrt uns nun das pompejanische Bild, oder mit anderen
Worten, welche Abweichungen vom Apoll von Belvedere
sind als ursprünglich schon in der Vorlage vorhanden an-
zusehen, und welche sind auf das Bestreben des Malers
zurückzuführen, den vorhandenen statuarischen Typus für
seine Komposition umzugestalten? Daß die Haltung des
linken Armes vielleicht etwas durch den höher gelegenen
Standpunkt des Malers mit beeinflußt wurde, ist oben er-
1) Die einzig richtige^ Ansicht, bei der die Schlange
des Baumstammes und der Köcher hinter der Schulter des
Gottes sichtbar werden, gewinnt man, wenn man das Ge-
sicht des Gottes scharf ins Profil stellt. Vgl. Zeitschrift
für bildende Kunst 1897, S. 295. Dann tritt auch die Un-
möglichkeit des Bogens und des über den linken Arm
fallenden Gewandzipfels deutlich hervor.
Der Apoll von Belvedere
102
ABB. 3. POSEIDON, MAUERN BAUEND
POMPEJAN1SCHES WANDGEMÄLDE
mäldes Tind^ Vf" ^po"° des pompejanischen Wandge-
gestellt unter Nummer 3 und 4 zusammen-
wird^ohf ohn!ideniFigUren auf ein Original zurückgehen,
werden- die h We es von )edem Betrachter zugegeben
des Gesichtes, SV'u K°pfeS' * selbst die Li"ien
mit dem Köcherband, die
Stellung der Füße, ja selbst die Form und die saubere
Ausfuhrung der Schuhe sind derartig übereinstimmend,
daß ein Zusammenhang zwischen beiden nicht abzuleugnen
ist1). Ja noch mehr. Wie vorher ausgeführt, hat Furt-
wangler erkannt, daß die rechte Hand einen Lorbeerzweig
halt; und genau so, wie es erst ganz vor kurzem für den
Apoll von Belvedere festgestellt ist, hält auch der Apollo
des Wandgemäldes in der rechten nach vorn gestreckten
Hand einen Zweig, der wohl als Lorbeerzweig bezeichnet
werden darf. Es fehlt allerdings auch nicht an Verschieden-
heiten. Daß der linke Arm mehr gesenkt ist, als bei der
Marmorstatue, dürfte weniger ins Gewicht fallen; sobald
wir nämlich annehmen, daß der Maler des Bildes den
Blick mehr von oben her auf die Statue richtete, dann
mußte ihm der linke Arm in einer tieferen Lage erscheinen2).
Dagegen ist die Lage des Gewandes sicher gründlich ver-
schieden. Die Chlamys ist auf dem pompejanischen Bilde
um den rechten Unterarm gerollt, zieht sich dann, die Scham
verdeckend, am Unterkörper vorbei und wird von der linken
Hand gehalten, während sie beim Apoll von Belvedere
von den Schultern her über den Rücken fallt und dann
über den linken Unterarm geworfen ist. Aber diese schein-
bar starke Verschiedenheit ist gerade erst recht geeignet,
die Ableitung beider Figuren von einem und demselben
Original zu erweisen. Die Statue war naturlich nicht
1) Der Versuch, den Freericks macht (a. a. O. S. 35).
die Füße des vatikanischen Apollo als nicht zugehörig zu
erweisen, wird durch das pompejanische Wandgemälde
völlig widerlegt.
2) Man kann daraus, daß der Apollo auf dem P°mPe"
janischen Bilde von hinten dargestellt ist, mlt j510"""6"
darauf schließen, daß die von dem betreffenden Maler
kopierte Statue frei stand, so daß sie von allen Seiten
auch von hinten, sichtbar war. Doch kommen wir dadurcn
{ür das wirkliche Original nicht weiter, da der Maler eine
antike Kopie zur Verfügung haben konnte.
ABB. 4. APOLL VON BELVEDERE
darauf berechnet,
von hinten gesehen
zu werden, wie die
vorliegende Abbil-
dung ja deutlich
zeigt1); sondern der
Mantel diente, von
dem Standpunkt aus,
von dem aus die
Statue betrachtet
sein will, nur als
Hintergrund, und als
Hintergrund hat
auch der Maler die
Chlamys behandelt,
indem er sie jetzt,
dem veränderten
Standpunkt zuliebe,
nach vorn legt.
Würde man die Ge-
stalt des Gottes mit
seinem Gewand
herumdrehen, dann
würde dadurch zwar
eine Figur entstehen, die würdig wäre, in mythologische
Handbücher aufgenommen zu werden, die für höhere
Töchter bestimmt sind, oder neben der Knidischen Aphrodite
im Vatikan, der man ein Blechgewand umgelegt hat, aufgestellt
zu werden, aber eine antike Figur wäre es dann nicht. Es kommt
noch hinzu, daß die Maler, nicht bloß die pompejanischen,
sondern, wie es scheint, auch ihre Vorbilder, bei der Dar-
stellung des männlichen und weiblichen Geschlechtes ganz
verschiedenen Gesichtspunkt wählen: während sie das
weibliche Geschlecht meist von der Vorderseite zeigen,
lieben sie es, beim männlichen Geschlecht die Rücken-
ansicht in den Vordergrund zu stellen, und deshalb mußte
hier der Mantel fallen oder in den Hintergrund verwiesen
werden. Natürlich sind auch Unterschiede in der Haar-
anordnung, auch fehlt dem Apoll von Belvedere der Lor-
beerkranz, den das pompejanische Bild trägt, doch das
sind keine Unterschiede, die von prinzipieller Bedeutung
wären. Daß dem Apoll von Belvedere ein Bronzeoriginal
zugrunde liegt, ist allseitig anerkannt; auf ein solches
weist auch, möchte man sagen, die Figur unseres Wand-
gemäldes hin; die vom Schädel einzeln herabfallenden
Locken, so wie der Kranz, waren in Bronze leicht zu bilden,
während sie bei der Umarbeitung in Marmor eine Ver-
änderung verlangten. Man kann hier auch auf den Apollo
Steinhäuser verweisen, bei dem die Haare gleichfalls Ab-
weichungen zeigen.
Daß also beide Figuren auf dasselbe Original zurück-
gehen, wird jetzt wohl allseitig zugegeben werden. Was
lehrt uns nun das pompejanische Bild, oder mit anderen
Worten, welche Abweichungen vom Apoll von Belvedere
sind als ursprünglich schon in der Vorlage vorhanden an-
zusehen, und welche sind auf das Bestreben des Malers
zurückzuführen, den vorhandenen statuarischen Typus für
seine Komposition umzugestalten? Daß die Haltung des
linken Armes vielleicht etwas durch den höher gelegenen
Standpunkt des Malers mit beeinflußt wurde, ist oben er-
1) Die einzig richtige^ Ansicht, bei der die Schlange
des Baumstammes und der Köcher hinter der Schulter des
Gottes sichtbar werden, gewinnt man, wenn man das Ge-
sicht des Gottes scharf ins Profil stellt. Vgl. Zeitschrift
für bildende Kunst 1897, S. 295. Dann tritt auch die Un-
möglichkeit des Bogens und des über den linken Arm
fallenden Gewandzipfels deutlich hervor.