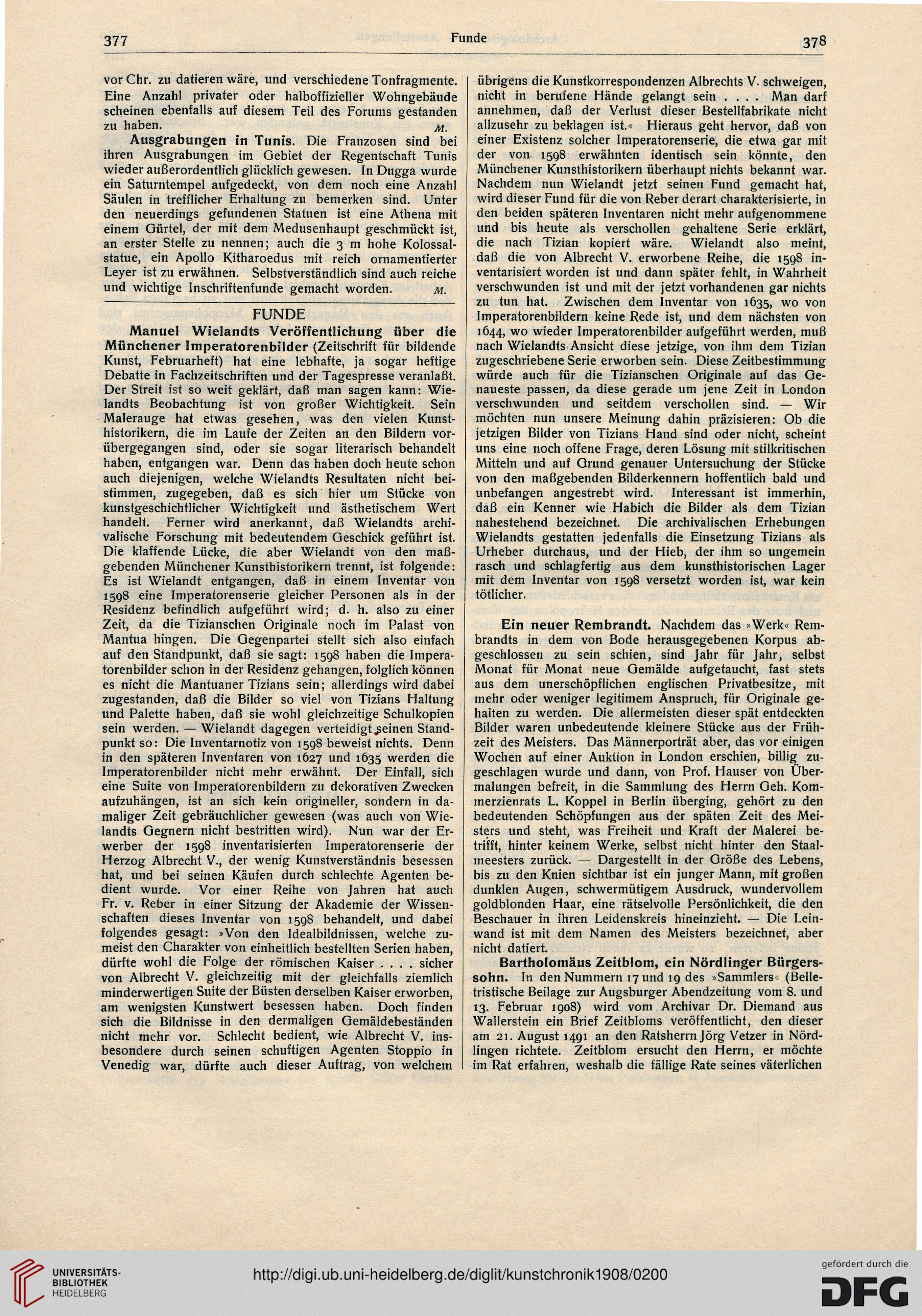377
Funde
378
vor Chr. zu datieren wäre, und verschiedene Tonfragmente.
Eine Anzahl privater oder halboffizieller Wohngebäude
scheinen ebenfalls auf diesem Teil des Forums gestanden
zu haben. M
Ausgrabungen in Tunis. Die Franzosen sind bei
ihren Ausgrabungen im Gebiet der Regentschaft Tunis
wieder außerordentlich glücklich gewesen. In Dugga wurde
ein Saturntempel aufgedeckt, von dem noch eine Anzahl
Säulen in trefflicher Erhaltung zu bemerken sind. Unter
den neuerdings gefundenen Statuen ist eine Athena mit
einem Gürtel, der mit dem Medusenhaupt geschmückt ist,
an erster Stelle zu nennen; auch die 3 m hohe Kolossal-
statue, ein Apollo Kitharoedus mit reich ornamentierter
Leyer ist zu erwähnen. Selbstverständlich sind auch reiche
und wichtige Inschriftenfunde gemacht worden. m.
FUNDE
Manuel Wielandts Veröffentlichung über die
Münchener Imperatorenbilder (Zeitschrift für bildende
Kunst, Februarheft) hat eine lebhafte, ja sogar heftige
Debatte in Fachzeitschriften und der Tagespresse veranlaßt.
Der Streit ist so weit geklärt, daß man sagen kann: Wie-
landts Beobachtung ist von großer Wichtigkeit. Sein
Malerauge hat etwas gesehen, was den vielen Kunst-
historikern, die im Laufe der Zeiten an den Bildern vor-
übergegangen sind, oder sie sogar literarisch behandelt
haben, entgangen war. Denn das haben doch heute schon
auch diejenigen, welche Wielandts Resultaten nicht bei-
stimmen, zugegeben, daß es sich hier um Stücke von
kunstgeschichtlicher Wichtigkeit und ästhetischem Wert
handelt. Ferner wird anerkannt, daß Wielandts archi-
valische Forschung mit bedeutendem Geschick geführt ist.
Die klaffende Lücke, die aber Wielandt von den maß-
gebenden Münchener Kunsthistorikern trennt, ist folgende:
Es ist Wielandt entgangen, daß in einem Inventar von
1598 eine Imperatorenserie gleicher Personen als in der
Residenz befindlich aufgeführt wird; d. h. also zu einer
Zeit, da die Tizianschen Originale noch im Palast von
Mantua hingen. Die Gegenpartei stellt sich also einfach
auf den Standpunkt, daß sie sagt: 1598 haben die Impera-
torenbilder schon in der Residenz gehangen, folglich können
es nicht die Mantuaner Tizians sein; allerdings wird dabei
zugestanden, daß die Bilder so viel von Tizians Haltung
und Palette haben, daß sie wohl gleichzeitige Schulkopien
sein werden. — Wielandt dagegen verteidigt feinen Stand-
punkt so: Die Inventarnotiz von 1598 beweist nichts. Denn
in den späteren Inventaren von 1627 und 1635 werden die
Imperatorenbilder nicht mehr erwähnt. Der Einfall, sich
eine Suite von Imperatorenbildern zu dekorativen Zwecken
aufzuhängen, ist an sich kein origineller, sondern in da-
maliger Zeit gebräuchlicher gewesen (was auch von Wie-
landts Gegnern nicht bestritten wird). Nun war der Er-
werber der 1598 inventarisierten Imperatorenserie der
Herzog Albrecht V., der wenig Kunstverständnis besessen
hat, und bei seinen Käufen durch schlechte Agenten be-
dient wurde. Vor einer Reihe von Jahren hat auch
Fr. v. Reber in einer Sitzung der Akademie der Wissen-
schaften dieses Inventar von 1598 behandelt, und dabei
folgendes gesagt: »Von den Idealbildnissen, welche zu-
meist den Charakter von einheitlich bestellten Serien haben,
dürfte wohl die Folge der römischen Kaiser .... sicher
von Albrecht V. gleichzeitig mit der gleichfalls ziemlich
minderwertigen Suite der Büsten derselben Kaiser erworben,
am wenigsten Kunstwert besessen haben. Doch finden
sich die Bildnisse in den dermaligen Gemäldebeständen
nicht mehr vor. Schlecht bedient, wie Albrecht V. ins-
besondere durch seinen schuftigen Agenten Stoppio in
Venedig war, dürfte auch dieser Auftrag, von welchem
übrigens die Kunstkorrespondenzen Albrechts V. schweigen,
nicht in berufene Hände gelangt sein .... Man darf
annehmen, daß der Verlust dieser Bestellfabrikate nicht
allzusehr zu beklagen ist.« Hieraus geht hervor, daß von
einer Existenz solcher Imperatorenserie, die etwa gar mit
der von 1598 erwähnten identisch sein könnte, den
Münchener Kunsthistorikern überhaupt nichts bekannt war.
Nachdem nun Wielandt jetzt seinen Fund gemacht hat,
wird dieser Fund für die von Reber derart charakterisierte, in
den beiden späteren Inventaren nicht mehr aufgenommene
und bis heute als verschollen gehaltene Serie erklärt,
die nach Tizian kopiert wäre. Wielandt also meint,
daß die von Albrecht V. erworbene Reihe, die 1598 in-
ventarisiert worden ist und dann später fehlt, in Wahrheit
verschwunden ist und mit der jetzt vorhandenen gar nichts
zu tun hat. Zwischen dem Inventar von 1635, wo von
Imperatorenbildern keine Rede ist, und dem nächsten von
1644, wo wieder Imperatorenbilder aufgeführt werden, muß
nach Wielandts Ansicht diese jetzige, von ihm dem Tizian
zugeschriebene Serie erworben sein. Diese Zeitbestimmung
würde auch für die Tizianschen Originale auf das Ge-
naueste passen, da diese gerade um jene Zeit in London
verschwunden und seitdem verschollen sind. — Wir
möchten nun unsere Meinung dahin präzisieren: Ob die
jetzigen Bilder von Tizians Hand sind oder nicht, scheint
uns eine noch offene Frage, deren Lösung mit stilkritischen
Mitteln und auf Grund genauer Untersuchung der Stücke
von den maßgebenden Bilderkennern hoffentlich bald und
unbefangen angestrebt wird. Interessant ist immerhin,
daß ein Kenner wie Habich die Bilder als dem Tizian
nahestehend bezeichnet. Die archivalischen Erhebungen
Wielandts gestatten jedenfalls die Einsetzung Tizians als
Urheber durchaus, und der Hieb, der ihm so ungemein
rasch und schlagfertig aus dem kunsthistorischen Lager
mit dem Inventar von 1598 versetzt worden ist, war kein
tötlicher.
Ein neuer Rembrandt. Nachdem das »Werk« Rem-
brandts in dem von Bode herausgegebenen Korpus ab-
geschlossen zu sein schien, sind Jahr für Jahr, selbst
Monat für Monat neue Gemälde aufgetaucht, fast stets
aus dem unerschöpflichen englischen Privatbesitze, mit
mehr oder weniger legitimem Anspruch, für Originale ge-
halten zu werden. Die allermeisten dieser spät entdeckten
Bilder waren unbedeutende kleinere Stücke aus der Früh-
zeit des Meisters. Das Männerporträt aber, das vor einigen
Wochen auf einer Auktion in London erschien, billig zu-
geschlagen wurde und dann, von Prof. Hauser von Über-
malungen befreit, in die Sammlung des Herrn Geh. Kom-
merzienrats L. Koppel in Berlin überging, gehört zu den
bedeutenden Schöpfungen aus der späten Zeit des Mei-
sters und steht, was Freiheit und Kraft der Malerei be-
trifft, hinter keinem Werke, selbst nicht hinter den Staal-
meesters zurück. — Dargestellt in der Größe des Lebens,
bis zu den Knien sichtbar ist ein junger Mann, mit großen
dunklen Augen, schwermütigem Ausdruck, wundervollem
goldblonden Haar, eine rätselvolle Persönlichkeit, die den
Beschauer in ihren Leidenskreis hineinzieht. — Die Lein-
wand ist mit dem Namen des Meisters bezeichnet, aber
nicht datiert.
Bartholomäus Zeitblom, ein Nördlinger Bürgers-
sohn. In den Nummern 17 und 19 des »Sammlers (Belle-
tristische Beilage zur Augsburger Abendzeitung vom 8. und
13. Februar 1908) wird vom Archivar Dr. Diemand aus
Wallerstein ein Brief Zeitbloms veröffentlicht, den dieser
am 21. August 1491 an den Ratsherrn Jörg Vetzer in Nörd-
lingen richtete. Zeitblom ersucht den Herrn, er möchte
im Rat erfahren, weshalb die fällige Rate seines väterlichen
Funde
378
vor Chr. zu datieren wäre, und verschiedene Tonfragmente.
Eine Anzahl privater oder halboffizieller Wohngebäude
scheinen ebenfalls auf diesem Teil des Forums gestanden
zu haben. M
Ausgrabungen in Tunis. Die Franzosen sind bei
ihren Ausgrabungen im Gebiet der Regentschaft Tunis
wieder außerordentlich glücklich gewesen. In Dugga wurde
ein Saturntempel aufgedeckt, von dem noch eine Anzahl
Säulen in trefflicher Erhaltung zu bemerken sind. Unter
den neuerdings gefundenen Statuen ist eine Athena mit
einem Gürtel, der mit dem Medusenhaupt geschmückt ist,
an erster Stelle zu nennen; auch die 3 m hohe Kolossal-
statue, ein Apollo Kitharoedus mit reich ornamentierter
Leyer ist zu erwähnen. Selbstverständlich sind auch reiche
und wichtige Inschriftenfunde gemacht worden. m.
FUNDE
Manuel Wielandts Veröffentlichung über die
Münchener Imperatorenbilder (Zeitschrift für bildende
Kunst, Februarheft) hat eine lebhafte, ja sogar heftige
Debatte in Fachzeitschriften und der Tagespresse veranlaßt.
Der Streit ist so weit geklärt, daß man sagen kann: Wie-
landts Beobachtung ist von großer Wichtigkeit. Sein
Malerauge hat etwas gesehen, was den vielen Kunst-
historikern, die im Laufe der Zeiten an den Bildern vor-
übergegangen sind, oder sie sogar literarisch behandelt
haben, entgangen war. Denn das haben doch heute schon
auch diejenigen, welche Wielandts Resultaten nicht bei-
stimmen, zugegeben, daß es sich hier um Stücke von
kunstgeschichtlicher Wichtigkeit und ästhetischem Wert
handelt. Ferner wird anerkannt, daß Wielandts archi-
valische Forschung mit bedeutendem Geschick geführt ist.
Die klaffende Lücke, die aber Wielandt von den maß-
gebenden Münchener Kunsthistorikern trennt, ist folgende:
Es ist Wielandt entgangen, daß in einem Inventar von
1598 eine Imperatorenserie gleicher Personen als in der
Residenz befindlich aufgeführt wird; d. h. also zu einer
Zeit, da die Tizianschen Originale noch im Palast von
Mantua hingen. Die Gegenpartei stellt sich also einfach
auf den Standpunkt, daß sie sagt: 1598 haben die Impera-
torenbilder schon in der Residenz gehangen, folglich können
es nicht die Mantuaner Tizians sein; allerdings wird dabei
zugestanden, daß die Bilder so viel von Tizians Haltung
und Palette haben, daß sie wohl gleichzeitige Schulkopien
sein werden. — Wielandt dagegen verteidigt feinen Stand-
punkt so: Die Inventarnotiz von 1598 beweist nichts. Denn
in den späteren Inventaren von 1627 und 1635 werden die
Imperatorenbilder nicht mehr erwähnt. Der Einfall, sich
eine Suite von Imperatorenbildern zu dekorativen Zwecken
aufzuhängen, ist an sich kein origineller, sondern in da-
maliger Zeit gebräuchlicher gewesen (was auch von Wie-
landts Gegnern nicht bestritten wird). Nun war der Er-
werber der 1598 inventarisierten Imperatorenserie der
Herzog Albrecht V., der wenig Kunstverständnis besessen
hat, und bei seinen Käufen durch schlechte Agenten be-
dient wurde. Vor einer Reihe von Jahren hat auch
Fr. v. Reber in einer Sitzung der Akademie der Wissen-
schaften dieses Inventar von 1598 behandelt, und dabei
folgendes gesagt: »Von den Idealbildnissen, welche zu-
meist den Charakter von einheitlich bestellten Serien haben,
dürfte wohl die Folge der römischen Kaiser .... sicher
von Albrecht V. gleichzeitig mit der gleichfalls ziemlich
minderwertigen Suite der Büsten derselben Kaiser erworben,
am wenigsten Kunstwert besessen haben. Doch finden
sich die Bildnisse in den dermaligen Gemäldebeständen
nicht mehr vor. Schlecht bedient, wie Albrecht V. ins-
besondere durch seinen schuftigen Agenten Stoppio in
Venedig war, dürfte auch dieser Auftrag, von welchem
übrigens die Kunstkorrespondenzen Albrechts V. schweigen,
nicht in berufene Hände gelangt sein .... Man darf
annehmen, daß der Verlust dieser Bestellfabrikate nicht
allzusehr zu beklagen ist.« Hieraus geht hervor, daß von
einer Existenz solcher Imperatorenserie, die etwa gar mit
der von 1598 erwähnten identisch sein könnte, den
Münchener Kunsthistorikern überhaupt nichts bekannt war.
Nachdem nun Wielandt jetzt seinen Fund gemacht hat,
wird dieser Fund für die von Reber derart charakterisierte, in
den beiden späteren Inventaren nicht mehr aufgenommene
und bis heute als verschollen gehaltene Serie erklärt,
die nach Tizian kopiert wäre. Wielandt also meint,
daß die von Albrecht V. erworbene Reihe, die 1598 in-
ventarisiert worden ist und dann später fehlt, in Wahrheit
verschwunden ist und mit der jetzt vorhandenen gar nichts
zu tun hat. Zwischen dem Inventar von 1635, wo von
Imperatorenbildern keine Rede ist, und dem nächsten von
1644, wo wieder Imperatorenbilder aufgeführt werden, muß
nach Wielandts Ansicht diese jetzige, von ihm dem Tizian
zugeschriebene Serie erworben sein. Diese Zeitbestimmung
würde auch für die Tizianschen Originale auf das Ge-
naueste passen, da diese gerade um jene Zeit in London
verschwunden und seitdem verschollen sind. — Wir
möchten nun unsere Meinung dahin präzisieren: Ob die
jetzigen Bilder von Tizians Hand sind oder nicht, scheint
uns eine noch offene Frage, deren Lösung mit stilkritischen
Mitteln und auf Grund genauer Untersuchung der Stücke
von den maßgebenden Bilderkennern hoffentlich bald und
unbefangen angestrebt wird. Interessant ist immerhin,
daß ein Kenner wie Habich die Bilder als dem Tizian
nahestehend bezeichnet. Die archivalischen Erhebungen
Wielandts gestatten jedenfalls die Einsetzung Tizians als
Urheber durchaus, und der Hieb, der ihm so ungemein
rasch und schlagfertig aus dem kunsthistorischen Lager
mit dem Inventar von 1598 versetzt worden ist, war kein
tötlicher.
Ein neuer Rembrandt. Nachdem das »Werk« Rem-
brandts in dem von Bode herausgegebenen Korpus ab-
geschlossen zu sein schien, sind Jahr für Jahr, selbst
Monat für Monat neue Gemälde aufgetaucht, fast stets
aus dem unerschöpflichen englischen Privatbesitze, mit
mehr oder weniger legitimem Anspruch, für Originale ge-
halten zu werden. Die allermeisten dieser spät entdeckten
Bilder waren unbedeutende kleinere Stücke aus der Früh-
zeit des Meisters. Das Männerporträt aber, das vor einigen
Wochen auf einer Auktion in London erschien, billig zu-
geschlagen wurde und dann, von Prof. Hauser von Über-
malungen befreit, in die Sammlung des Herrn Geh. Kom-
merzienrats L. Koppel in Berlin überging, gehört zu den
bedeutenden Schöpfungen aus der späten Zeit des Mei-
sters und steht, was Freiheit und Kraft der Malerei be-
trifft, hinter keinem Werke, selbst nicht hinter den Staal-
meesters zurück. — Dargestellt in der Größe des Lebens,
bis zu den Knien sichtbar ist ein junger Mann, mit großen
dunklen Augen, schwermütigem Ausdruck, wundervollem
goldblonden Haar, eine rätselvolle Persönlichkeit, die den
Beschauer in ihren Leidenskreis hineinzieht. — Die Lein-
wand ist mit dem Namen des Meisters bezeichnet, aber
nicht datiert.
Bartholomäus Zeitblom, ein Nördlinger Bürgers-
sohn. In den Nummern 17 und 19 des »Sammlers (Belle-
tristische Beilage zur Augsburger Abendzeitung vom 8. und
13. Februar 1908) wird vom Archivar Dr. Diemand aus
Wallerstein ein Brief Zeitbloms veröffentlicht, den dieser
am 21. August 1491 an den Ratsherrn Jörg Vetzer in Nörd-
lingen richtete. Zeitblom ersucht den Herrn, er möchte
im Rat erfahren, weshalb die fällige Rate seines väterlichen