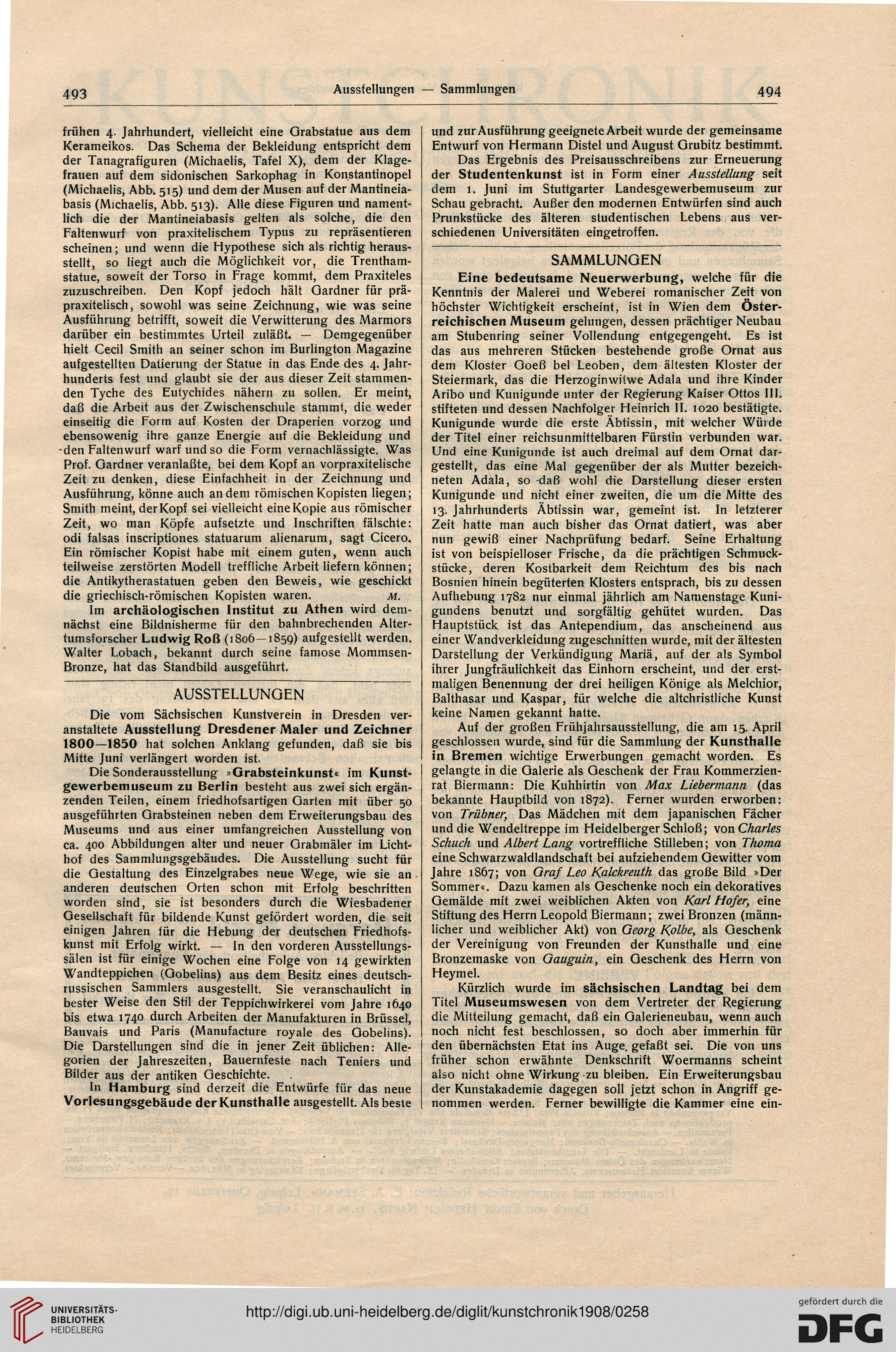493
Ausstellungen — Sammlungen
494
frühen 4. Jahrhundert, vielleicht eine Orabstatue aus dem
Kerameikos. Das Schema der Bekleidung entspricht dem
der Tanagrafiguren (Michaelis, Tafel X), dem der Klage-
frauen auf dem sidonischen Sarkophag in Kon.stantinopel
(Michaelis, Abb. 515) und dem der Musen auf der Mantineia-
basis (Michaelis, Abb. 513). Alle diese Figuren und nament-
lich die der Mantineiabasis gelten als solche, die den
Faltenwurf von praxitelischem Typus zu repräsentieren
scheinen; und wenn die Hypothese sich als richtig heraus-
stellt, so liegt auch die Möglichkeit vor, die Trentham-
statue, soweit der Torso in Frage kommt, dem Praxiteles
zuzuschreiben. Den Kopf jedoch hält Oardner für prä-
praxitelisch, sowohl was seine Zeichnung, wie was seine
Ausführung betrifft, soweit die Verwitterung des Marmors
darüber ein bestimmtes Urteil zuläßt. — Demgegenüber
hielt Cecil Smith an seiner schon im Burlington Magazine
aufgestellten Datierung der Statue in das Ende des 4. Jahr-
hunderts fest und glaubt sie der aus dieser Zeit stammen-
den Tyche des Eutychides nähern zu sollen. Er meint,
daß die Arbeit aus der Zwischenschule stammt, die weder
einseitig die Form auf Kosten der Draperien vorzog und
ebensowenig ihre ganze Energie auf die Bekleidung und
den Faltenwurf warf und so die Form vernachlässigte. Was
Prof. Oardner veranlaßte, bei dem Kopf an vorpraxitelische
Zeit zu denken, diese Einfachheit in der Zeichnung und
Ausführung, könne auch andern römischen Kopisten liegen;
Smith meint, der Kopf sei vielleicht eine Kopie aus römischer
Zeit, wo man Köpfe aufsetzte und Inschriften fälschte:
odi falsas inscriptiones statuarum alienarum, sagt Cicero.
Ein römischer Kopist habe mit einem guten, wenn auch
teilweise zerstörten Modell treffliche Arbeit liefern können;
die Antikytherastatuen geben den Beweis, wie geschickt
die griechisch-römischen Kopisten waren. m.
Im archäologischen Institut zu Athen wird dem-
nächst eine Bildnisherme für den bahnbrechenden Alter-
tumsforscher Ludwig Roß (1806—1859) aufgestellt werden.
Walter Lobach, bekannt durch seine famose Mommsen-
Bronze, hat das Standbild ausgeführt.
AUSSTELLUNGEN
Die vom Sächsischen Kunstverein in Dresden ver-
anstaltete Ausstellung Dresdener Maler und Zeichner
1800—1850 hat solchen Anklang gefunden, daß sie bis
Mitte Juni verlängert worden ist.
Die Sonderausstellung »Grabsteinkunst« im Kunst-
gewerbemuseum zu Berlin besteht aus zwei sich ergän-
zenden Teilen, einem friedhofsartigen Garten mit über 50
ausgeführten Grabsteinen neben dem Erweiterungsbau des
Museums und aus einer umfangreichen Ausstellung von
ca. 400 Abbildungen alter und neuer Grabmäler im Licht-
hof des Sammlungsgebäudes. Die Ausstellung sucht für
die Gestaltung des Einzelgrabes neue Wege, wie sie an
anderen deutschen Orten schon mit Erfolg beschritten
worden sind, sie ist besonders durch die Wiesbadener
Gesellschaft für bildende Kunst gefördert worden, die seit
einigen Jahren für die Hebung der deutschen Friedhofs-
kunst mit Erfolg wirkt. — In den vorderen Ausstellungs-
sälen ist für einige Wochen eine Folge von 14 gewirkten
Wandteppichen (Gobelins) aus dem Besitz eines deutsch-
russischen Sammlers ausgestellt. Sie veranschaulicht in
bester Weise den Stil der Teppichwirkerei vom Jahre 1640
bis etwa 1740 durch Arbeiten der Manufakturen in Brüssel,
Bauvais und Paris (Manufacture royale des Gobelins).
Die Darstellungen sind die in jener Zeit üblichen: Alle-
gorien der Jahreszeiten, Bauernfeste nach Teniers und
Bilder aus der antiken Geschichte.
In Hamburg sind derzeit die Entwürfe für das neue
Vorlesungsgebäude der Kunsthalle ausgestellt. Als beste
und zur Ausführung geeignete Arbeit wurde der gemeinsame
Entwurf von Hermann Distel und August Grubitz bestimmt.
Das Ergebnis des Preisausschreibens zur Erneuerung
der Studentenkunst ist in Form einer Ausstellung seit
dem u Juni im Stuttgarter Landesgewerbemuseum zur
Schau gebracht. Außer den modernen Entwürfen sind auch
Prunkstücke des älteren studentischen Lebens aus ver-
schiedenen Universitäten eingetroffen.
SAMMLUNGEN
Eine bedeutsame Neuerwerbung, welche für die
Kenntnis der Malerei und Weberei romanischer Zeit von
höchster Wichtigkeit erscheint, ist in Wien dem Oster-
reichischen Museum gelungen, dessen prächtiger Neubau
am Stubenring seiner Vollendung entgegengeht. Es ist
das aus mehreren Stücken bestehende große Ornat aus
dem Kloster Goeß bei Leoben, dem ältesten Kloster der
Steiermark, das die Herzoginwitwe Adala und ihre Kinder
Aribo und Kunigunde unter der Regierung Kaiser Ottos III.
stifteten und dessen Nachfolger Heinrich II. 1020 bestätigte.
Kunigunde wurde die erste Äbtissin, mit welcher Würde
der Titel einer reichsunmittelbaren Fürstin verbunden war.
Und eine Kunigunde ist auch dreimal auf dem Ornat dar-
gestellt, das eine Mal gegenüber der als Mutter bezeich-
neten Adala, so -daß wohl die Darstellung dieser ersten
Kunigunde und nicht einer zweiten, die um die Mitte des
13. Jahrhunderts Äbtissin war, gemeint ist. In letzterer
Zeit hatte man auch bisher das Ornat datiert, was aber
nun gewiß einer Nachprüfung bedarf. Seine Erhaltung
ist von beispielloser Frische, da die prächtigen Schmuck-
stücke, deren Kostbarkeit dem Reichtum des bis nach
Bosnien hinein begüterten Klosters entsprach, bis zu dessen
Aufhebung 1782 nur einmal jährlich am Namenstage Kuni-
gundens benutzt und sorgfältig gehütet wurden. Das
Hauptstück ist das Antependium, das anscheinend aus
einer Wandverkleidung zugeschnitten wurde, mit der ältesten
Darstellung der Verkündigung Mariä, auf der als Symbol
ihrer Jungfräulichkeit das Einhorn erscheint, und der erst-
maligen Benennung der drei heiligen Könige als Melchior,
Balthasar und Kaspar, für welche die altchristliche Kunst
keine Namen gekannt hatte.
Auf der großen Frühjahrsausstellung, die am 15. April
geschlossen wurde, sind für die Sammlung der Kunsthalle
in Bremen wichtige Erwerbungen gemacht worden. Es
gelangte in die Galerie als Geschenk der Frau Kommerzien-
rat Biermann: Die Kuhhirtin von Max Liebermann (das
bekannte Hauptbild von 1872). Ferner wurden erworben:
von Trübner, Das Mädchen mit dem japanischen Fächer
und die Wendeltreppe im Heidelberger Schloß; vonCharles
Schuck und Albert Lang vortreffliche Stilleben; von Thoma
eine Schwarzwaldlandschaft bei aufziehendem Gewitter vom
Jahre 1867; von Graf Leo Kalchreuth das große Bild »Der
Sommer«. Dazu kamen als Geschenke noch ein dekoratives
Gemälde mit zwei weiblichen Akten von Karl Hofer, eine
Stiftung des Herrn Leopold Biermann; zwei Bronzen (männ-
licher und weiblicher Akt) von Georg Kolbe, als Geschenk
der Vereinigung von Freunden der Kunsthalle und eine
Bronzemaske von Gauguin, ein Geschenk des Herrn von
Heyniel.
Kürzlich wurde im sächsischen Landtag bei dem
Titel Museumswesen von dem Vertreter der Regierung
die Mitteilung gemacht, daß ein Galerieneubau, wenn auch
noch nicht fest beschlossen, so doch aber immerhin für
den übernächsten Etat ins Auge, gefaßt sei. Die von uns
früher schon erwähnte Denkschrift Woermanns scheint
also nicht ohne Wirkung zu bleiben. Ein Erweiterungsbau
der Kunstakademie dagegen soll jetzt schon in Angriff ge-
nommen werden. Ferner bewilligte die Kammer eine ein-
Ausstellungen — Sammlungen
494
frühen 4. Jahrhundert, vielleicht eine Orabstatue aus dem
Kerameikos. Das Schema der Bekleidung entspricht dem
der Tanagrafiguren (Michaelis, Tafel X), dem der Klage-
frauen auf dem sidonischen Sarkophag in Kon.stantinopel
(Michaelis, Abb. 515) und dem der Musen auf der Mantineia-
basis (Michaelis, Abb. 513). Alle diese Figuren und nament-
lich die der Mantineiabasis gelten als solche, die den
Faltenwurf von praxitelischem Typus zu repräsentieren
scheinen; und wenn die Hypothese sich als richtig heraus-
stellt, so liegt auch die Möglichkeit vor, die Trentham-
statue, soweit der Torso in Frage kommt, dem Praxiteles
zuzuschreiben. Den Kopf jedoch hält Oardner für prä-
praxitelisch, sowohl was seine Zeichnung, wie was seine
Ausführung betrifft, soweit die Verwitterung des Marmors
darüber ein bestimmtes Urteil zuläßt. — Demgegenüber
hielt Cecil Smith an seiner schon im Burlington Magazine
aufgestellten Datierung der Statue in das Ende des 4. Jahr-
hunderts fest und glaubt sie der aus dieser Zeit stammen-
den Tyche des Eutychides nähern zu sollen. Er meint,
daß die Arbeit aus der Zwischenschule stammt, die weder
einseitig die Form auf Kosten der Draperien vorzog und
ebensowenig ihre ganze Energie auf die Bekleidung und
den Faltenwurf warf und so die Form vernachlässigte. Was
Prof. Oardner veranlaßte, bei dem Kopf an vorpraxitelische
Zeit zu denken, diese Einfachheit in der Zeichnung und
Ausführung, könne auch andern römischen Kopisten liegen;
Smith meint, der Kopf sei vielleicht eine Kopie aus römischer
Zeit, wo man Köpfe aufsetzte und Inschriften fälschte:
odi falsas inscriptiones statuarum alienarum, sagt Cicero.
Ein römischer Kopist habe mit einem guten, wenn auch
teilweise zerstörten Modell treffliche Arbeit liefern können;
die Antikytherastatuen geben den Beweis, wie geschickt
die griechisch-römischen Kopisten waren. m.
Im archäologischen Institut zu Athen wird dem-
nächst eine Bildnisherme für den bahnbrechenden Alter-
tumsforscher Ludwig Roß (1806—1859) aufgestellt werden.
Walter Lobach, bekannt durch seine famose Mommsen-
Bronze, hat das Standbild ausgeführt.
AUSSTELLUNGEN
Die vom Sächsischen Kunstverein in Dresden ver-
anstaltete Ausstellung Dresdener Maler und Zeichner
1800—1850 hat solchen Anklang gefunden, daß sie bis
Mitte Juni verlängert worden ist.
Die Sonderausstellung »Grabsteinkunst« im Kunst-
gewerbemuseum zu Berlin besteht aus zwei sich ergän-
zenden Teilen, einem friedhofsartigen Garten mit über 50
ausgeführten Grabsteinen neben dem Erweiterungsbau des
Museums und aus einer umfangreichen Ausstellung von
ca. 400 Abbildungen alter und neuer Grabmäler im Licht-
hof des Sammlungsgebäudes. Die Ausstellung sucht für
die Gestaltung des Einzelgrabes neue Wege, wie sie an
anderen deutschen Orten schon mit Erfolg beschritten
worden sind, sie ist besonders durch die Wiesbadener
Gesellschaft für bildende Kunst gefördert worden, die seit
einigen Jahren für die Hebung der deutschen Friedhofs-
kunst mit Erfolg wirkt. — In den vorderen Ausstellungs-
sälen ist für einige Wochen eine Folge von 14 gewirkten
Wandteppichen (Gobelins) aus dem Besitz eines deutsch-
russischen Sammlers ausgestellt. Sie veranschaulicht in
bester Weise den Stil der Teppichwirkerei vom Jahre 1640
bis etwa 1740 durch Arbeiten der Manufakturen in Brüssel,
Bauvais und Paris (Manufacture royale des Gobelins).
Die Darstellungen sind die in jener Zeit üblichen: Alle-
gorien der Jahreszeiten, Bauernfeste nach Teniers und
Bilder aus der antiken Geschichte.
In Hamburg sind derzeit die Entwürfe für das neue
Vorlesungsgebäude der Kunsthalle ausgestellt. Als beste
und zur Ausführung geeignete Arbeit wurde der gemeinsame
Entwurf von Hermann Distel und August Grubitz bestimmt.
Das Ergebnis des Preisausschreibens zur Erneuerung
der Studentenkunst ist in Form einer Ausstellung seit
dem u Juni im Stuttgarter Landesgewerbemuseum zur
Schau gebracht. Außer den modernen Entwürfen sind auch
Prunkstücke des älteren studentischen Lebens aus ver-
schiedenen Universitäten eingetroffen.
SAMMLUNGEN
Eine bedeutsame Neuerwerbung, welche für die
Kenntnis der Malerei und Weberei romanischer Zeit von
höchster Wichtigkeit erscheint, ist in Wien dem Oster-
reichischen Museum gelungen, dessen prächtiger Neubau
am Stubenring seiner Vollendung entgegengeht. Es ist
das aus mehreren Stücken bestehende große Ornat aus
dem Kloster Goeß bei Leoben, dem ältesten Kloster der
Steiermark, das die Herzoginwitwe Adala und ihre Kinder
Aribo und Kunigunde unter der Regierung Kaiser Ottos III.
stifteten und dessen Nachfolger Heinrich II. 1020 bestätigte.
Kunigunde wurde die erste Äbtissin, mit welcher Würde
der Titel einer reichsunmittelbaren Fürstin verbunden war.
Und eine Kunigunde ist auch dreimal auf dem Ornat dar-
gestellt, das eine Mal gegenüber der als Mutter bezeich-
neten Adala, so -daß wohl die Darstellung dieser ersten
Kunigunde und nicht einer zweiten, die um die Mitte des
13. Jahrhunderts Äbtissin war, gemeint ist. In letzterer
Zeit hatte man auch bisher das Ornat datiert, was aber
nun gewiß einer Nachprüfung bedarf. Seine Erhaltung
ist von beispielloser Frische, da die prächtigen Schmuck-
stücke, deren Kostbarkeit dem Reichtum des bis nach
Bosnien hinein begüterten Klosters entsprach, bis zu dessen
Aufhebung 1782 nur einmal jährlich am Namenstage Kuni-
gundens benutzt und sorgfältig gehütet wurden. Das
Hauptstück ist das Antependium, das anscheinend aus
einer Wandverkleidung zugeschnitten wurde, mit der ältesten
Darstellung der Verkündigung Mariä, auf der als Symbol
ihrer Jungfräulichkeit das Einhorn erscheint, und der erst-
maligen Benennung der drei heiligen Könige als Melchior,
Balthasar und Kaspar, für welche die altchristliche Kunst
keine Namen gekannt hatte.
Auf der großen Frühjahrsausstellung, die am 15. April
geschlossen wurde, sind für die Sammlung der Kunsthalle
in Bremen wichtige Erwerbungen gemacht worden. Es
gelangte in die Galerie als Geschenk der Frau Kommerzien-
rat Biermann: Die Kuhhirtin von Max Liebermann (das
bekannte Hauptbild von 1872). Ferner wurden erworben:
von Trübner, Das Mädchen mit dem japanischen Fächer
und die Wendeltreppe im Heidelberger Schloß; vonCharles
Schuck und Albert Lang vortreffliche Stilleben; von Thoma
eine Schwarzwaldlandschaft bei aufziehendem Gewitter vom
Jahre 1867; von Graf Leo Kalchreuth das große Bild »Der
Sommer«. Dazu kamen als Geschenke noch ein dekoratives
Gemälde mit zwei weiblichen Akten von Karl Hofer, eine
Stiftung des Herrn Leopold Biermann; zwei Bronzen (männ-
licher und weiblicher Akt) von Georg Kolbe, als Geschenk
der Vereinigung von Freunden der Kunsthalle und eine
Bronzemaske von Gauguin, ein Geschenk des Herrn von
Heyniel.
Kürzlich wurde im sächsischen Landtag bei dem
Titel Museumswesen von dem Vertreter der Regierung
die Mitteilung gemacht, daß ein Galerieneubau, wenn auch
noch nicht fest beschlossen, so doch aber immerhin für
den übernächsten Etat ins Auge, gefaßt sei. Die von uns
früher schon erwähnte Denkschrift Woermanns scheint
also nicht ohne Wirkung zu bleiben. Ein Erweiterungsbau
der Kunstakademie dagegen soll jetzt schon in Angriff ge-
nommen werden. Ferner bewilligte die Kammer eine ein-