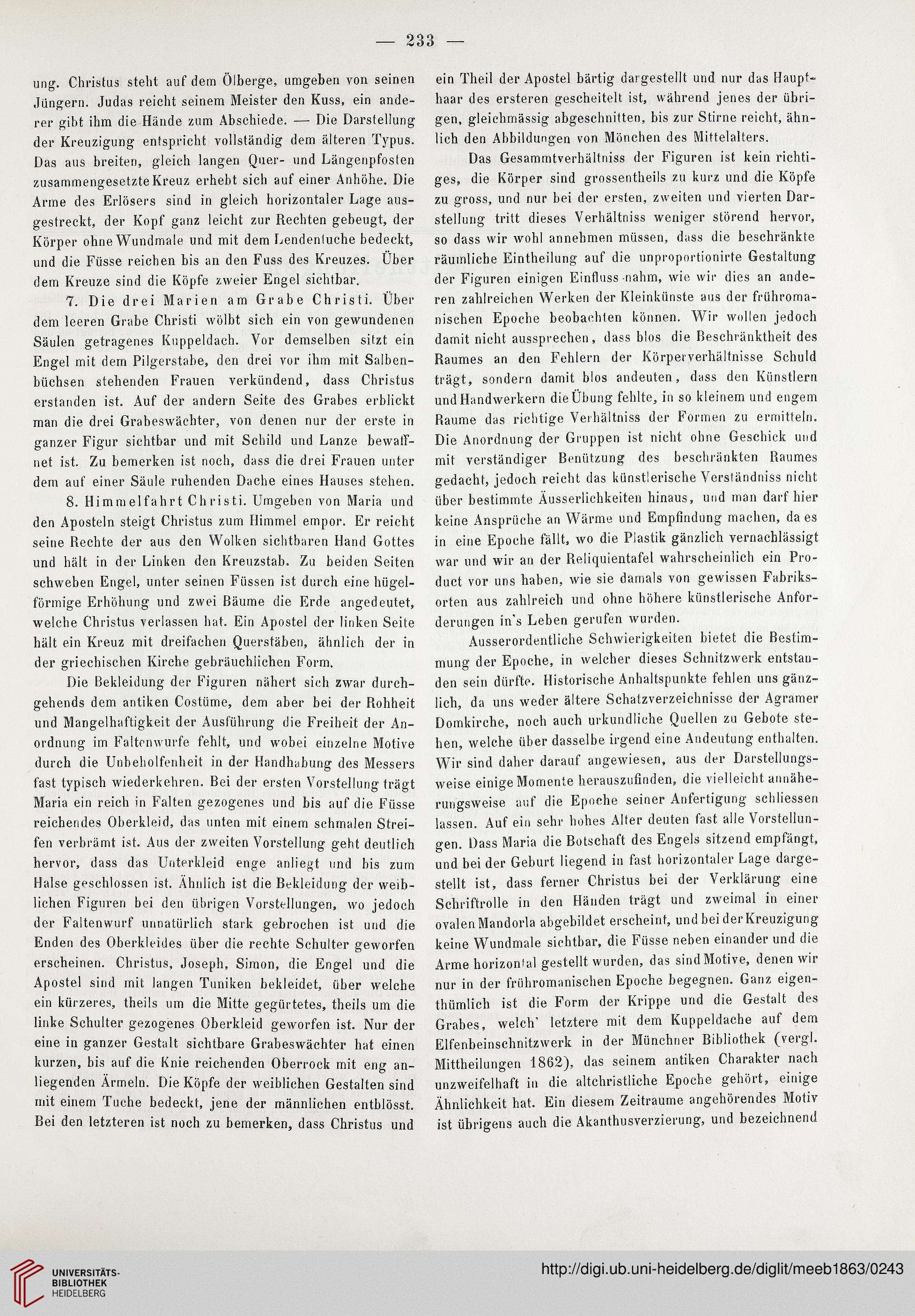— 233
ung. Christus steht auf dem Ölberge, umgeben von seinen
Jüngern. Judas reicht seinem Meister den Kuss, ein ande-
rer gibt ihm die Hände zum Abschiede. — Die Darsteiiung
der Kreuzigung entspricht vollständig dem äiteren Typus.
Das aus breiten, gieich iangen Quer- und Längenpfosten
zusammengesetzte Kreuz erhebt sich auf einer Anhöhe. Die
Arme des Eriösers sind in gieich horizontaier Lage aus-
gestreckt, der Kopf ganz ieicht zur Rechten gebeugt, der
Körper ohne Wundmaie und mit dem Lendeniuche bedeckt,
und die Füsse reichen bis an den Fuss des Kreuzes. Über
dem Kreuze sind die Köpfe zweier Engei sichtbar.
7. Die drei Marien am Grabe Christi. Über
dem ieeren Grabe Christi wöibt sich ein von gewundenen
Säulen getragenes Kuppeidach. Vor demseiben sitzt ein
Engei mit dem Piigerstahe, den drei vor ihm mit Saiben-
büchsen stehenden Frauen verkündend, dass Christus
erstanden ist. Auf der andern Seite des Grabes erbiiekt
man die drei Grabeswächter, von denen nur der erste in
ganzer Figur sichtbar und mit Schiid und Lanze bewaff-
net ist. Zu bemerken ist noch, dass die drei Frauen unter
dem auf einer Säuie ruhenden Dache eines Hauses stehen.
8. Himmeifahrt Christi. Umgeben von Maria und
den Aposteln steigt Christus zum Himmei empor. Er reicht
seine Rechte der aus den Woiken sichtbaren Hand Gottes
und häit in der Linken den Kreuzstab. Zu beiden Seiten
schweben Enge!, unter seinen Füssen ist durch eine hügei-
förmige Erhöhung und zwei Bäume die Erde angedeutet,
weiche Christus veriassen hat. Ein Apostel der linken Seite
häit ein Kreuz mit dreifachen Querstäben, ähnlich der in
der griechischen Kirche gebräuchiichen Form.
Die Bekieidung der Figuren nähert sich zwar durch-
gehends dem antiken Costüme, dem aber bei der Rohheit
und Mangeihaftigkeit der Ausführung die Freiheit der An-
ordnung im Faitenwurfe fehit, und wobei einzeine Motive
durch die Unbehoifenheit in der Handhabung des Messers
fast typisch wiederkehren. Bei der ersten Vorsteiiung trägt
Maria ein reich in Falten gezogenes und bis auf die Füsse
reichendes Oberkieid, das unten mit einem schmaien Strei-
fen verbrämt ist. Aus der zweiten Vorsteiiung geht deutlich
hervor, dass das Unterkleid enge aniiegt und bis zum
Halse geschiossen ist. Ähniich ist die Bekieidung der wetb-
iichen Hguren bei den übrigen Vorsteliungen, wo jedoch
der Faltenwurf unnatüriieh stark gebrochen ist und die
Enden des Oberkicides über die rechte Schulter geworfen
erscheinen. Christus, Joseph, Simon, die Engei und die
Aposte! sind mit iangen Tuniken bekieidet, über welche
ein kürzeres, theiis um die Mitte gegürtetes, theiis um die
linke Schütter gezogenes Oberkieid geworfen ist. Nur der
eine in ganzer Gestalt sichtbare Grabeswächter hat einen
kurzen, bis auf die Knie reichenden Oberrock mit eng an-
liegenden Ärmeln. Die Köpfe der weibiiehen Gestaiten sind
mit einem Tuche bedeckt, jene der männiiehen entblösst.
Bei den ietzteren ist noch zu bemerken, dass Christus und
ein Theii der Apostel bärtig dargesteilt und nur das Haupt-
haar des ersteren gescheitelt ist, während jenes der übri-
gen, gleichmässig abgeschnitten, bis zur Stirne reicht, ähn-
lich den Abbildungen von Mönchen des Mittelalters.
Das Gesammtverhältniss der Figuren ist kein richti-
ges, die Körper sind grossentheils zu kurz und die Köpfe
zu gross, und nur bei der ersten, zweiten und vierten Dar-
stellung tritt dieses Verhältnis weniger störend hervor,
so dass wir wohl annehmen müssen, dass die beschränkte
räumliche Eintheilung auf die unproportionirte Gestaltung
der Figuren einigen Einfluss nahm, wie wir dies an ande-
ren zahlreichen Werken der Kleinkünste aus der frühroma-
nischen Epoche beobachten können. Wir wollen jedoch
damit nicht aussprechen, dass blos die Beschränktheit des
Raumes an den Fehlern der Körperverhältnisse Schuld
trägt, sondern damit blos andeuten, dass den Künstlern
und Handwerkern die Übung fehlte, in so kleinem und engem
Raume das richtige Verhältnis der Formen zu ermitteln.
Die Anordnung der Gruppen ist nicht ohne Geschick und
mit verständiger Benützung des beschränkten Raumes
gedacht, jedoch reicht das künstlerische Verständnis nicht
über bestimmte Äusserlichkeiten hinaus, und man darf hier
keine Ansprüche an Wärme und Emptindung machen, da es
in eine Epoche fällt, wo die Plastik gänzlich vernachlässigt
war und wir an der Reliquientafel wahrscheinlich ein Pro-
duct vor uns haben, wie sie damals von gewissen Fabriks-
orten aus zahlreich und ohne höhere künstlerische Anfor-
derungen in's Leben gerufen wurden.
Ausserordentliche Schwierigkeiten bietet die Bestim-
mung der Epoche, in welcher dieses Schnitzwerk entstan-
den sein dürfte. Historische Anhaltspunkte fehlen uns gänz-
lich, da uns weder ältere Schatzverzeichnisse der Agramer
Domkirche, noch auch urkundliche Quellen zu Gebote ste-
hen, welche über dasselbe irgend eine Andeutung enthalten.
Wir sind daher darauf angewiesen, aus der Darstellungs-
weise einige Momente herauszutinden, die vielleicht annähe-
rungsweise auf die Epoche seiner Anfertigung schlossen
lassen. Auf ein sehr hohes Alter deuten fast alle Vorstellun-
gen. Dass Maria die Botschaft des Engels sitzend empfängt,
und bei der Geburt liegend in fast horizontaler Lage darge-
stellt ist, dass ferner Christus bei der Verklärung eine
Schriftrolle in den Händen trägt und zweimal in einer
ovalenMandorla abgebildet erscheint, und bei der Kreuzigung
keine Wundmale sichtbar, die Füsse neben einander und die
Arme horizontal gestellt wurden, das sind Motive, denen wir
nur in der frühromanischen Epoche begegnen. Ganz eigen-
tümlich ist die Form der Krippe und die Gestalt des
Grabes, welch' letztere mit dem Kuppeldache auf dem
Elfenbeinschnitzwerk in der Münchner Bibliothek (vergl.
Mittheilungen 1862j, das seinem antiken Charakter nach
unzweifelhaft in die altchristliche Epoche gehört, einige
Ähnlichkeit hat. Ein diesem Zeiträume angehörendes Motiv
ist übrigens auch die Akanthusverzierung, und bezeichnend
ung. Christus steht auf dem Ölberge, umgeben von seinen
Jüngern. Judas reicht seinem Meister den Kuss, ein ande-
rer gibt ihm die Hände zum Abschiede. — Die Darsteiiung
der Kreuzigung entspricht vollständig dem äiteren Typus.
Das aus breiten, gieich iangen Quer- und Längenpfosten
zusammengesetzte Kreuz erhebt sich auf einer Anhöhe. Die
Arme des Eriösers sind in gieich horizontaier Lage aus-
gestreckt, der Kopf ganz ieicht zur Rechten gebeugt, der
Körper ohne Wundmaie und mit dem Lendeniuche bedeckt,
und die Füsse reichen bis an den Fuss des Kreuzes. Über
dem Kreuze sind die Köpfe zweier Engei sichtbar.
7. Die drei Marien am Grabe Christi. Über
dem ieeren Grabe Christi wöibt sich ein von gewundenen
Säulen getragenes Kuppeidach. Vor demseiben sitzt ein
Engei mit dem Piigerstahe, den drei vor ihm mit Saiben-
büchsen stehenden Frauen verkündend, dass Christus
erstanden ist. Auf der andern Seite des Grabes erbiiekt
man die drei Grabeswächter, von denen nur der erste in
ganzer Figur sichtbar und mit Schiid und Lanze bewaff-
net ist. Zu bemerken ist noch, dass die drei Frauen unter
dem auf einer Säuie ruhenden Dache eines Hauses stehen.
8. Himmeifahrt Christi. Umgeben von Maria und
den Aposteln steigt Christus zum Himmei empor. Er reicht
seine Rechte der aus den Woiken sichtbaren Hand Gottes
und häit in der Linken den Kreuzstab. Zu beiden Seiten
schweben Enge!, unter seinen Füssen ist durch eine hügei-
förmige Erhöhung und zwei Bäume die Erde angedeutet,
weiche Christus veriassen hat. Ein Apostel der linken Seite
häit ein Kreuz mit dreifachen Querstäben, ähnlich der in
der griechischen Kirche gebräuchiichen Form.
Die Bekieidung der Figuren nähert sich zwar durch-
gehends dem antiken Costüme, dem aber bei der Rohheit
und Mangeihaftigkeit der Ausführung die Freiheit der An-
ordnung im Faitenwurfe fehit, und wobei einzeine Motive
durch die Unbehoifenheit in der Handhabung des Messers
fast typisch wiederkehren. Bei der ersten Vorsteiiung trägt
Maria ein reich in Falten gezogenes und bis auf die Füsse
reichendes Oberkieid, das unten mit einem schmaien Strei-
fen verbrämt ist. Aus der zweiten Vorsteiiung geht deutlich
hervor, dass das Unterkleid enge aniiegt und bis zum
Halse geschiossen ist. Ähniich ist die Bekieidung der wetb-
iichen Hguren bei den übrigen Vorsteliungen, wo jedoch
der Faltenwurf unnatüriieh stark gebrochen ist und die
Enden des Oberkicides über die rechte Schulter geworfen
erscheinen. Christus, Joseph, Simon, die Engei und die
Aposte! sind mit iangen Tuniken bekieidet, über welche
ein kürzeres, theiis um die Mitte gegürtetes, theiis um die
linke Schütter gezogenes Oberkieid geworfen ist. Nur der
eine in ganzer Gestalt sichtbare Grabeswächter hat einen
kurzen, bis auf die Knie reichenden Oberrock mit eng an-
liegenden Ärmeln. Die Köpfe der weibiiehen Gestaiten sind
mit einem Tuche bedeckt, jene der männiiehen entblösst.
Bei den ietzteren ist noch zu bemerken, dass Christus und
ein Theii der Apostel bärtig dargesteilt und nur das Haupt-
haar des ersteren gescheitelt ist, während jenes der übri-
gen, gleichmässig abgeschnitten, bis zur Stirne reicht, ähn-
lich den Abbildungen von Mönchen des Mittelalters.
Das Gesammtverhältniss der Figuren ist kein richti-
ges, die Körper sind grossentheils zu kurz und die Köpfe
zu gross, und nur bei der ersten, zweiten und vierten Dar-
stellung tritt dieses Verhältnis weniger störend hervor,
so dass wir wohl annehmen müssen, dass die beschränkte
räumliche Eintheilung auf die unproportionirte Gestaltung
der Figuren einigen Einfluss nahm, wie wir dies an ande-
ren zahlreichen Werken der Kleinkünste aus der frühroma-
nischen Epoche beobachten können. Wir wollen jedoch
damit nicht aussprechen, dass blos die Beschränktheit des
Raumes an den Fehlern der Körperverhältnisse Schuld
trägt, sondern damit blos andeuten, dass den Künstlern
und Handwerkern die Übung fehlte, in so kleinem und engem
Raume das richtige Verhältnis der Formen zu ermitteln.
Die Anordnung der Gruppen ist nicht ohne Geschick und
mit verständiger Benützung des beschränkten Raumes
gedacht, jedoch reicht das künstlerische Verständnis nicht
über bestimmte Äusserlichkeiten hinaus, und man darf hier
keine Ansprüche an Wärme und Emptindung machen, da es
in eine Epoche fällt, wo die Plastik gänzlich vernachlässigt
war und wir an der Reliquientafel wahrscheinlich ein Pro-
duct vor uns haben, wie sie damals von gewissen Fabriks-
orten aus zahlreich und ohne höhere künstlerische Anfor-
derungen in's Leben gerufen wurden.
Ausserordentliche Schwierigkeiten bietet die Bestim-
mung der Epoche, in welcher dieses Schnitzwerk entstan-
den sein dürfte. Historische Anhaltspunkte fehlen uns gänz-
lich, da uns weder ältere Schatzverzeichnisse der Agramer
Domkirche, noch auch urkundliche Quellen zu Gebote ste-
hen, welche über dasselbe irgend eine Andeutung enthalten.
Wir sind daher darauf angewiesen, aus der Darstellungs-
weise einige Momente herauszutinden, die vielleicht annähe-
rungsweise auf die Epoche seiner Anfertigung schlossen
lassen. Auf ein sehr hohes Alter deuten fast alle Vorstellun-
gen. Dass Maria die Botschaft des Engels sitzend empfängt,
und bei der Geburt liegend in fast horizontaler Lage darge-
stellt ist, dass ferner Christus bei der Verklärung eine
Schriftrolle in den Händen trägt und zweimal in einer
ovalenMandorla abgebildet erscheint, und bei der Kreuzigung
keine Wundmale sichtbar, die Füsse neben einander und die
Arme horizontal gestellt wurden, das sind Motive, denen wir
nur in der frühromanischen Epoche begegnen. Ganz eigen-
tümlich ist die Form der Krippe und die Gestalt des
Grabes, welch' letztere mit dem Kuppeldache auf dem
Elfenbeinschnitzwerk in der Münchner Bibliothek (vergl.
Mittheilungen 1862j, das seinem antiken Charakter nach
unzweifelhaft in die altchristliche Epoche gehört, einige
Ähnlichkeit hat. Ein diesem Zeiträume angehörendes Motiv
ist übrigens auch die Akanthusverzierung, und bezeichnend