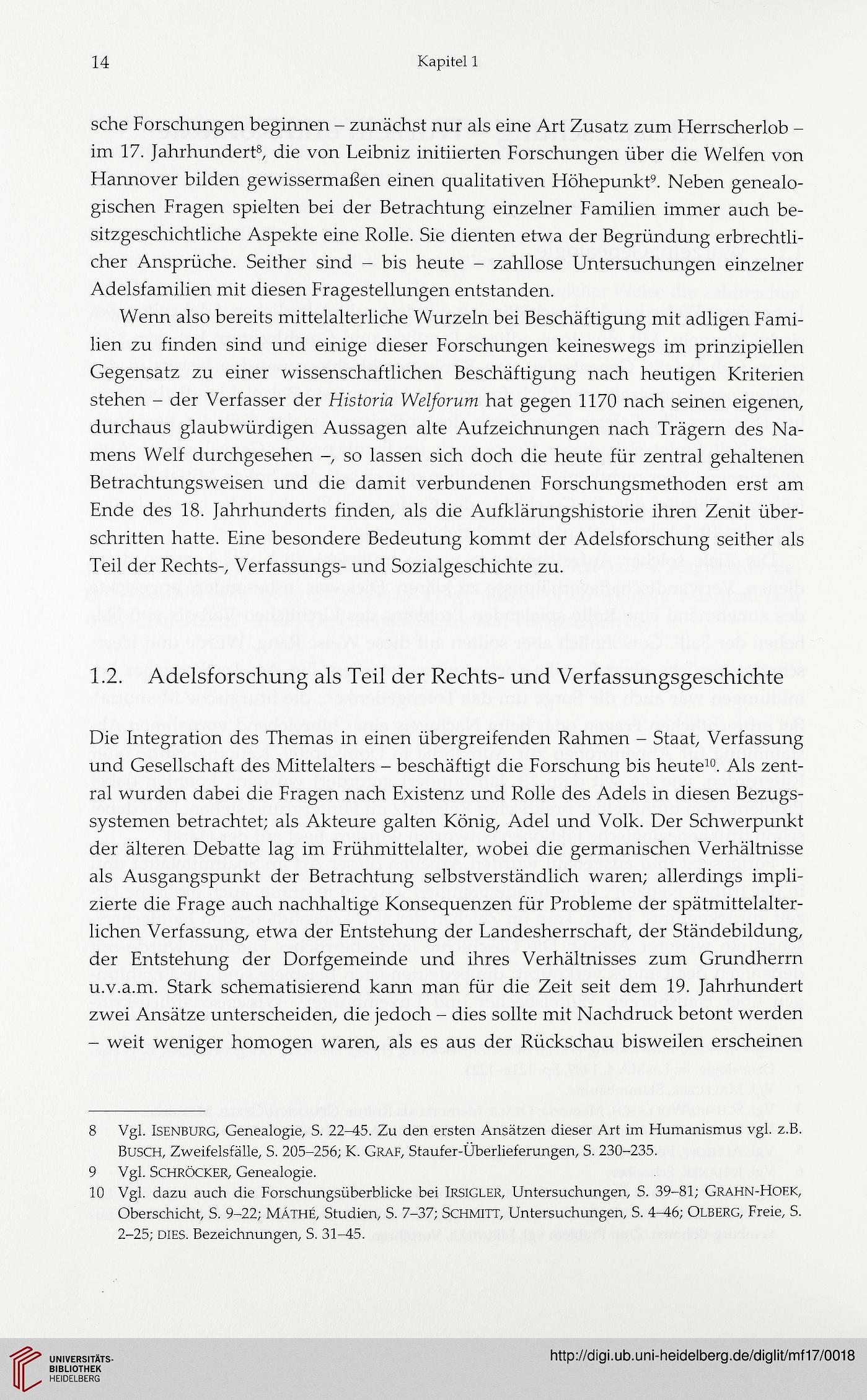14
Kapitel 1
sehe Forschungen beginnen - zunächst nur als eine Art Zusatz zum Herrscherlob -
im 17. Jahrhundert^ die von Leibniz initiierten Forschungen über die Welfen von
Hannover bilden gewissermaßen einen qualitativen Höhepunkte Neben genealo-
gischen Fragen spielten bei der Betrachtung einzelner Familien immer auch be-
sitzgeschichtliche Aspekte eine Rolle. Sie dienten etwa der Begründung erbrechtli-
cher Ansprüche. Seither sind - bis heute - zahllose Untersuchungen einzelner
Adelsfamilien mit diesen Fragestellungen entstanden.
Wenn also bereits mittelalterliche Wurzeln bei Beschäftigung mit adligen Fami-
lien zu finden sind und einige dieser Forschungen keineswegs im prinzipiellen
Gegensatz zu einer wissenschaftlichen Beschäftigung nach heutigen Kriterien
stehen - der Verfasser der Hisfonü Wglforum hat gegen H70 nach seinen eigenen,
durchaus glaubwürdigen Aussagen alte Aufzeichnungen nach Trägern des Na-
mens Welf durchgesehen - so lassen sich doch die heute für zentral gehaltenen
Betrachtungsweisen und die damit verbundenen Forschungsmethoden erst am
Ende des 18. Jahrhunderts finden, als die Aufklärungshistorie ihren Zenit über-
schritten hatte. Eine besondere Bedeutung kommt der Adelsforschung seither als
Teil der Rechts-, Verfassungs- und Sozialgeschichte zu.
1.2. Adelsforschung als Teil der Rechts- und Verfassungsgeschichte
Die Integration des Themas in einen übergreifenden Rahmen - Staat, Verfassung
und Gesellschaft des Mittelalters - beschäftigt die Forschung bis heuteA Als zent-
ral wurden dabei die Fragen nach Existenz und Rolle des Adels in diesen Bezugs-
systemen betrachtet; als Akteure galten König, Adel und Volk. Der Schwerpunkt
der älteren Debatte lag im Frühmittelalter, wobei die germanischen Verhältnisse
als Ausgangspunkt der Betrachtung selbstverständlich waren; allerdings impli-
zierte die Frage auch nachhaltige Konsequenzen für Probleme der spätmittelalfer-
lichen Verfassung, etwa der Entstehung der Landesherrschaft, der Ständebildung,
der Entstehung der Dorfgemeinde und ihres Verhältnisses zum Grundherrn
u.v.a.m. Stark schematisierend kann man für die Zeit seit dem 19. Jahrhundert
zwei Ansätze unterscheiden, die jedoch - dies sollte mit Nachdruck betont werden
- weit weniger homogen waren, als es aus der Rückschau bisweilen erscheinen
8 Vgl. ISENBURG, Genealogie, S. 22-45. Zu den ersten Ansätzen dieser Art im Humanismus vgl. z.B.
BUSCH, Zweifelsfälle, S. 205-256; K. GRAF, Staufer-Überlieferungen, S. 230-235.
9 Vgl. SCHRÖCKER, Genealogie.
10 Vgl. dazu auch die Forschungsüberblicke bei IRSIGLER, Untersuchungen, S. 39-81; GRAHN-HOEK,
Oberschicht, S. 9-22; MÄTHE, Studien, S. 7-37; SCHMITT, Untersuchungen, S. 4-46; OLBERG, Freie, S.
2-25; DIES. Bezeichnungen, S. 31-45.
Kapitel 1
sehe Forschungen beginnen - zunächst nur als eine Art Zusatz zum Herrscherlob -
im 17. Jahrhundert^ die von Leibniz initiierten Forschungen über die Welfen von
Hannover bilden gewissermaßen einen qualitativen Höhepunkte Neben genealo-
gischen Fragen spielten bei der Betrachtung einzelner Familien immer auch be-
sitzgeschichtliche Aspekte eine Rolle. Sie dienten etwa der Begründung erbrechtli-
cher Ansprüche. Seither sind - bis heute - zahllose Untersuchungen einzelner
Adelsfamilien mit diesen Fragestellungen entstanden.
Wenn also bereits mittelalterliche Wurzeln bei Beschäftigung mit adligen Fami-
lien zu finden sind und einige dieser Forschungen keineswegs im prinzipiellen
Gegensatz zu einer wissenschaftlichen Beschäftigung nach heutigen Kriterien
stehen - der Verfasser der Hisfonü Wglforum hat gegen H70 nach seinen eigenen,
durchaus glaubwürdigen Aussagen alte Aufzeichnungen nach Trägern des Na-
mens Welf durchgesehen - so lassen sich doch die heute für zentral gehaltenen
Betrachtungsweisen und die damit verbundenen Forschungsmethoden erst am
Ende des 18. Jahrhunderts finden, als die Aufklärungshistorie ihren Zenit über-
schritten hatte. Eine besondere Bedeutung kommt der Adelsforschung seither als
Teil der Rechts-, Verfassungs- und Sozialgeschichte zu.
1.2. Adelsforschung als Teil der Rechts- und Verfassungsgeschichte
Die Integration des Themas in einen übergreifenden Rahmen - Staat, Verfassung
und Gesellschaft des Mittelalters - beschäftigt die Forschung bis heuteA Als zent-
ral wurden dabei die Fragen nach Existenz und Rolle des Adels in diesen Bezugs-
systemen betrachtet; als Akteure galten König, Adel und Volk. Der Schwerpunkt
der älteren Debatte lag im Frühmittelalter, wobei die germanischen Verhältnisse
als Ausgangspunkt der Betrachtung selbstverständlich waren; allerdings impli-
zierte die Frage auch nachhaltige Konsequenzen für Probleme der spätmittelalfer-
lichen Verfassung, etwa der Entstehung der Landesherrschaft, der Ständebildung,
der Entstehung der Dorfgemeinde und ihres Verhältnisses zum Grundherrn
u.v.a.m. Stark schematisierend kann man für die Zeit seit dem 19. Jahrhundert
zwei Ansätze unterscheiden, die jedoch - dies sollte mit Nachdruck betont werden
- weit weniger homogen waren, als es aus der Rückschau bisweilen erscheinen
8 Vgl. ISENBURG, Genealogie, S. 22-45. Zu den ersten Ansätzen dieser Art im Humanismus vgl. z.B.
BUSCH, Zweifelsfälle, S. 205-256; K. GRAF, Staufer-Überlieferungen, S. 230-235.
9 Vgl. SCHRÖCKER, Genealogie.
10 Vgl. dazu auch die Forschungsüberblicke bei IRSIGLER, Untersuchungen, S. 39-81; GRAHN-HOEK,
Oberschicht, S. 9-22; MÄTHE, Studien, S. 7-37; SCHMITT, Untersuchungen, S. 4-46; OLBERG, Freie, S.
2-25; DIES. Bezeichnungen, S. 31-45.