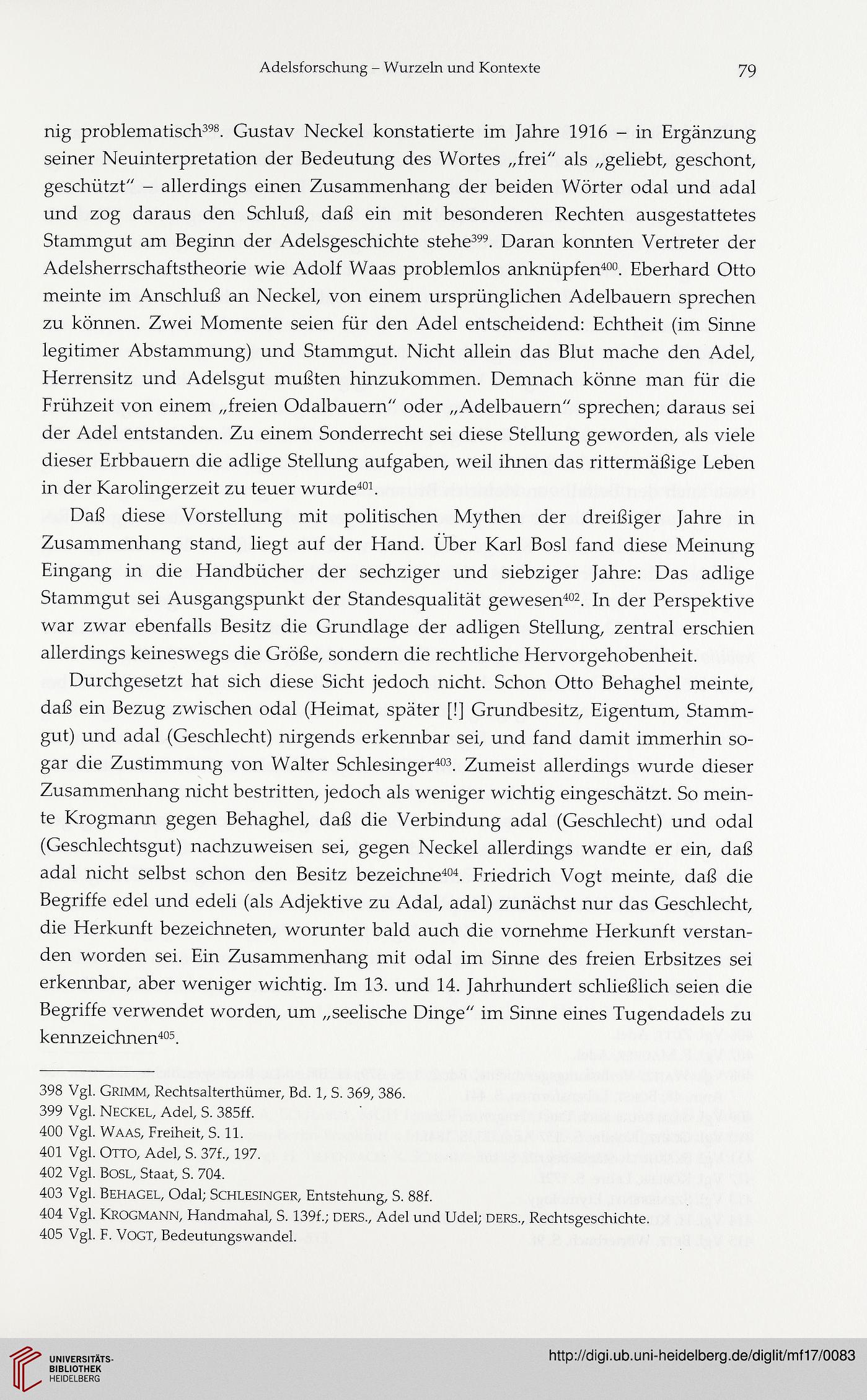79
nig problematisch^. Gustav Neckel konstatierte im Jahre 1916 - in Ergänzung
seiner Neuinterpretation der Bedeutung des Wortes „frei" als „geliebt, geschont,
geschützt" - allerdings einen Zusammenhang der beiden Wörter odal und adal
und zog daraus den Schluß, daß ein mit besonderen Rechten ausgestattetes
Stammgut am Beginn der Adelsgeschichte stehe^. Daran konnten Vertreter der
Adelsherrschaftstheorie wie Adolf Waas problemlos anknüpfen^k Eberhard Otto
meinte im Anschluß an Neckel, von einem ursprünglichen Adelbauern sprechen
zu können. Zwei Momente seien für den Adel entscheidend: Echtheit (im Sinne
legitimer Abstammung) und Stammgut. Nicht allein das Blut mache den Adel,
Herrensitz und Adelsgut mußten hinzukommen. Demnach könne man für die
Frühzeit von einem „freien Odalbauern" oder „Adelbauern" sprechen; daraus sei
der Adel entstanden. Zu einem Sonderrecht sei diese Stellung geworden, als viele
dieser Erbbauern die adlige Stellung aufgaben, weil ihnen das rittermäßige Leben
in der Karolingerzeit zu teuer wurdet
Daß diese Vorstellung mit politischen Mythen der dreißiger Jahre in
Zusammenhang stand, liegt auf der Hand. Über Karl Bosl fand diese Meinung
Eingang in die Handbücher der sechziger und siebziger Jahre: Das adlige
Stammgut sei Ausgangspunkt der Standesqualität gewesen^. In der Perspektive
war zwar ebenfalls Besitz die Grundlage der adligen Stellung, zentral erschien
allerdings keineswegs die Größe, sondern die rechtliche Hervorgehobenheit.
Durchgesetzt hat sich diese Sicht jedoch nicht. Schon Otto Behaghel meinte,
daß ein Bezug zwischen odal (Heimat, später [!] Grundbesitz, Eigentum, Stamm-
gut) und adal (Geschlecht) nirgends erkennbar sei, und fand damit immerhin so-
gar die Zustimmung von Walter Schlesinger^. Zumeist allerdings wurde dieser
Zusammenhang nicht bestritten, jedoch als weniger wichtig eingeschätzt. So mein-
te Krogmann gegen Behaghel, daß die Verbindung adal (Geschlecht) und odal
(Geschlechtsgut) nachzuweisen sei, gegen Neckel allerdings wandte er ein, daß
adal nicht selbst schon den Besitz bezeichne^. Friedrich Vogt meinte, daß die
Begriffe edel und edeli (als Adjektive zu Adal, adal) zunächst nur das Geschlecht,
die Herkunft bezeichneten, worunter bald auch die vornehme Herkunft verstan-
den worden sei. Ein Zusammenhang mit odal im Sinne des freien Erbsitzes sei
erkennbar, aber weniger wichtig. Im 13. und 14. Jahrhundert schließlich seien die
Begriffe verwendet worden, um „seelische Dinge" im Sinne eines Tugendadels zu
kennzeichnen^.
398 Vgl. GRIMM, Rechtsalterthümer, Bd. 1, S. 369, 386.
399 Vgl. NECKEL, Adel, S. 385ff.
400 Vgl. WAAS, Freiheit, S. 11.
401 Vgl. Orro, Adel, S. 37f„ 197.
402 Vgl. BosL, Staat, S. 704.
403 Vgl. BEHAGEL, Odal; SCHLESINGER, Entstehung, S. 88f.
404 Vgl. KROGMANN, Handmahal, S. 139f.; DERS., Adel und Udel; DERS., Rechtsgeschichte.
405 Vgl. F. VOGT, Bedeutungswandel.