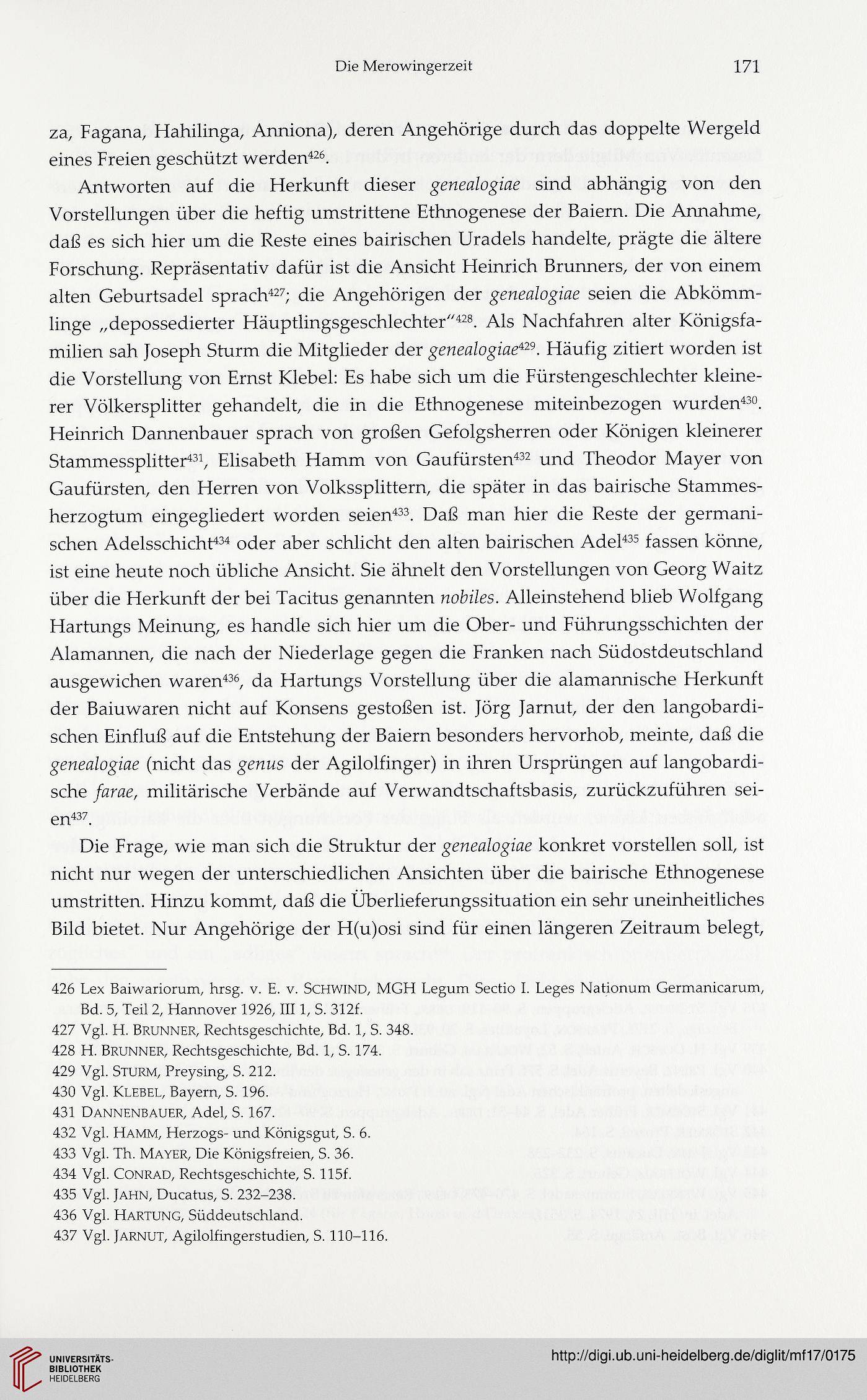Die Merowingerzeit
171
za, Fagana, Hahilinga, Anniona), deren Angehörige durch das doppelte Wergeid
eines Freien geschützt werden^.
Antworten auf die Flerkunft dieser gezzgaZogz'tzc sind abhängig von den
Vorstellungen über die heftig umstrittene Ethnogenese der Baiern. Die Annahme,
daß es sich hier um die Reste eines bairischen Uradels handelte, prägte die ältere
Forschung. Repräsentativ dafür ist die Ansicht Heinrich Brunners, der von einem
alten Geburtsadel sprach^?; die Angehörigen der ygzzczzZogz'zzg seien die Abkömm-
linge „depossedierter HäuptlingsgeschlechterAls Nachfahren alter Königsfa-
milien sah Joseph Sturm die Mitglieder der ggzzgaZogz'ag^. Häufig zitiert worden ist
die Vorstellung von Ernst Klebel: Es habe sich um die Fürstengeschlechter kleine-
rer Völkersplitter gehandelt, die in die Ethnogenese miteinbezogen wurden^.
Heinrich Dannenbauer sprach von großen Gefolgsherren oder Königen kleinerer
Stammessplitter^b Elisabeth Hamm von Gaufürsten^ und Theodor Mayer von
Gaufürsten, den Herren von Volkssplittern, die später in das bairische Stammes-
herzogtum eingegliedert worden seiend Daß man hier die Reste der germani-
schen Adelsschichb^ oder aber schlicht den alten bairischen AdeF^ fassen könne,
ist eine heute noch übliche Ansicht. Sie ähnelt den Vorstellungen von Georg Waitz
über die Herkunft der bei Tacitus genannten zzoMes. Alleinstehend blieb Wolfgang
Hartungs Meinung, es handle sich hier um die Ober- und Führungsschichten der
Alamannen, die nach der Niederlage gegen die Franken nach Südostdeutschland
ausgewichen waren^S da Hartungs Vorstellung über die alamannische Herkunft
der Baiuwaren nicht auf Konsens gestoßen ist. Jörg Jarnut, der den langobardi-
schen Einfluß auf die Entstehung der Baiern besonders hervorhob, meinte, daß die
ggtzgaZogz'ag (nicht das ygzzzzs der Agilolfinger) in ihren Ursprüngen auf langobardi-
sche /zzrgg, militärische Verbände auf Verwandtschaftsbasis, zurückzuführen sei-
en437.
Die Frage, wie man sich die Struktur der ggztgaZoyz'ag konkret vorstellen soll, ist
nicht nur wegen der unterschiedlichen Ansichten über die bairische Ethnogenese
umstritten. Hinzu kommt, daß die Überlieferungssituation ein sehr uneinheitliches
Bild bietet. Nur Angehörige der H(u)osi sind für einen längeren Zeitraum belegt.
426 Lex Baiwariorum, hrsg. v. E. v. SCHWIND, MGH Legum Sectio I. Leges Nationum Germanicarum,
Bd. 5, Teil 2, Hannover 1926, III1, S. 312t.
427 Vgl. H. BRUNNER, Rechtsgeschichte, Bd. 1, S. 348.
428 H. BRUNNER, Rechtsgeschichte, Bd. 1, S. 174.
429 Vgl. STURM, Preysing, S. 212.
430 Vgl. KLEBEL, Bayern, S. 196.
431 DANNENBAUER, Adel, S. 167.
432 Vgl. HAMM, Herzogs- und Königsgut, S. 6.
433 Vgl. Th. MAYER, Die Königsfreien, S. 36.
434 Vgl. CONRAD, Rechtsgeschichte, S. 115f.
435 Vgl. JAHN, Ducatus, S. 232-238.
436 Vgl. HARTUNG, Süddeutschland.
437 Vgl. JARNUT, Agilolfingerstudien, S. 110-116.
171
za, Fagana, Hahilinga, Anniona), deren Angehörige durch das doppelte Wergeid
eines Freien geschützt werden^.
Antworten auf die Flerkunft dieser gezzgaZogz'tzc sind abhängig von den
Vorstellungen über die heftig umstrittene Ethnogenese der Baiern. Die Annahme,
daß es sich hier um die Reste eines bairischen Uradels handelte, prägte die ältere
Forschung. Repräsentativ dafür ist die Ansicht Heinrich Brunners, der von einem
alten Geburtsadel sprach^?; die Angehörigen der ygzzczzZogz'zzg seien die Abkömm-
linge „depossedierter HäuptlingsgeschlechterAls Nachfahren alter Königsfa-
milien sah Joseph Sturm die Mitglieder der ggzzgaZogz'ag^. Häufig zitiert worden ist
die Vorstellung von Ernst Klebel: Es habe sich um die Fürstengeschlechter kleine-
rer Völkersplitter gehandelt, die in die Ethnogenese miteinbezogen wurden^.
Heinrich Dannenbauer sprach von großen Gefolgsherren oder Königen kleinerer
Stammessplitter^b Elisabeth Hamm von Gaufürsten^ und Theodor Mayer von
Gaufürsten, den Herren von Volkssplittern, die später in das bairische Stammes-
herzogtum eingegliedert worden seiend Daß man hier die Reste der germani-
schen Adelsschichb^ oder aber schlicht den alten bairischen AdeF^ fassen könne,
ist eine heute noch übliche Ansicht. Sie ähnelt den Vorstellungen von Georg Waitz
über die Herkunft der bei Tacitus genannten zzoMes. Alleinstehend blieb Wolfgang
Hartungs Meinung, es handle sich hier um die Ober- und Führungsschichten der
Alamannen, die nach der Niederlage gegen die Franken nach Südostdeutschland
ausgewichen waren^S da Hartungs Vorstellung über die alamannische Herkunft
der Baiuwaren nicht auf Konsens gestoßen ist. Jörg Jarnut, der den langobardi-
schen Einfluß auf die Entstehung der Baiern besonders hervorhob, meinte, daß die
ggtzgaZogz'ag (nicht das ygzzzzs der Agilolfinger) in ihren Ursprüngen auf langobardi-
sche /zzrgg, militärische Verbände auf Verwandtschaftsbasis, zurückzuführen sei-
en437.
Die Frage, wie man sich die Struktur der ggztgaZoyz'ag konkret vorstellen soll, ist
nicht nur wegen der unterschiedlichen Ansichten über die bairische Ethnogenese
umstritten. Hinzu kommt, daß die Überlieferungssituation ein sehr uneinheitliches
Bild bietet. Nur Angehörige der H(u)osi sind für einen längeren Zeitraum belegt.
426 Lex Baiwariorum, hrsg. v. E. v. SCHWIND, MGH Legum Sectio I. Leges Nationum Germanicarum,
Bd. 5, Teil 2, Hannover 1926, III1, S. 312t.
427 Vgl. H. BRUNNER, Rechtsgeschichte, Bd. 1, S. 348.
428 H. BRUNNER, Rechtsgeschichte, Bd. 1, S. 174.
429 Vgl. STURM, Preysing, S. 212.
430 Vgl. KLEBEL, Bayern, S. 196.
431 DANNENBAUER, Adel, S. 167.
432 Vgl. HAMM, Herzogs- und Königsgut, S. 6.
433 Vgl. Th. MAYER, Die Königsfreien, S. 36.
434 Vgl. CONRAD, Rechtsgeschichte, S. 115f.
435 Vgl. JAHN, Ducatus, S. 232-238.
436 Vgl. HARTUNG, Süddeutschland.
437 Vgl. JARNUT, Agilolfingerstudien, S. 110-116.