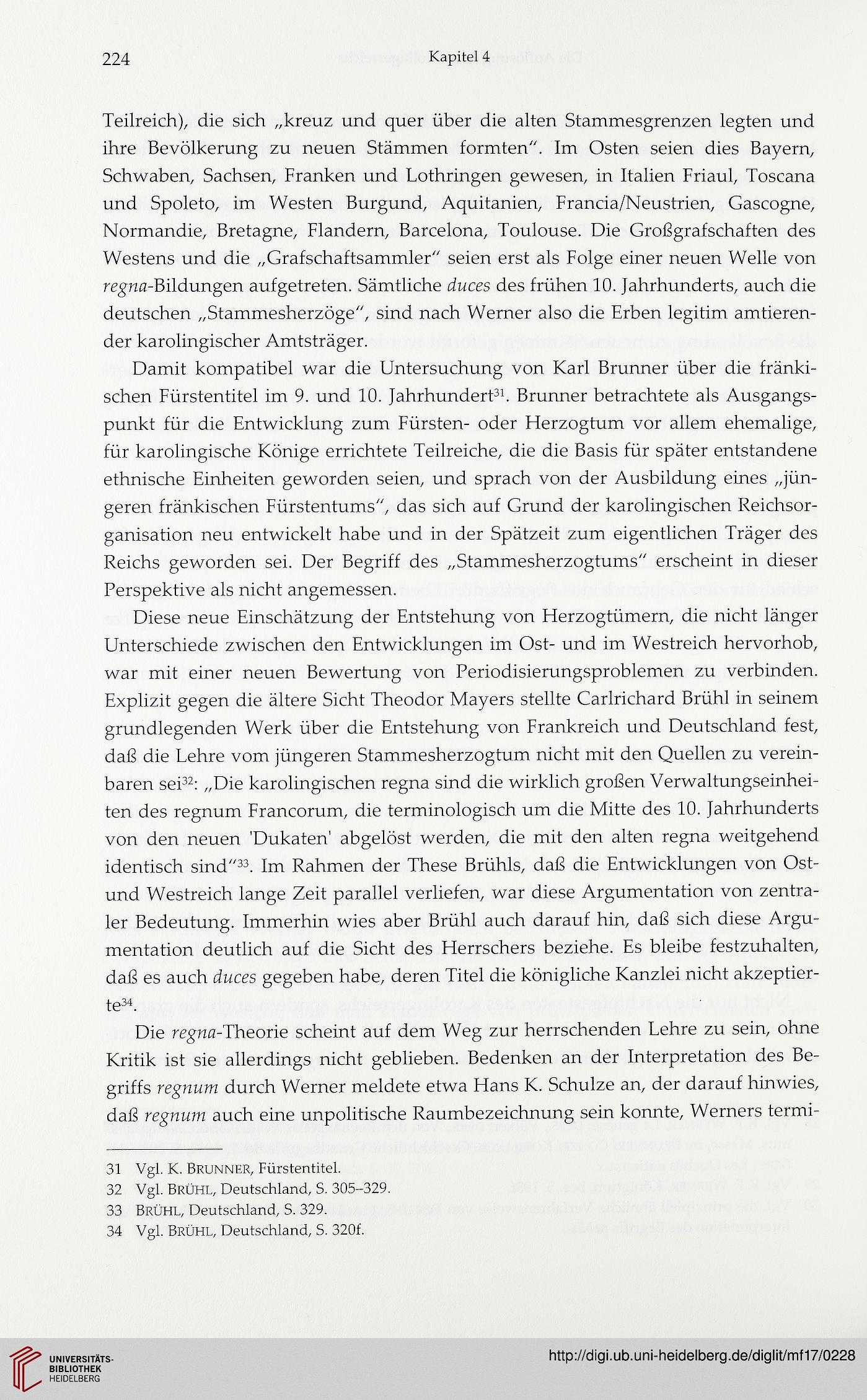224
Kapitel 4
Teilreich), die sich „kreuz und quer über die alten Stammesgrenzen legten und
ihre Bevölkerung zu neuen Stämmen formten". Im Osten seien dies Bayern,
Schwaben, Sachsen, Franken und Lothringen gewesen, in Italien Friaul, Toscana
und Spoleto, im Westen Burgund, Aquitanien, Francia/Neustrien, Gascogne,
Normandie, Bretagne, Flandern, Barcelona, Toulouse. Die Großgrafschaften des
Westens und die „Grafschaftsammler" seien erst als Folge einer neuen Welle von
regna-Bildungen aufgetreten. Sämtliche dzzces des frühen 10. Jahrhunderts, auch die
deutschen „Stammesherzöge", sind nach Werner also die Erben legitim amtieren-
der karolingischer Amtsträger.
Damit kompatibel war die Untersuchung von Karl Brunner über die fränki-
schen Fürstentitel im 9. und 10. Jahrhunderte Brunner betrachtete als Ausgangs-
punkt für die Entwicklung zum Fürsten- oder Herzogtum vor allem ehemalige,
für karolingische Könige errichtete Teilreiche, die die Basis für später entstandene
ethnische Einheiten geworden seien, und sprach von der Ausbildung eines „jün-
geren fränkischen Fürstentums", das sich auf Grund der karolingischen Reichsor-
ganisation neu entwickelt habe und in der Spätzeit zum eigentlichen Träger des
Reichs geworden sei. Der Begriff des „Stammesherzogtums" erscheint in dieser
Perspektive als nicht angemessen.
Diese neue Einschätzung der Entstehung von Herzogtümern, die nicht länger
Unterschiede zwischen den Entwicklungen im Ost- und im Westreich hervorhob,
war mit einer neuen Bewertung von Periodisierungsproblemen zu verbinden.
Explizit gegen die ältere Sicht Theodor Mayers stellte Carlrichard Brühl in seinem
grundlegenden Werk über die Entstehung von Frankreich und Deutschland fest,
daß die Lehre vom jüngeren Stammesherzogtum nicht mit den Quellen zu verein-
baren seiU „Die karolingischen regna sind die wirklich großen Verwaltungseinhei-
ten des regnum Francorum, die terminologisch um die Mitte des 10. Jahrhunderts
von den neuen 'Dukaten' abgelöst werden, die mit den alten regna weitgehend
identisch sind"A Im Rahmen der These Brühls, daß die Entwicklungen von Ost-
und Westreich lange Zeit parallel verliefen, war diese Argumentation von zentra-
ler Bedeutung. Immerhin wies aber Brühl auch darauf hin, daß sich diese Argu-
mentation deutlich auf die Sicht des Herrschers beziehe. Es bleibe festzuhalten,
daß es auch dzzces gegeben habe, deren Titel die königliche Kanzlei nicht akzeptier-
te^.
Die rqgzM-Theorie scheint auf dem Weg zur herrschenden Lehre zu sein, ohne
Kritik ist sie allerdings nicht geblieben. Bedenken an der Interpretation des Be-
griffs Tvyzztwz durch Werner meldete etwa Hans K. Schulze an, der darauf hinwies,
daß rqgnzuzz auch eine unpolitische Raumbezeichnung sein konnte, Werners termi-
31 Vgl. K. BRUNNER, Fürstentitel.
32 Vgl. BRÜHL, Deutschland, S. 305-329.
33 BRÜHL, Deutschland, S. 329.
34 Vgl. BRÜHL, Deutschland, S. 320t.
Kapitel 4
Teilreich), die sich „kreuz und quer über die alten Stammesgrenzen legten und
ihre Bevölkerung zu neuen Stämmen formten". Im Osten seien dies Bayern,
Schwaben, Sachsen, Franken und Lothringen gewesen, in Italien Friaul, Toscana
und Spoleto, im Westen Burgund, Aquitanien, Francia/Neustrien, Gascogne,
Normandie, Bretagne, Flandern, Barcelona, Toulouse. Die Großgrafschaften des
Westens und die „Grafschaftsammler" seien erst als Folge einer neuen Welle von
regna-Bildungen aufgetreten. Sämtliche dzzces des frühen 10. Jahrhunderts, auch die
deutschen „Stammesherzöge", sind nach Werner also die Erben legitim amtieren-
der karolingischer Amtsträger.
Damit kompatibel war die Untersuchung von Karl Brunner über die fränki-
schen Fürstentitel im 9. und 10. Jahrhunderte Brunner betrachtete als Ausgangs-
punkt für die Entwicklung zum Fürsten- oder Herzogtum vor allem ehemalige,
für karolingische Könige errichtete Teilreiche, die die Basis für später entstandene
ethnische Einheiten geworden seien, und sprach von der Ausbildung eines „jün-
geren fränkischen Fürstentums", das sich auf Grund der karolingischen Reichsor-
ganisation neu entwickelt habe und in der Spätzeit zum eigentlichen Träger des
Reichs geworden sei. Der Begriff des „Stammesherzogtums" erscheint in dieser
Perspektive als nicht angemessen.
Diese neue Einschätzung der Entstehung von Herzogtümern, die nicht länger
Unterschiede zwischen den Entwicklungen im Ost- und im Westreich hervorhob,
war mit einer neuen Bewertung von Periodisierungsproblemen zu verbinden.
Explizit gegen die ältere Sicht Theodor Mayers stellte Carlrichard Brühl in seinem
grundlegenden Werk über die Entstehung von Frankreich und Deutschland fest,
daß die Lehre vom jüngeren Stammesherzogtum nicht mit den Quellen zu verein-
baren seiU „Die karolingischen regna sind die wirklich großen Verwaltungseinhei-
ten des regnum Francorum, die terminologisch um die Mitte des 10. Jahrhunderts
von den neuen 'Dukaten' abgelöst werden, die mit den alten regna weitgehend
identisch sind"A Im Rahmen der These Brühls, daß die Entwicklungen von Ost-
und Westreich lange Zeit parallel verliefen, war diese Argumentation von zentra-
ler Bedeutung. Immerhin wies aber Brühl auch darauf hin, daß sich diese Argu-
mentation deutlich auf die Sicht des Herrschers beziehe. Es bleibe festzuhalten,
daß es auch dzzces gegeben habe, deren Titel die königliche Kanzlei nicht akzeptier-
te^.
Die rqgzM-Theorie scheint auf dem Weg zur herrschenden Lehre zu sein, ohne
Kritik ist sie allerdings nicht geblieben. Bedenken an der Interpretation des Be-
griffs Tvyzztwz durch Werner meldete etwa Hans K. Schulze an, der darauf hinwies,
daß rqgnzuzz auch eine unpolitische Raumbezeichnung sein konnte, Werners termi-
31 Vgl. K. BRUNNER, Fürstentitel.
32 Vgl. BRÜHL, Deutschland, S. 305-329.
33 BRÜHL, Deutschland, S. 329.
34 Vgl. BRÜHL, Deutschland, S. 320t.