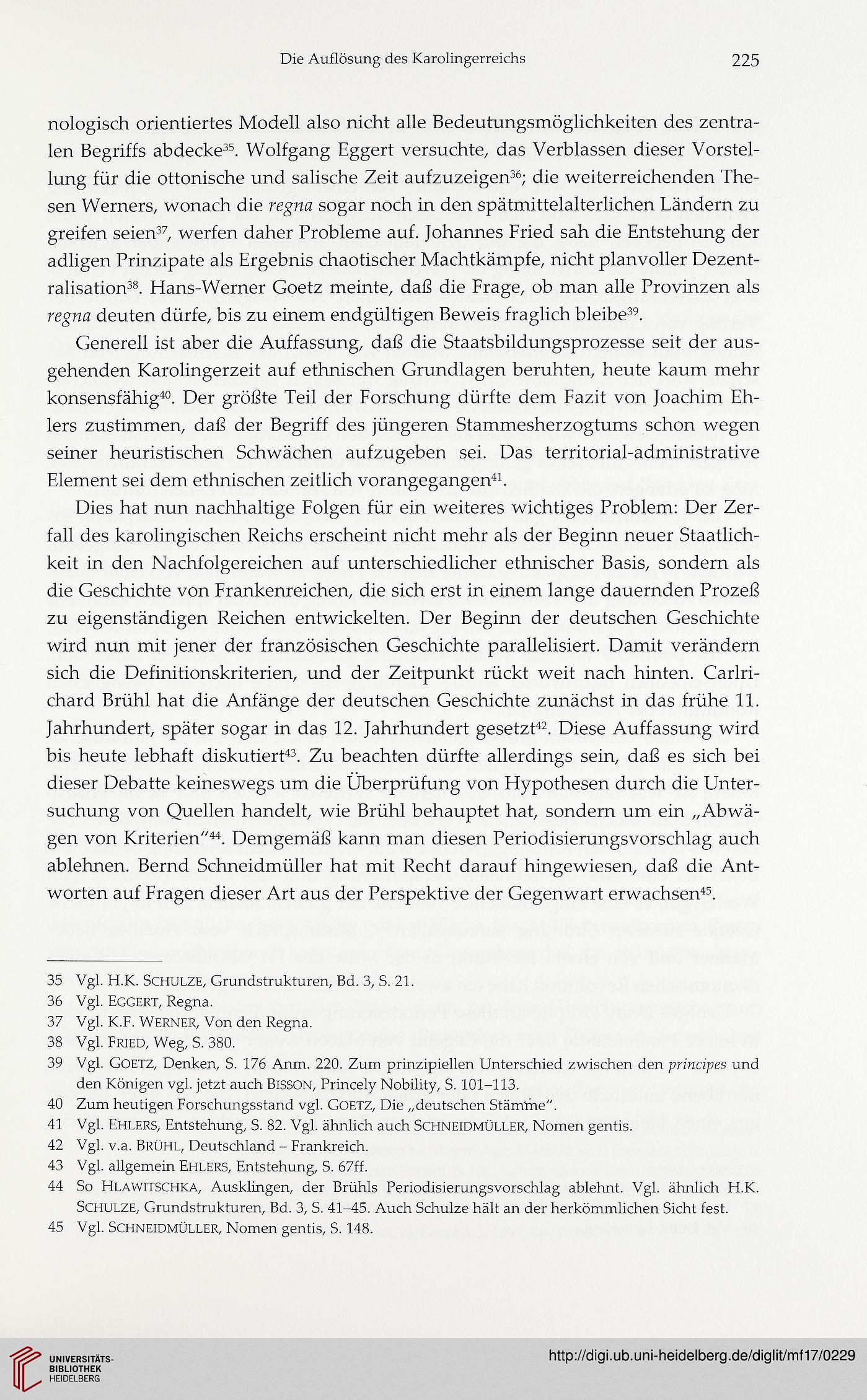Die Auflösung des Karolingerreichs
225
nologisch orientiertes Modell also nicht alle Bedeutungsmöglichkeiten des zentra-
len Begriffs abdeckeA Wolfgang Eggert versuchte, das Verblassen dieser Vorstel-
lung für die ottonische und salische Zeit aufzuzeigen^; die weiterreichenden The-
sen Werners, wonach die rcyrza sogar noch in den spätmittelalterlichen Ländern zu
greifen seierH, werfen daher Probleme auf. Johannes Fried sah die Entstehung der
adligen Prinzipate als Ergebnis chaotischer Machtkämpfe, nicht planvoller Dezent-
ralisation^. Hans-Werner Goetz meinte, daß die Frage, ob man alle Provinzen als
deuten dürfe, bis zu einem endgültigen Beweis fraglich bleibeV
Generell ist aber die Auffassung, daß die Staatsbildungsprozesse seit der aus-
gehenden Karolingerzeit auf ethnischen Grundlagen beruhten, heute kaum mehr
konsensfähigV Der größte Teil der Forschung dürfte dem Fazit von Joachim Eh-
lers zustimmen, daß der Begriff des jüngeren Stammesherzogtums schon wegen
seiner heuristischen Schwächen aufzugeben sei. Das territorial-administrative
Element sei dem ethnischen zeitlich vorangegangenV
Dies hat nun nachhaltige Folgen für ein weiteres wichtiges Problem: Der Zer-
fall des karolingischen Reichs erscheint nicht mehr als der Beginn neuer Staatlich-
keit in den Nachfolgereichen auf unterschiedlicher ethnischer Basis, sondern als
die Geschichte von Frankenreichen, die sich erst in einem lange dauernden Prozeß
zu eigenständigen Reichen entwickelten. Der Beginn der deutschen Geschichte
wird nun mit jener der französischen Geschichte parallelisiert. Damit verändern
sich die Definitionskriterien, und der Zeitpunkt rückt weit nach hinten. Carlri-
chard Brühl hat die Anfänge der deutschen Geschichte zunächst in das frühe 11.
Jahrhundert, später sogar in das 12. Jahrhundert gesetzt^. Diese Auffassung wird
bis heute lebhaft diskutiert^. Zu beachten dürfte allerdings sein, daß es sich bei
dieser Debatte keineswegs um die Überprüfung von Hypothesen durch die Unter-
suchung von Quellen handelt, wie Brühl behauptet hat, sondern um ein „Abwä-
gen von Kriterien"^. Demgemäß kann man diesen Periodisierungsvorschlag auch
ablehnen. Bernd Schneidmüller hat mit Recht darauf hingewiesen, daß die Ant-
worten auf Fragen dieser Art aus der Perspektive der Gegenwart erwachsen^.
35 Vgl. H.K. SCHULZE, Grundstrukturen, Bd. 3, S. 21.
36 Vgl. EGGERT, Regna.
37 Vgl. K.F. WERNER, Von den Regna.
38 Vgl. FRIED, Weg, S. 380.
den Königen vgl. jetzt auch BISSON, Princely Nobility, S. 101-113.
40 Zum heutigen Forschungsstand vgl. GOETZ, Die „deutschen Stämme".
41 Vgl. EHLERS, Entstehung, S. 82. Vgl. ähnlich auch SCHNEIDMÜLLER, Nomen gentis.
42 Vgl. v.a. BRÜHL, Deutschland - Frankreich.
43 Vgl. allgemein EHLERS, Entstehung, S. 67ff.
44 So HLAWITSCHKA, Ausklingen, der Brühls Periodisierungsvorschlag ablehnt. Vgl. ähnlich H.K.
SCHULZE, Grundstrukturen, Bd. 3, S. 41-45. Auch Schulze hält an der herkömmlichen Sicht fest.
45 Vgl. SCHNEIDMÜLLER, Nomen gentis, S. 148.
225
nologisch orientiertes Modell also nicht alle Bedeutungsmöglichkeiten des zentra-
len Begriffs abdeckeA Wolfgang Eggert versuchte, das Verblassen dieser Vorstel-
lung für die ottonische und salische Zeit aufzuzeigen^; die weiterreichenden The-
sen Werners, wonach die rcyrza sogar noch in den spätmittelalterlichen Ländern zu
greifen seierH, werfen daher Probleme auf. Johannes Fried sah die Entstehung der
adligen Prinzipate als Ergebnis chaotischer Machtkämpfe, nicht planvoller Dezent-
ralisation^. Hans-Werner Goetz meinte, daß die Frage, ob man alle Provinzen als
deuten dürfe, bis zu einem endgültigen Beweis fraglich bleibeV
Generell ist aber die Auffassung, daß die Staatsbildungsprozesse seit der aus-
gehenden Karolingerzeit auf ethnischen Grundlagen beruhten, heute kaum mehr
konsensfähigV Der größte Teil der Forschung dürfte dem Fazit von Joachim Eh-
lers zustimmen, daß der Begriff des jüngeren Stammesherzogtums schon wegen
seiner heuristischen Schwächen aufzugeben sei. Das territorial-administrative
Element sei dem ethnischen zeitlich vorangegangenV
Dies hat nun nachhaltige Folgen für ein weiteres wichtiges Problem: Der Zer-
fall des karolingischen Reichs erscheint nicht mehr als der Beginn neuer Staatlich-
keit in den Nachfolgereichen auf unterschiedlicher ethnischer Basis, sondern als
die Geschichte von Frankenreichen, die sich erst in einem lange dauernden Prozeß
zu eigenständigen Reichen entwickelten. Der Beginn der deutschen Geschichte
wird nun mit jener der französischen Geschichte parallelisiert. Damit verändern
sich die Definitionskriterien, und der Zeitpunkt rückt weit nach hinten. Carlri-
chard Brühl hat die Anfänge der deutschen Geschichte zunächst in das frühe 11.
Jahrhundert, später sogar in das 12. Jahrhundert gesetzt^. Diese Auffassung wird
bis heute lebhaft diskutiert^. Zu beachten dürfte allerdings sein, daß es sich bei
dieser Debatte keineswegs um die Überprüfung von Hypothesen durch die Unter-
suchung von Quellen handelt, wie Brühl behauptet hat, sondern um ein „Abwä-
gen von Kriterien"^. Demgemäß kann man diesen Periodisierungsvorschlag auch
ablehnen. Bernd Schneidmüller hat mit Recht darauf hingewiesen, daß die Ant-
worten auf Fragen dieser Art aus der Perspektive der Gegenwart erwachsen^.
35 Vgl. H.K. SCHULZE, Grundstrukturen, Bd. 3, S. 21.
36 Vgl. EGGERT, Regna.
37 Vgl. K.F. WERNER, Von den Regna.
38 Vgl. FRIED, Weg, S. 380.
den Königen vgl. jetzt auch BISSON, Princely Nobility, S. 101-113.
40 Zum heutigen Forschungsstand vgl. GOETZ, Die „deutschen Stämme".
41 Vgl. EHLERS, Entstehung, S. 82. Vgl. ähnlich auch SCHNEIDMÜLLER, Nomen gentis.
42 Vgl. v.a. BRÜHL, Deutschland - Frankreich.
43 Vgl. allgemein EHLERS, Entstehung, S. 67ff.
44 So HLAWITSCHKA, Ausklingen, der Brühls Periodisierungsvorschlag ablehnt. Vgl. ähnlich H.K.
SCHULZE, Grundstrukturen, Bd. 3, S. 41-45. Auch Schulze hält an der herkömmlichen Sicht fest.
45 Vgl. SCHNEIDMÜLLER, Nomen gentis, S. 148.