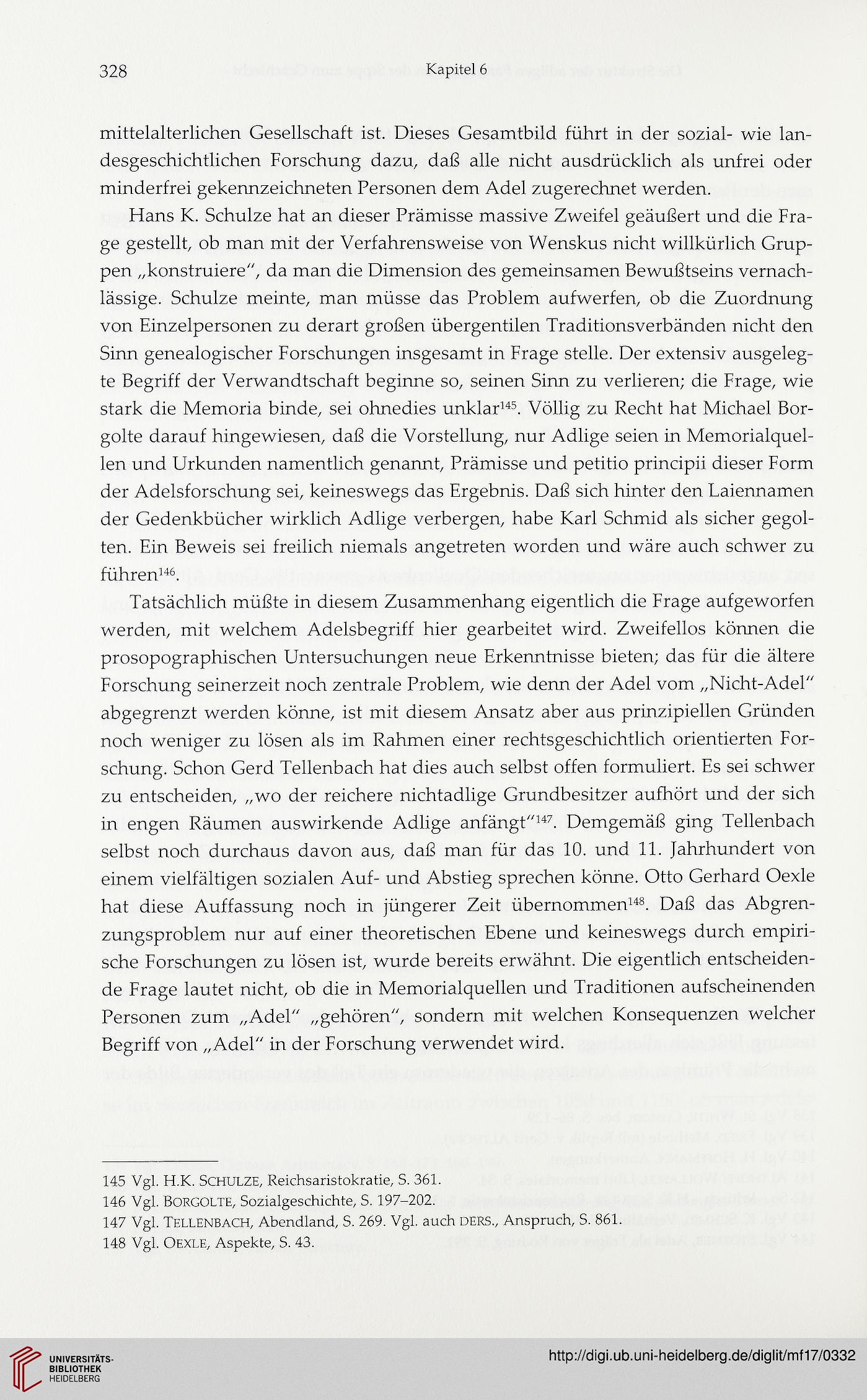328
Kapitel 6
mittelalterlichen Gesellschaft ist. Dieses Gesamtbild führt in der sozial- wie lan-
desgeschichtlichen Forschung dazu, daß alle nicht ausdrücklich als unfrei oder
minderfrei gekennzeichneten Personen dem Adel zugerechnet werden.
Plans K. Schulze hat an dieser Prämisse massive Zweifel geäußert und die Fra-
ge gestellt, ob man mit der Verfahrensweise von Wenskus nicht willkürlich Grup-
pen „konstruiere", da man die Dimension des gemeinsamen Bewußtseins vernach-
lässige. Schulze meinte, man müsse das Problem aufwerfen, ob die Zuordnung
von Einzelpersonen zu derart großen übergentilen Traditionsverbänden nicht den
Sinn genealogischer Forschungen insgesamt in Frage stelle. Der extensiv ausgeleg-
te Begriff der Verwandtschaft beginne so, seinen Sinn zu verlieren; die Frage, wie
stark die Memoria binde, sei ohnedies unklar^. Völlig zu Recht hat Michael Bor-
golte darauf hingewiesen, daß die Vorstellung, nur Adlige seien in Memorialquel-
len und Urkunden namentlich genannt, Prämisse und petitio principii dieser Form
der Adelsforschung sei, keineswegs das Ergebnis. Daß sich hinter den Laiennamen
der Gedenkbücher wirklich Adlige verbergen, habe Karl Schmid als sicher gegol-
ten. Ein Beweis sei freilich niemals angetreten worden und wäre auch schwer zu
führen^.
Tatsächlich müßte in diesem Zusammenhang eigentlich die Frage aufgeworfen
werden, mit welchem Adelsbegriff hier gearbeitet wird. Zweifellos können die
prosopographischen Untersuchungen neue Erkenntnisse bieten; das für die ältere
Forschung seinerzeit noch zentrale Problem, wie denn der Adel vom „Nicht-Adel"
abgegrenzt werden könne, ist mit diesem Ansatz aber aus prinzipiellen Gründen
noch weniger zu lösen als im Rahmen einer rechtsgeschichtlich orientierten For-
schung. Schon Gerd Tellenbach hat dies auch selbst offen formuliert. Es sei schwer
zu entscheiden, „wo der reichere nichtadlige Grundbesitzer aufhört und der sich
in engen Räumen auswirkende Adlige anfängt"^^. Demgemäß ging Tellenbach
selbst noch durchaus davon aus, daß man für das 10. und 11. Jahrhundert von
einem vielfältigen sozialen Auf- und Abstieg sprechen könne. Otto Gerhard Oexle
hat diese Auffassung noch in jüngerer Zeit übernommenes. Daß das Abgren-
zungsproblem nur auf einer theoretischen Ebene und keineswegs durch empiri-
sche Forschungen zu lösen ist, wurde bereits erwähnt. Die eigentlich entscheiden-
de Frage lautet nicht, ob die in Memorialquellen und Traditionen aufscheinenden
Personen zum „Adel" „gehören", sondern mit welchen Konsequenzen welcher
Begriff von „Adel" in der Forschung verwendet wird.
145 Vgl. H.K. SCHULZE, Reichsaristokratie, S. 361.
146 Vgl. BORGOLTE, Sozialgeschichte, S. 197-202.
147 Vgl. TELLENBACH, Abendland, S. 269. Vgl. auch DERS., Anspruch, S. 861.
148 Vgl. OEXLE, Aspekte, S. 43.
Kapitel 6
mittelalterlichen Gesellschaft ist. Dieses Gesamtbild führt in der sozial- wie lan-
desgeschichtlichen Forschung dazu, daß alle nicht ausdrücklich als unfrei oder
minderfrei gekennzeichneten Personen dem Adel zugerechnet werden.
Plans K. Schulze hat an dieser Prämisse massive Zweifel geäußert und die Fra-
ge gestellt, ob man mit der Verfahrensweise von Wenskus nicht willkürlich Grup-
pen „konstruiere", da man die Dimension des gemeinsamen Bewußtseins vernach-
lässige. Schulze meinte, man müsse das Problem aufwerfen, ob die Zuordnung
von Einzelpersonen zu derart großen übergentilen Traditionsverbänden nicht den
Sinn genealogischer Forschungen insgesamt in Frage stelle. Der extensiv ausgeleg-
te Begriff der Verwandtschaft beginne so, seinen Sinn zu verlieren; die Frage, wie
stark die Memoria binde, sei ohnedies unklar^. Völlig zu Recht hat Michael Bor-
golte darauf hingewiesen, daß die Vorstellung, nur Adlige seien in Memorialquel-
len und Urkunden namentlich genannt, Prämisse und petitio principii dieser Form
der Adelsforschung sei, keineswegs das Ergebnis. Daß sich hinter den Laiennamen
der Gedenkbücher wirklich Adlige verbergen, habe Karl Schmid als sicher gegol-
ten. Ein Beweis sei freilich niemals angetreten worden und wäre auch schwer zu
führen^.
Tatsächlich müßte in diesem Zusammenhang eigentlich die Frage aufgeworfen
werden, mit welchem Adelsbegriff hier gearbeitet wird. Zweifellos können die
prosopographischen Untersuchungen neue Erkenntnisse bieten; das für die ältere
Forschung seinerzeit noch zentrale Problem, wie denn der Adel vom „Nicht-Adel"
abgegrenzt werden könne, ist mit diesem Ansatz aber aus prinzipiellen Gründen
noch weniger zu lösen als im Rahmen einer rechtsgeschichtlich orientierten For-
schung. Schon Gerd Tellenbach hat dies auch selbst offen formuliert. Es sei schwer
zu entscheiden, „wo der reichere nichtadlige Grundbesitzer aufhört und der sich
in engen Räumen auswirkende Adlige anfängt"^^. Demgemäß ging Tellenbach
selbst noch durchaus davon aus, daß man für das 10. und 11. Jahrhundert von
einem vielfältigen sozialen Auf- und Abstieg sprechen könne. Otto Gerhard Oexle
hat diese Auffassung noch in jüngerer Zeit übernommenes. Daß das Abgren-
zungsproblem nur auf einer theoretischen Ebene und keineswegs durch empiri-
sche Forschungen zu lösen ist, wurde bereits erwähnt. Die eigentlich entscheiden-
de Frage lautet nicht, ob die in Memorialquellen und Traditionen aufscheinenden
Personen zum „Adel" „gehören", sondern mit welchen Konsequenzen welcher
Begriff von „Adel" in der Forschung verwendet wird.
145 Vgl. H.K. SCHULZE, Reichsaristokratie, S. 361.
146 Vgl. BORGOLTE, Sozialgeschichte, S. 197-202.
147 Vgl. TELLENBACH, Abendland, S. 269. Vgl. auch DERS., Anspruch, S. 861.
148 Vgl. OEXLE, Aspekte, S. 43.