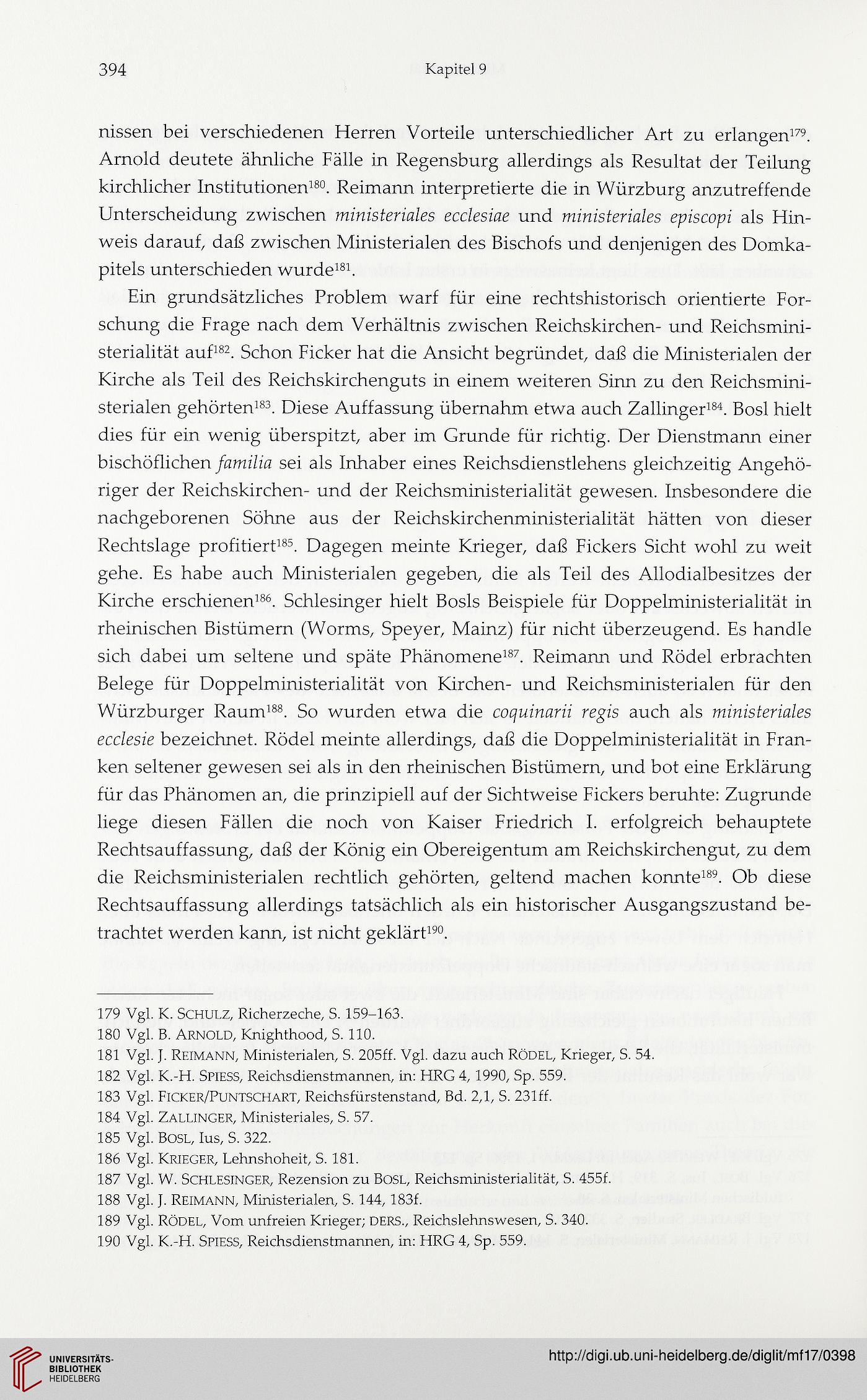394
Kapitel 9
nissen bei verschiedenen Herren Vorteile unterschiedlicher Art zu erlangen^.
Arnold deutete ähnliche Fälle in Regensburg allerdings als Resultat der Teilung
kirchlicher Institutionen^. Reimann interpretierte die in Würzburg anzutreffende
Unterscheidung zwischen zuz'zzzsHrzüUs ecdeszüe und mz'm'sUn'aZgs epzscopz als Hin-
weis darauf, daß zwischen Ministerialen des Bischofs und denjenigen des Domka-
pitels unterschieden wurdet.
Ein grundsätzliches Problem warf für eine rechtshistorisch orientierte For-
schung die Frage nach dem Verhältnis zwischen Reichskirchen- und Reichsmini-
sterialität außsk Schon Ficker hat die Ansicht begründet, daß die Ministerialen der
Kirche als Teil des Reichskirchenguts in einem weiteren Sinn zu den Reichsmini-
sterialen gehörten^. Diese Auffassung übernahm etwa auch ZallingeKA Bosl hielt
dies für ein wenig überspitzt, aber im Grunde für richtig. Der Dienstmann einer
bischöflichen /izmz'üa sei als Inhaber eines Reichsdienstlehens gleichzeitig Angehö-
riger der Reichskirchen- und der Reichsministerialität gewesen. Insbesondere die
nachgeborenen Söhne aus der Reichskirchenministerialität hätten von dieser
Rechtslage profitiert^. Dagegen meinte Krieger, daß Fickers Sicht wohl zu weit
gehe. Es habe auch Ministerialen gegeben, die als Teil des Allodialbesitzes der
Kirche erschienen^. Schlesinger hielt Bosls Beispiele für Doppelministerialität in
rheinischen Bistümern (Worms, Speyer, Mainz) für nicht überzeugend. Es handle
sich dabei um seltene und späte Phänomene^?. Reimann und Rödel erbrachten
Belege für Doppelministerialität von Kirchen- und Reichsministerialen für den
Würzburger RaunV^. So wurden etwa die co^MnMrz'z rggz's auch als mz'rzz'sDrz'Hes
eccigszb bezeichnet. Rödel meinte allerdings, daß die Doppelministerialität in Fran-
ken seltener gewesen sei als in den rheinischen Bistümern, und bot eine Erklärung
für das Phänomen an, die prinzipiell auf der Sichtweise Fickers beruhte: Zugrunde
liege diesen Fällen die noch von Kaiser Friedrich I. erfolgreich behauptete
Rechtsauffassung, daß der König ein Obereigentum am Reichskirchengut, zu dem
die Reichsministerialen rechtlich gehörten, geltend machen konnte^. Ob diese
Rechtsauffassung allerdings tatsächlich als ein historischer Ausgangszustand be-
trachtet werden kann, ist nicht geklärt^".
179 Vgi. K. SCHULZ, Richerzeche, S. 159-163.
180 Vgl. B. ARNOLD, Knighthood, S. 110.
181 Vgl. J. REIMANN, Ministerialen, S. 205ff. Vgl. dazu auch RÖDEL, Krieger, S. 54.
182 Vgl. K.-H. SPIESS, Reichsdienstmannen, in: HRG 4, 1990, Sp. 559.
183 Vgl. FlCKER/PUNTSCHART, Reichsfürstenstand, Bd. 2,1, S. 231ff.
184 Vgl. ZALLINGER, Ministeriales, S. 57.
185 Vgl. BosL, Ius, S. 322.
186 Vgl. KRIEGER, Lehnshoheit, S. 181.
187 Vgl. W. SCHLESINGER, Rezension zu BOSL, Reichsministerialität, S. 455f.
188 Vgl. J. REIMANN, Ministerialen, S. 144, 183f.
189 Vgl. RÖDEL, Vom unfreien Krieger; DERS., Reichslehnswesen, S. 340.
190 Vgl. K.-H. SPIESS, Reichsdienstmannen, in: HRG 4, Sp. 559.
Kapitel 9
nissen bei verschiedenen Herren Vorteile unterschiedlicher Art zu erlangen^.
Arnold deutete ähnliche Fälle in Regensburg allerdings als Resultat der Teilung
kirchlicher Institutionen^. Reimann interpretierte die in Würzburg anzutreffende
Unterscheidung zwischen zuz'zzzsHrzüUs ecdeszüe und mz'm'sUn'aZgs epzscopz als Hin-
weis darauf, daß zwischen Ministerialen des Bischofs und denjenigen des Domka-
pitels unterschieden wurdet.
Ein grundsätzliches Problem warf für eine rechtshistorisch orientierte For-
schung die Frage nach dem Verhältnis zwischen Reichskirchen- und Reichsmini-
sterialität außsk Schon Ficker hat die Ansicht begründet, daß die Ministerialen der
Kirche als Teil des Reichskirchenguts in einem weiteren Sinn zu den Reichsmini-
sterialen gehörten^. Diese Auffassung übernahm etwa auch ZallingeKA Bosl hielt
dies für ein wenig überspitzt, aber im Grunde für richtig. Der Dienstmann einer
bischöflichen /izmz'üa sei als Inhaber eines Reichsdienstlehens gleichzeitig Angehö-
riger der Reichskirchen- und der Reichsministerialität gewesen. Insbesondere die
nachgeborenen Söhne aus der Reichskirchenministerialität hätten von dieser
Rechtslage profitiert^. Dagegen meinte Krieger, daß Fickers Sicht wohl zu weit
gehe. Es habe auch Ministerialen gegeben, die als Teil des Allodialbesitzes der
Kirche erschienen^. Schlesinger hielt Bosls Beispiele für Doppelministerialität in
rheinischen Bistümern (Worms, Speyer, Mainz) für nicht überzeugend. Es handle
sich dabei um seltene und späte Phänomene^?. Reimann und Rödel erbrachten
Belege für Doppelministerialität von Kirchen- und Reichsministerialen für den
Würzburger RaunV^. So wurden etwa die co^MnMrz'z rggz's auch als mz'rzz'sDrz'Hes
eccigszb bezeichnet. Rödel meinte allerdings, daß die Doppelministerialität in Fran-
ken seltener gewesen sei als in den rheinischen Bistümern, und bot eine Erklärung
für das Phänomen an, die prinzipiell auf der Sichtweise Fickers beruhte: Zugrunde
liege diesen Fällen die noch von Kaiser Friedrich I. erfolgreich behauptete
Rechtsauffassung, daß der König ein Obereigentum am Reichskirchengut, zu dem
die Reichsministerialen rechtlich gehörten, geltend machen konnte^. Ob diese
Rechtsauffassung allerdings tatsächlich als ein historischer Ausgangszustand be-
trachtet werden kann, ist nicht geklärt^".
179 Vgi. K. SCHULZ, Richerzeche, S. 159-163.
180 Vgl. B. ARNOLD, Knighthood, S. 110.
181 Vgl. J. REIMANN, Ministerialen, S. 205ff. Vgl. dazu auch RÖDEL, Krieger, S. 54.
182 Vgl. K.-H. SPIESS, Reichsdienstmannen, in: HRG 4, 1990, Sp. 559.
183 Vgl. FlCKER/PUNTSCHART, Reichsfürstenstand, Bd. 2,1, S. 231ff.
184 Vgl. ZALLINGER, Ministeriales, S. 57.
185 Vgl. BosL, Ius, S. 322.
186 Vgl. KRIEGER, Lehnshoheit, S. 181.
187 Vgl. W. SCHLESINGER, Rezension zu BOSL, Reichsministerialität, S. 455f.
188 Vgl. J. REIMANN, Ministerialen, S. 144, 183f.
189 Vgl. RÖDEL, Vom unfreien Krieger; DERS., Reichslehnswesen, S. 340.
190 Vgl. K.-H. SPIESS, Reichsdienstmannen, in: HRG 4, Sp. 559.