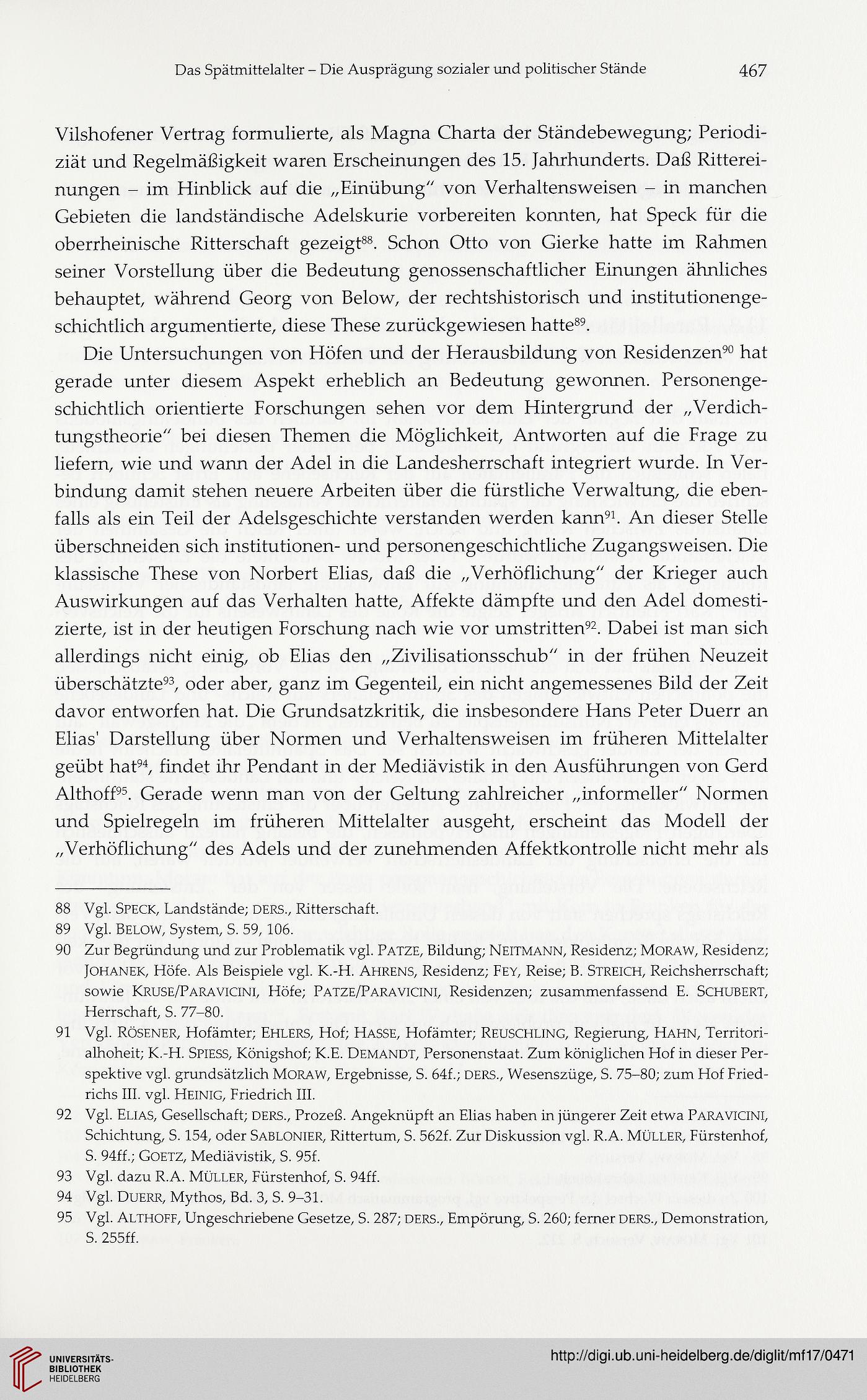Das Spätmittelalter - Die Ausprägung sozialer und politischer Stände
467
Vilshofener Vertrag formulierte, als Magna Charta der Ständebewegung; Periodi-
ziät und Regelmäßigkeit waren Erscheinungen des 15. Jahrhunderts. Daß Ritterei-
nungen - im Hinblick auf die „Einübung" von Verhaltensweisen - in manchen
Gebieten die landständische Adelskurie vorbereiten konnten, hat Speck für die
oberrheinische Ritterschaft gezeigt^. Schon Otto von Gierke hatte im Rahmen
seiner Vorstellung über die Bedeutung genossenschaftlicher Einungen ähnliches
behauptet, während Georg von Below, der rechtshistorisch und institutionenge-
schichtlich argumentierte, diese These zurückgewiesen hattet
Die Untersuchungen von Höfen und der Herausbildung von Residenzen"" hat
gerade unter diesem Aspekt erheblich an Bedeutung gewonnen. Personenge-
schichtlich orientierte Forschungen sehen vor dem Hintergrund der „Verdich-
tungstheorie" bei diesen Themen die Möglichkeit, Antworten auf die Frage zu
liefern, wie und wann der Adel in die Landesherrschaft integriert wurde. In Ver-
bindung damit stehen neuere Arbeiten über die fürstliche Verwaltung, die eben-
falls als ein Teil der Adelsgeschichte verstanden werden kannA An dieser Stelle
überschneiden sich institutionen- und personengeschichtliche Zugangsweisen. Die
klassische These von Norbert Elias, daß die „Verhöflichung" der Krieger auch
Auswirkungen auf das Verhalten hatte, Affekte dämpfte und den Adel domesti-
zierte, ist in der heutigen Forschung nach wie vor umstritten^. Dabei ist man sich
allerdings nicht einig, ob Elias den „Zivilisationsschub" in der frühen Neuzeit
überschätzte"", oder aber, ganz im Gegenteil, ein nicht angemessenes Bild der Zeit
davor entworfen hat. Die Grundsatzkritik, die insbesondere Hans Peter Duerr an
Elias' Darstellung über Normen und Verhaltensweisen im früheren Mittelalter
geübt hatN findet ihr Pendant in der Mediävistik in den Ausführungen von Gerd
Althoff"". Gerade wenn man von der Geltung zahlreicher „informeller" Normen
und Spielregeln im früheren Mittelalter ausgeht, erscheint das Modell der
„Verhöflichung" des Adels und der zunehmenden Affektkontrolle nicht mehr als
88 Vgl. SPECK, Landstände; DERS., Ritterschaft.
89 Vgl. BELOW, System, S. 59, 106.
90 Zur Begründung und zur Problematik vgl. PATZE, Bildung; NEITMANN, Residenz; MORAW, Residenz;
fOHANEK, Höfe. Als Beispiele vgl. K.-H. AHRENS, Residenz; FEY, Reise; B. STREICH, Reichsherrschaft;
sowie KRUSE/P ARA VICINI, Höfe; PATZE/P ARA VICINI, Residenzen; zusammenfassend E. SCHUBERT,
Herrschaft, S. 77-80.
91 Vgl. RÖSENER, Hofämter; EHLERS, Hof; HASSE, Hofämter; REUSCHLING, Regierung, HAHN, Territori-
alhoheit; K.-H. SPIESS, Königshof; K.E. DEMANDT, Personenstaat. Zum königlichen Hof in dieser Per-
spektive vgl. grundsätzlich MORAW, Ergebnisse, S. 64f.; DERS., Wesenszüge, S. 75-80; zum Hof Fried-
richs III. vgl. HEINIG, Friedrich III.
92 Vgl. ELLAS, Gesellschaft; DERS., Prozeß. Angeknüpft an Elias haben in jüngerer Zeit etwa PARA VICINI,
Schichtung, S. 154, oder SABLONIER, Rittertum, S. 562f. Zur Diskussion vgl. R.A. MÜLLER, Fürstenhof,
S. 94ff.; GOETZ, Mediävistik, S. 95f.
93 Vgl. dazu R.A. MÜLLER, Fürstenhof, S. 94ff.
94 Vgl. DuERR, Mythos, Bd. 3, S. 9-31.
95 Vgl. ALTHOFF, Ungeschriebene Gesetze, S. 287; DERS., Empörung, S. 260; ferner DERS., Demonstration,
S. 255ff.
467
Vilshofener Vertrag formulierte, als Magna Charta der Ständebewegung; Periodi-
ziät und Regelmäßigkeit waren Erscheinungen des 15. Jahrhunderts. Daß Ritterei-
nungen - im Hinblick auf die „Einübung" von Verhaltensweisen - in manchen
Gebieten die landständische Adelskurie vorbereiten konnten, hat Speck für die
oberrheinische Ritterschaft gezeigt^. Schon Otto von Gierke hatte im Rahmen
seiner Vorstellung über die Bedeutung genossenschaftlicher Einungen ähnliches
behauptet, während Georg von Below, der rechtshistorisch und institutionenge-
schichtlich argumentierte, diese These zurückgewiesen hattet
Die Untersuchungen von Höfen und der Herausbildung von Residenzen"" hat
gerade unter diesem Aspekt erheblich an Bedeutung gewonnen. Personenge-
schichtlich orientierte Forschungen sehen vor dem Hintergrund der „Verdich-
tungstheorie" bei diesen Themen die Möglichkeit, Antworten auf die Frage zu
liefern, wie und wann der Adel in die Landesherrschaft integriert wurde. In Ver-
bindung damit stehen neuere Arbeiten über die fürstliche Verwaltung, die eben-
falls als ein Teil der Adelsgeschichte verstanden werden kannA An dieser Stelle
überschneiden sich institutionen- und personengeschichtliche Zugangsweisen. Die
klassische These von Norbert Elias, daß die „Verhöflichung" der Krieger auch
Auswirkungen auf das Verhalten hatte, Affekte dämpfte und den Adel domesti-
zierte, ist in der heutigen Forschung nach wie vor umstritten^. Dabei ist man sich
allerdings nicht einig, ob Elias den „Zivilisationsschub" in der frühen Neuzeit
überschätzte"", oder aber, ganz im Gegenteil, ein nicht angemessenes Bild der Zeit
davor entworfen hat. Die Grundsatzkritik, die insbesondere Hans Peter Duerr an
Elias' Darstellung über Normen und Verhaltensweisen im früheren Mittelalter
geübt hatN findet ihr Pendant in der Mediävistik in den Ausführungen von Gerd
Althoff"". Gerade wenn man von der Geltung zahlreicher „informeller" Normen
und Spielregeln im früheren Mittelalter ausgeht, erscheint das Modell der
„Verhöflichung" des Adels und der zunehmenden Affektkontrolle nicht mehr als
88 Vgl. SPECK, Landstände; DERS., Ritterschaft.
89 Vgl. BELOW, System, S. 59, 106.
90 Zur Begründung und zur Problematik vgl. PATZE, Bildung; NEITMANN, Residenz; MORAW, Residenz;
fOHANEK, Höfe. Als Beispiele vgl. K.-H. AHRENS, Residenz; FEY, Reise; B. STREICH, Reichsherrschaft;
sowie KRUSE/P ARA VICINI, Höfe; PATZE/P ARA VICINI, Residenzen; zusammenfassend E. SCHUBERT,
Herrschaft, S. 77-80.
91 Vgl. RÖSENER, Hofämter; EHLERS, Hof; HASSE, Hofämter; REUSCHLING, Regierung, HAHN, Territori-
alhoheit; K.-H. SPIESS, Königshof; K.E. DEMANDT, Personenstaat. Zum königlichen Hof in dieser Per-
spektive vgl. grundsätzlich MORAW, Ergebnisse, S. 64f.; DERS., Wesenszüge, S. 75-80; zum Hof Fried-
richs III. vgl. HEINIG, Friedrich III.
92 Vgl. ELLAS, Gesellschaft; DERS., Prozeß. Angeknüpft an Elias haben in jüngerer Zeit etwa PARA VICINI,
Schichtung, S. 154, oder SABLONIER, Rittertum, S. 562f. Zur Diskussion vgl. R.A. MÜLLER, Fürstenhof,
S. 94ff.; GOETZ, Mediävistik, S. 95f.
93 Vgl. dazu R.A. MÜLLER, Fürstenhof, S. 94ff.
94 Vgl. DuERR, Mythos, Bd. 3, S. 9-31.
95 Vgl. ALTHOFF, Ungeschriebene Gesetze, S. 287; DERS., Empörung, S. 260; ferner DERS., Demonstration,
S. 255ff.