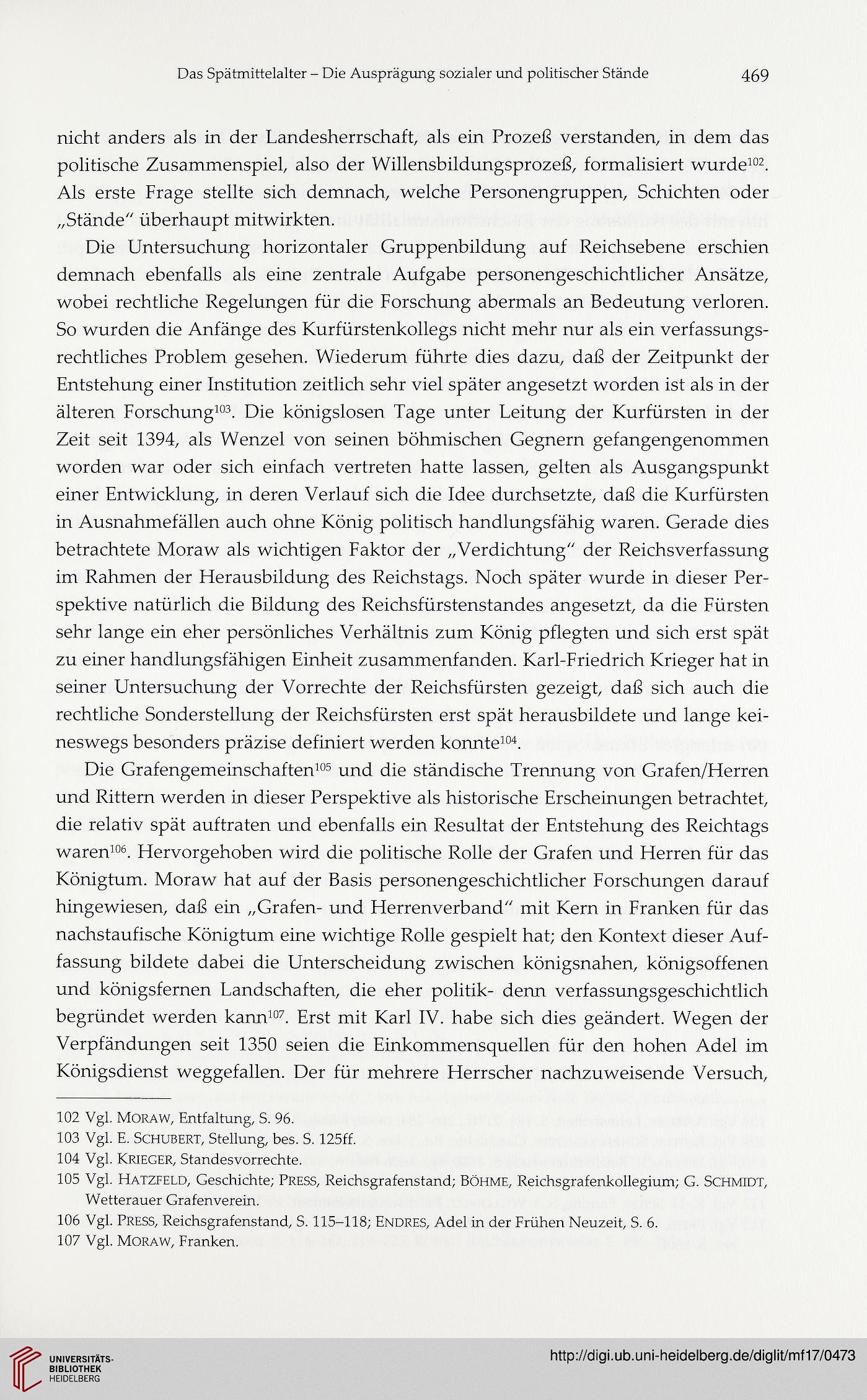Das Spätmittelalter - Die Ausprägung sozialer und politischer Stände
469
nicht anders als in der Landesherrschaft, als ein Prozeß verstanden, in dem das
politische Zusammenspiel, also der Willensbildungsprozeß, formalisiert wurdet
Als erste Frage stellte sich demnach, welche Personengruppen, Schichten oder
„Stände" überhaupt mitwirkten.
Die Untersuchung horizontaler Gruppenbildung auf Reichsebene erschien
demnach ebenfalls als eine zentrale Aufgabe personengeschichtlicher Ansätze,
wobei rechtliche Regelungen für die Forschung abermals an Bedeutung verloren.
So wurden die Anfänge des Kurfürstenkollegs nicht mehr nur als ein verfassungs-
rechtliches Problem gesehen. Wiederum führte dies dazu, daß der Zeitpunkt der
Entstehung einer Institution zeitlich sehr viel später angesetzt worden ist als in der
älteren Forschung^. Die königslosen Tage unter Leitung der Kurfürsten in der
Zeit seit 1394, als Wenzel von seinen böhmischen Gegnern gefangengenommen
worden war oder sich einfach vertreten hatte lassen, gelten als Ausgangspunkt
einer Entwicklung, in deren Verlauf sich die Idee durchsetzte, daß die Kurfürsten
in Ausnahmefällen auch ohne König politisch handlungsfähig waren. Gerade dies
betrachtete Moraw als wichtigen Faktor der „Verdichtung" der Reichsverfassung
im Rahmen der Herausbildung des Reichstags. Noch später wurde in dieser Per-
spektive natürlich die Bildung des Reichsfürstenstandes angesetzt, da die Fürsten
sehr lange ein eher persönliches Verhältnis zum König pflegten und sich erst spät
zu einer handlungsfähigen Einheit zusammenfanden. Karl-Friedrich Krieger hat in
seiner Untersuchung der Vorrechte der Reichsfürsten gezeigt, daß sich auch die
rechtliche Sonderstellung der Reichsfürsten erst spät herausbildete und lange kei-
neswegs besonders präzise definiert werden konnte^.
Die Grafengemeinschaften^ und die ständische Trennung von Grafen/Herren
und Rittern werden in dieser Perspektive als historische Erscheinungen betrachtet,
die relativ spät auftraten und ebenfalls ein Resultat der Entstehung des Reichtags
wareWA Hervorgehoben wird die politische Rolle der Grafen und Herren für das
Königtum. Moraw hat auf der Basis personengeschichtlicher Forschungen darauf
hingewiesen, daß ein „Grafen- und Herrenverband" mit Kern in Franken für das
nachstaufische Königtum eine wichtige Rolle gespielt hat; den Kontext dieser Auf-
fassung bildete dabei die Unterscheidung zwischen königsnahen, königsoffenen
und königsfernen Landschaften, die eher politik- denn verfassungsgeschichtlich
begründet werden kanWA Erst mit Karl IV. habe sich dies geändert. Wegen der
Verpfändungen seit 1350 seien die Einkommensquellen für den hohen Adel im
Königsdienst weggefallen. Der für mehrere Herrscher nachzuweisende Versuch,
102 Vgl. MORAW, Entfaltung, S. 96.
103 Vgl. E. SCHUBERT, Stellung, bes. S. 125ff.
104 Vgl. KRIEGER, Standesvorrechte.
105 Vgl. HATZFELD, Geschichte; PRESS, Reichsgrafenstand; BÖHME, Reichsgrafenkollegium; G. SCHMIDT,
106 Vgl. PRESS, Reichsgrafenstand, S. 115-118; ENDRES, Adel in der Frühen Neuzeit, S. 6.
107 Vgl. MORAW, Franken.
469
nicht anders als in der Landesherrschaft, als ein Prozeß verstanden, in dem das
politische Zusammenspiel, also der Willensbildungsprozeß, formalisiert wurdet
Als erste Frage stellte sich demnach, welche Personengruppen, Schichten oder
„Stände" überhaupt mitwirkten.
Die Untersuchung horizontaler Gruppenbildung auf Reichsebene erschien
demnach ebenfalls als eine zentrale Aufgabe personengeschichtlicher Ansätze,
wobei rechtliche Regelungen für die Forschung abermals an Bedeutung verloren.
So wurden die Anfänge des Kurfürstenkollegs nicht mehr nur als ein verfassungs-
rechtliches Problem gesehen. Wiederum führte dies dazu, daß der Zeitpunkt der
Entstehung einer Institution zeitlich sehr viel später angesetzt worden ist als in der
älteren Forschung^. Die königslosen Tage unter Leitung der Kurfürsten in der
Zeit seit 1394, als Wenzel von seinen böhmischen Gegnern gefangengenommen
worden war oder sich einfach vertreten hatte lassen, gelten als Ausgangspunkt
einer Entwicklung, in deren Verlauf sich die Idee durchsetzte, daß die Kurfürsten
in Ausnahmefällen auch ohne König politisch handlungsfähig waren. Gerade dies
betrachtete Moraw als wichtigen Faktor der „Verdichtung" der Reichsverfassung
im Rahmen der Herausbildung des Reichstags. Noch später wurde in dieser Per-
spektive natürlich die Bildung des Reichsfürstenstandes angesetzt, da die Fürsten
sehr lange ein eher persönliches Verhältnis zum König pflegten und sich erst spät
zu einer handlungsfähigen Einheit zusammenfanden. Karl-Friedrich Krieger hat in
seiner Untersuchung der Vorrechte der Reichsfürsten gezeigt, daß sich auch die
rechtliche Sonderstellung der Reichsfürsten erst spät herausbildete und lange kei-
neswegs besonders präzise definiert werden konnte^.
Die Grafengemeinschaften^ und die ständische Trennung von Grafen/Herren
und Rittern werden in dieser Perspektive als historische Erscheinungen betrachtet,
die relativ spät auftraten und ebenfalls ein Resultat der Entstehung des Reichtags
wareWA Hervorgehoben wird die politische Rolle der Grafen und Herren für das
Königtum. Moraw hat auf der Basis personengeschichtlicher Forschungen darauf
hingewiesen, daß ein „Grafen- und Herrenverband" mit Kern in Franken für das
nachstaufische Königtum eine wichtige Rolle gespielt hat; den Kontext dieser Auf-
fassung bildete dabei die Unterscheidung zwischen königsnahen, königsoffenen
und königsfernen Landschaften, die eher politik- denn verfassungsgeschichtlich
begründet werden kanWA Erst mit Karl IV. habe sich dies geändert. Wegen der
Verpfändungen seit 1350 seien die Einkommensquellen für den hohen Adel im
Königsdienst weggefallen. Der für mehrere Herrscher nachzuweisende Versuch,
102 Vgl. MORAW, Entfaltung, S. 96.
103 Vgl. E. SCHUBERT, Stellung, bes. S. 125ff.
104 Vgl. KRIEGER, Standesvorrechte.
105 Vgl. HATZFELD, Geschichte; PRESS, Reichsgrafenstand; BÖHME, Reichsgrafenkollegium; G. SCHMIDT,
106 Vgl. PRESS, Reichsgrafenstand, S. 115-118; ENDRES, Adel in der Frühen Neuzeit, S. 6.
107 Vgl. MORAW, Franken.