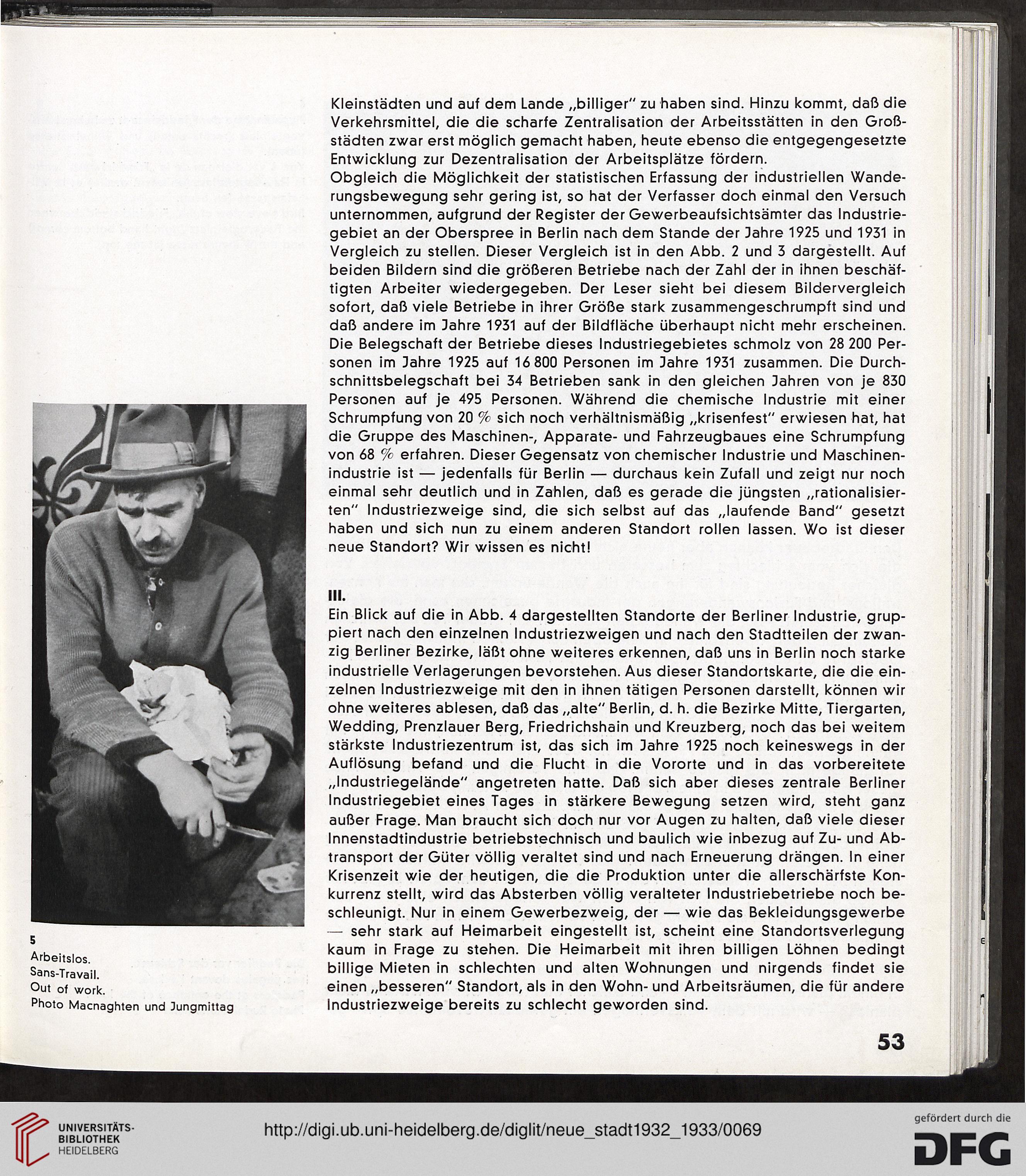Kleinstädten und auf dem Lande „billiger" zu haben sind. Hinzu kommt, daß die
Verkehrsmittel, die die scharfe Zentralisation der Arbeitsstätten in den Groß-
städten zwar erst möglich gemacht haben, heute ebenso die entgegengesetzte
Entwicklung zur Dezentralisation der Arbeitsplätze fördern.
Obgleich die Möglichkeit der statistischen Erfassung der industriellen Wande-
rungsbewegung sehr gering ist, so hat der Verfasser doch einmal den Versuch
unternommen, aufgrund der Register der Gewerbeaufsichtsämter das Industrie-
gebiet an der Oberspree in Berlin nach dem Stande der Jahre 1925 und 1931 in
Vergleich zu stellen. Dieser Vergleich ist in den Abb. 2 und 3 dargestellt. Auf
beiden Bildern sind die größeren Betriebe nach der Zahl der in ihnen beschäf-
tigten Arbeiter wiedergegeben. Der Leser sieht bei diesem Bildervergleich
sofort, daß viele Betriebe in ihrer Größe stark zusammengeschrumpft sind und
daß andere im Jahre 1931 auf der Bildfläche überhaupt nicht mehr erscheinen.
Die Belegschaft der Betriebe dieses Industriegebietes schmolz von 28 200 Per-
sonen im Jahre 1925 auf 16 800 Personen im Jahre 1931 zusammen. Die Durch-
schnittsbelegschaft bei 34 Betrieben sank in den gleichen Jahren von je 830
Personen auf je 495 Personen. Während die chemische Industrie mit einer
Schrumpfung von 20 % sich noch verhältnismäßig „krisenfest" erwiesen hat, hat
die Gruppe des Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbaues eine Schrumpfung
von 68 % erfahren. Dieser Gegensatz von chemischer Industrie und Maschinen-
industrie ist — jedenfalls für Berlin — durchaus kein Zufall und zeigt nur noch
einmal sehr deutlich und in Zahlen, daß es gerade die jüngsten „rationalisier-
ten" Industriezweige sind, die sich selbst auf das „laufende Band" gesetzt
haben und sich nun zu einem anderen Standort rollen lassen. Wo ist dieser
neue Standort? Wir wissen es nicht!
III.
Ein Blick auf die in Abb. 4 dargestellten Standorte der Berliner Industrie, grup-
piert nach den einzelnen Industriezweigen und nach den Stadtteilen der zwan-
zig Berliner Bezirke, läßt ohne weiteres erkennen, daß uns in Berlin noch starke
industrielle Verlagerungen bevorstehen. Aus dieser Standortskarte, die die ein-
zelnen Industriezweige mit den in ihnen tätigen Personen darstellt, können wir
ohne weiteres ablesen, daß das „alte" Berlin, d. h. die Bezirke Mitte, Tiergarten,
Wedding, Prenzlauer Berg, Friedrichshain und Kreuzberg, noch das bei weitem
stärkste Industriezentrum ist, das sich im Jahre 1925 noch keineswegs in der
Auflösung befand und die Flucht in die Vororte und in das vorbereitete
„Industriegelände" angetreten hatte. Daß sich aber dieses zentrale Berliner
Industriegebiet eines Tages in stärkere Bewegung setzen wird, steht ganz
außer Frage. Man braucht sich doch nur vor Augen zu halten, daß viele dieser
Innenstadtindustrie betriebstechnisch und baulich wie inbezug auf Zu- und Ab-
transport der Güter völlig veraltet sind und nach Erneuerung drängen. In einer
Krisenzeit wie der heutigen, die die Produktion unter die allerschärfste Kon-
kurrenz stellt, wird das Absterben völlig veralteter Industriebetriebe noch be-
schleunigt. Nur in einem Gewerbezweig, der — wie das Bekleidungsgewerbe
— sehr stark auf Heimarbeit eingestellt ist, scheint eine Standortsverlegung
kaum in Frage zu stehen. Die Heimarbeit mit ihren billigen Löhnen bedingt
billige Mieten in schlechten und alten Wohnungen und nirgends findet sie
einen „besseren" Standort, als in den Wohn- und Arbeitsräumen, die für andere
Industriezweige bereits zu schlecht geworden sind.
53
Verkehrsmittel, die die scharfe Zentralisation der Arbeitsstätten in den Groß-
städten zwar erst möglich gemacht haben, heute ebenso die entgegengesetzte
Entwicklung zur Dezentralisation der Arbeitsplätze fördern.
Obgleich die Möglichkeit der statistischen Erfassung der industriellen Wande-
rungsbewegung sehr gering ist, so hat der Verfasser doch einmal den Versuch
unternommen, aufgrund der Register der Gewerbeaufsichtsämter das Industrie-
gebiet an der Oberspree in Berlin nach dem Stande der Jahre 1925 und 1931 in
Vergleich zu stellen. Dieser Vergleich ist in den Abb. 2 und 3 dargestellt. Auf
beiden Bildern sind die größeren Betriebe nach der Zahl der in ihnen beschäf-
tigten Arbeiter wiedergegeben. Der Leser sieht bei diesem Bildervergleich
sofort, daß viele Betriebe in ihrer Größe stark zusammengeschrumpft sind und
daß andere im Jahre 1931 auf der Bildfläche überhaupt nicht mehr erscheinen.
Die Belegschaft der Betriebe dieses Industriegebietes schmolz von 28 200 Per-
sonen im Jahre 1925 auf 16 800 Personen im Jahre 1931 zusammen. Die Durch-
schnittsbelegschaft bei 34 Betrieben sank in den gleichen Jahren von je 830
Personen auf je 495 Personen. Während die chemische Industrie mit einer
Schrumpfung von 20 % sich noch verhältnismäßig „krisenfest" erwiesen hat, hat
die Gruppe des Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbaues eine Schrumpfung
von 68 % erfahren. Dieser Gegensatz von chemischer Industrie und Maschinen-
industrie ist — jedenfalls für Berlin — durchaus kein Zufall und zeigt nur noch
einmal sehr deutlich und in Zahlen, daß es gerade die jüngsten „rationalisier-
ten" Industriezweige sind, die sich selbst auf das „laufende Band" gesetzt
haben und sich nun zu einem anderen Standort rollen lassen. Wo ist dieser
neue Standort? Wir wissen es nicht!
III.
Ein Blick auf die in Abb. 4 dargestellten Standorte der Berliner Industrie, grup-
piert nach den einzelnen Industriezweigen und nach den Stadtteilen der zwan-
zig Berliner Bezirke, läßt ohne weiteres erkennen, daß uns in Berlin noch starke
industrielle Verlagerungen bevorstehen. Aus dieser Standortskarte, die die ein-
zelnen Industriezweige mit den in ihnen tätigen Personen darstellt, können wir
ohne weiteres ablesen, daß das „alte" Berlin, d. h. die Bezirke Mitte, Tiergarten,
Wedding, Prenzlauer Berg, Friedrichshain und Kreuzberg, noch das bei weitem
stärkste Industriezentrum ist, das sich im Jahre 1925 noch keineswegs in der
Auflösung befand und die Flucht in die Vororte und in das vorbereitete
„Industriegelände" angetreten hatte. Daß sich aber dieses zentrale Berliner
Industriegebiet eines Tages in stärkere Bewegung setzen wird, steht ganz
außer Frage. Man braucht sich doch nur vor Augen zu halten, daß viele dieser
Innenstadtindustrie betriebstechnisch und baulich wie inbezug auf Zu- und Ab-
transport der Güter völlig veraltet sind und nach Erneuerung drängen. In einer
Krisenzeit wie der heutigen, die die Produktion unter die allerschärfste Kon-
kurrenz stellt, wird das Absterben völlig veralteter Industriebetriebe noch be-
schleunigt. Nur in einem Gewerbezweig, der — wie das Bekleidungsgewerbe
— sehr stark auf Heimarbeit eingestellt ist, scheint eine Standortsverlegung
kaum in Frage zu stehen. Die Heimarbeit mit ihren billigen Löhnen bedingt
billige Mieten in schlechten und alten Wohnungen und nirgends findet sie
einen „besseren" Standort, als in den Wohn- und Arbeitsräumen, die für andere
Industriezweige bereits zu schlecht geworden sind.
53