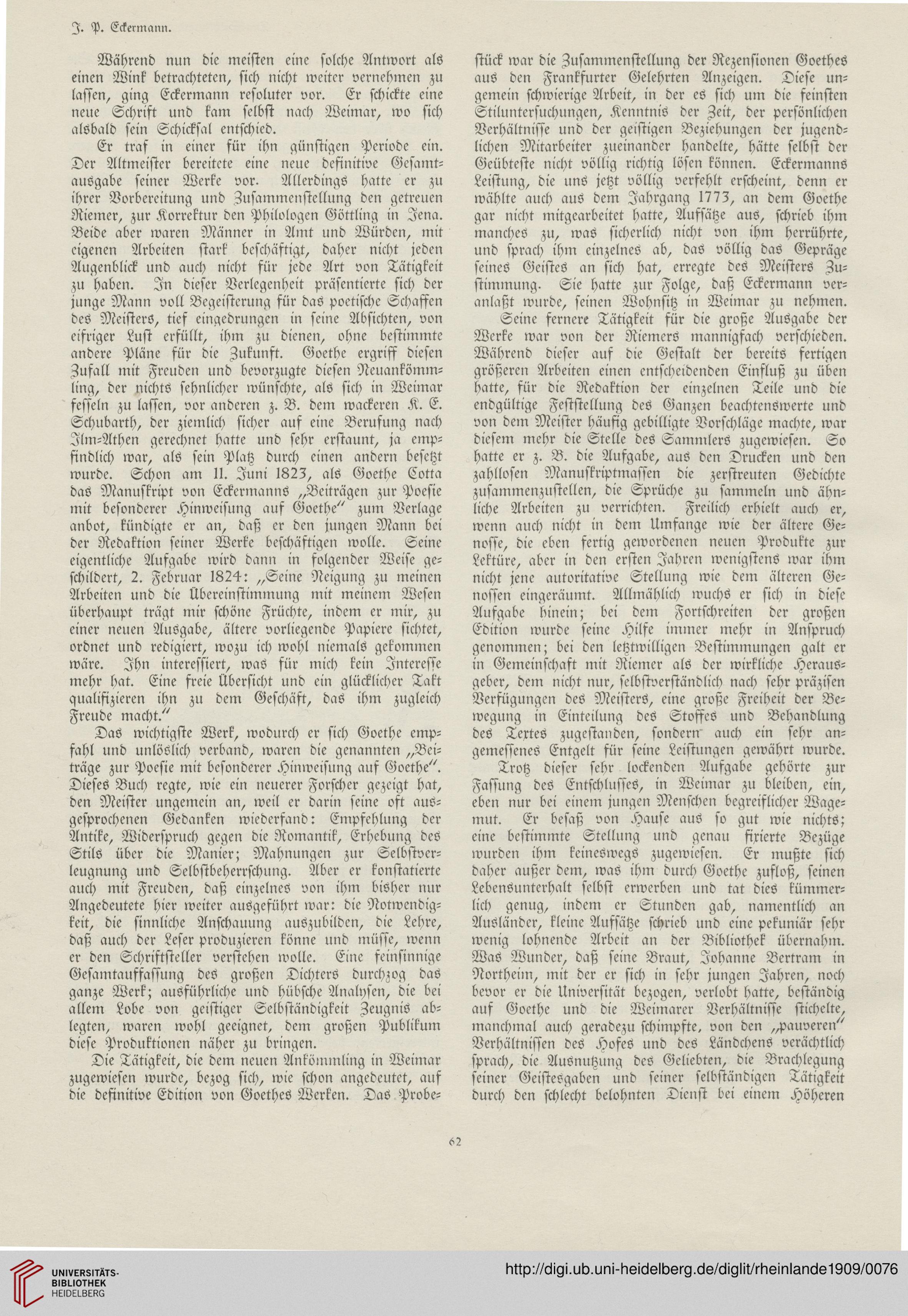I. P. Cckermann.
Während nun die meiften eine solche Antwort als
einen Wink betrachteten, sich nicht weiter vernehmen zu
lassen, ging Eckermann resoluter vor. Er schickte eine
neue Schrift und kam selbft nach Weimar, wo sich
alsbald sein Schicksal entschied.
Er tras in einer für ihn günstigen Periode ein.
Der Altmeifter bereitete eine neue dcfinitive Gcsamt-
ausgabe seiner Werke vor. Allerdings hatte er zu
ihrer Vorbereitung und Zusammenstellung den getreuen
Riemer, zur Korrektur den Philologen Göttling in Jena.
Beide aber waren Männer in Amt und Würden, mit
cigenen Arbeiten ftark beschästigt, daher nicht jeden
Augenblick und auch nicht für jede Art von Tätigkeit
zu haben. Jn dieser Verlegenheit präsentierte sich der
junge Mann voll Begeistcrung für das poetische Schaffen
des MeifterS, tief eingedrungen in seine Absichten, von
eisriger Lust erfüllt, ihm zu dienen, ohne beftimmte
andere Pläne für die Iukunst. Goethe ergriff diesen
Zufall mit Frcuden und bevorzugte diesen Neuankömm-
ling, der nichts sehnlicher wünschte, als sich in Weimar
fesseln zu laffen, vor anderen z. B. dem wackeren K. E.
Schubarth, der ziemlich sicher auf eine Berufung nach
Jlm-Athen gerechnet hatte und sehr erstaunt, ja emp-
findlich war, als sein Platz durch einen andern besetzt
wurde. Schon am II. Iuni I82Z, als Goethe Cotta
das Manuskript von Eckermanns „Beiträgen zur Poesie
mit besonderer Hinweisung auf Goethe" zum Verlage
anbot, kündigte er an, daß er den jungen Mann bei
der Redaktion seincr Werke beschäftigen wolle. Seine
eigentliche Aufgabe wird dann in folgender Weise ge-
schildert, 2. Februar 1824: „Scine Neigung zu meinen
Arbeiten und die Übereinstimmung mit meinem Wesen
überhaupt trägt mir schöne Früchte, indem er mir, zu
einer neuen AuSgabe, ältere vorliegende Papiere sichtet,
ordnet und redigiert, wozu ich wohl niemals gekommen
wäre. Jhn interessiert, waö sür mich kein Jnteresse
mehr hat. Eine freie klbersicht und ein glücklicher Takt
qualifizieren ihn zu dem Geschäft, das ihm zugleich
Freude macht."
Das wichtigste Werk, wodurch er sich Goethe emp-
fahl und unlöslich verband, waren die genannten „Bei-
träge zur Poesie mit besonderer Hinweisung auf Goethe".
Dieses Buch regte, wie ein neuerer Forscher gezeigt hat,
den Meister ungemcin an, weil er darin seine oft aus-
gesprochenen Gedanken wiederfand: Empfehlung der
Antike, Widerspruch gegen die Romantik, Erhebung des
Stils über die Manier; Mahnungen zur Selbstver-
leugnung und Selbstbeherrschung. Aber er konftatierte
auch mit Freuden, daß einzelnes von ihm bisher nur
Angedeutete hier weiter ausgeführt war: die Notwendig-
keit, die sinnliche Anschauung auszubildcn, die Lehre,
daß auch der Leser produzieren könne und müsse, wenn
er den Schriftsteller verstehen wolle. Eine feinsinnige
Gesamtauffassung des großen Dichters durchzog das
ganze Werk; ausführliche und hübsche Analysen, die bei
allem Lobe von geistiger Selbständigkeit Zeugnis ab-
legten, waren wohl geeignet, dem großen Publikum
diese Produktionen näher zu bringen.
Die Tätigkeit, die dem neuen Ankömmling in Weimar
zugewiesen wurde, bezog sich, wie schon angedeutet, auf
die definitive Edition von Goethes Werken. Das Probe-
stück war die Zusammenstellung der Rezensionen Goetheö
aus den Frankfurter Gelehrten Anzeigen. Diese un-
gemein schwierige Arbeit, in der es sich um die feinsten
Stiluntersuchungen, Kenntnis der Ieit, der persönlichen
Verhältnisse und der geistigen Beziehungen der jugend-
lichen Mitarbeiter zueinander handelte, hätte selbst der
Geübteste nicht völlig richtig lösen können. Eckermanns
Leistung, die uns jetzt völlig verfehlt erscheint, denn er
wählte auch auö dem Jahrgang 177 Z, an dem Goethe
gar nicht mitgearbeitet hatte, Aufsätze aus, schrieb ihm
manches zu, was sicherlich nicht von ihm herrührte,
und sprach ihm einzelnes ab, das völlig das Gepräge
seineö Geistes an sich hat, erregte des Meisters Zu-
stimmung- Sie hatte zur Folge, daß Eckermann ver-
anlaßt wurde, seinen Wohnsitz in Weimar zu nehmen.
Seine fernere Tätigkeit für die große Ausgabe der
Werke war von der Riemers mannigfach verschieden.
Während dieser auf die Gestalt der bereits fertigen
größeren Arbeiten einen entscheidenden Einfluß zu üben
hatte, für die Redaktion der einzelnen Teile und die
endgültige Feststellung des Ganzen beachtenswerte und
von dem Meister häufig gebilligte Vorschläge machte, war
diesem mehr die Stelle des Sammlers zugewiesen. So
hatte er z. B. die Aufgabe, aus den Drucken und den
zahllosen Manuskriptmassen die zerftreuten Gedichte
zusammenzustellen, die Sprüche zu sammeln und ähn-
liche Arbeiten zu verrichten. Freilich erhielt auch er,
wenn auch nicht in dem Umfange wie der ältere Ge-
nosse, die eben fertig gewordenen neuen Produkte zur
Lektüre, aber in den ersten Jahren wenigstens war ihm
nicht jene autoritative Stellung wie dem älteren Ge-
nossen eingeräumt. Allmählich wuchs er sich in diese
Aufgabe hinein; bei dem Fortschreiten der großen
Edition wurde seine Hilfe immer mehr in Anspruch
genommen; bei den letztwilligen Beftimmungen galt er
in Gemeinschaft mit Niemer als der wirklichc Heraus-
geber, dem nicht nur, selbstverständlich nach sehr präzisen
Verfügungen des Meifters, eine große Freiheit der Be-
wegung in Einteilung deö Stoffes und Behandlung
des Textes zugestanden, sondern auch ein sehr an-
gemessenes Entgelt für seine Leistungen gewährt wurde.
Trotz dieser sehr lockenden Aufgabe gehörte zur
Fassung des Entschlusses, in Weimar zu bleiben, ein,
eben nur bei einem jungen Menschen begreiflicher Wage-
mut. Er besaß von Hause aus so gut wie nichts;
eine bestimmte Stellung und genau fixierte Bezüge
wurden ihm keineswegs zugewiesen. Er mußte sich
daher außer dem, was ihm durch Goethe zufloß, seinen
Lebensunterhalt selbst erwerben und tat dies kümmer-
lich genug, indem er Stunden gab, namentlich an
Ausländer, kleine Aufsätze schrieb und eine pekuniär sehr
wenig lohnende Arbeit an der Bibliothek übernahm.
Was Wunder, daß seine Braut, Johanne Bertram in
Northeim, mit der er sich in sehr jungen Jahren, noch
bevor er die Universität bezogen, verlobt hatte, beständig
auf Goethe und die Weimarer Verhältnisse stichelte,
manchmal auch geradezu schimpfte, von den ,q>auveren"
Verhältnissen des Hofes und des Ländchens verächtlich
sprach, die Ausnutzung des Geliebten, die Brachlegung
seiner Geistesgaben und seiner selbständigen Tätigkeit
durch den schlecht belohnten Dienst bei einem Höheren
Während nun die meiften eine solche Antwort als
einen Wink betrachteten, sich nicht weiter vernehmen zu
lassen, ging Eckermann resoluter vor. Er schickte eine
neue Schrift und kam selbft nach Weimar, wo sich
alsbald sein Schicksal entschied.
Er tras in einer für ihn günstigen Periode ein.
Der Altmeifter bereitete eine neue dcfinitive Gcsamt-
ausgabe seiner Werke vor. Allerdings hatte er zu
ihrer Vorbereitung und Zusammenstellung den getreuen
Riemer, zur Korrektur den Philologen Göttling in Jena.
Beide aber waren Männer in Amt und Würden, mit
cigenen Arbeiten ftark beschästigt, daher nicht jeden
Augenblick und auch nicht für jede Art von Tätigkeit
zu haben. Jn dieser Verlegenheit präsentierte sich der
junge Mann voll Begeistcrung für das poetische Schaffen
des MeifterS, tief eingedrungen in seine Absichten, von
eisriger Lust erfüllt, ihm zu dienen, ohne beftimmte
andere Pläne für die Iukunst. Goethe ergriff diesen
Zufall mit Frcuden und bevorzugte diesen Neuankömm-
ling, der nichts sehnlicher wünschte, als sich in Weimar
fesseln zu laffen, vor anderen z. B. dem wackeren K. E.
Schubarth, der ziemlich sicher auf eine Berufung nach
Jlm-Athen gerechnet hatte und sehr erstaunt, ja emp-
findlich war, als sein Platz durch einen andern besetzt
wurde. Schon am II. Iuni I82Z, als Goethe Cotta
das Manuskript von Eckermanns „Beiträgen zur Poesie
mit besonderer Hinweisung auf Goethe" zum Verlage
anbot, kündigte er an, daß er den jungen Mann bei
der Redaktion seincr Werke beschäftigen wolle. Seine
eigentliche Aufgabe wird dann in folgender Weise ge-
schildert, 2. Februar 1824: „Scine Neigung zu meinen
Arbeiten und die Übereinstimmung mit meinem Wesen
überhaupt trägt mir schöne Früchte, indem er mir, zu
einer neuen AuSgabe, ältere vorliegende Papiere sichtet,
ordnet und redigiert, wozu ich wohl niemals gekommen
wäre. Jhn interessiert, waö sür mich kein Jnteresse
mehr hat. Eine freie klbersicht und ein glücklicher Takt
qualifizieren ihn zu dem Geschäft, das ihm zugleich
Freude macht."
Das wichtigste Werk, wodurch er sich Goethe emp-
fahl und unlöslich verband, waren die genannten „Bei-
träge zur Poesie mit besonderer Hinweisung auf Goethe".
Dieses Buch regte, wie ein neuerer Forscher gezeigt hat,
den Meister ungemcin an, weil er darin seine oft aus-
gesprochenen Gedanken wiederfand: Empfehlung der
Antike, Widerspruch gegen die Romantik, Erhebung des
Stils über die Manier; Mahnungen zur Selbstver-
leugnung und Selbstbeherrschung. Aber er konftatierte
auch mit Freuden, daß einzelnes von ihm bisher nur
Angedeutete hier weiter ausgeführt war: die Notwendig-
keit, die sinnliche Anschauung auszubildcn, die Lehre,
daß auch der Leser produzieren könne und müsse, wenn
er den Schriftsteller verstehen wolle. Eine feinsinnige
Gesamtauffassung des großen Dichters durchzog das
ganze Werk; ausführliche und hübsche Analysen, die bei
allem Lobe von geistiger Selbständigkeit Zeugnis ab-
legten, waren wohl geeignet, dem großen Publikum
diese Produktionen näher zu bringen.
Die Tätigkeit, die dem neuen Ankömmling in Weimar
zugewiesen wurde, bezog sich, wie schon angedeutet, auf
die definitive Edition von Goethes Werken. Das Probe-
stück war die Zusammenstellung der Rezensionen Goetheö
aus den Frankfurter Gelehrten Anzeigen. Diese un-
gemein schwierige Arbeit, in der es sich um die feinsten
Stiluntersuchungen, Kenntnis der Ieit, der persönlichen
Verhältnisse und der geistigen Beziehungen der jugend-
lichen Mitarbeiter zueinander handelte, hätte selbst der
Geübteste nicht völlig richtig lösen können. Eckermanns
Leistung, die uns jetzt völlig verfehlt erscheint, denn er
wählte auch auö dem Jahrgang 177 Z, an dem Goethe
gar nicht mitgearbeitet hatte, Aufsätze aus, schrieb ihm
manches zu, was sicherlich nicht von ihm herrührte,
und sprach ihm einzelnes ab, das völlig das Gepräge
seineö Geistes an sich hat, erregte des Meisters Zu-
stimmung- Sie hatte zur Folge, daß Eckermann ver-
anlaßt wurde, seinen Wohnsitz in Weimar zu nehmen.
Seine fernere Tätigkeit für die große Ausgabe der
Werke war von der Riemers mannigfach verschieden.
Während dieser auf die Gestalt der bereits fertigen
größeren Arbeiten einen entscheidenden Einfluß zu üben
hatte, für die Redaktion der einzelnen Teile und die
endgültige Feststellung des Ganzen beachtenswerte und
von dem Meister häufig gebilligte Vorschläge machte, war
diesem mehr die Stelle des Sammlers zugewiesen. So
hatte er z. B. die Aufgabe, aus den Drucken und den
zahllosen Manuskriptmassen die zerftreuten Gedichte
zusammenzustellen, die Sprüche zu sammeln und ähn-
liche Arbeiten zu verrichten. Freilich erhielt auch er,
wenn auch nicht in dem Umfange wie der ältere Ge-
nosse, die eben fertig gewordenen neuen Produkte zur
Lektüre, aber in den ersten Jahren wenigstens war ihm
nicht jene autoritative Stellung wie dem älteren Ge-
nossen eingeräumt. Allmählich wuchs er sich in diese
Aufgabe hinein; bei dem Fortschreiten der großen
Edition wurde seine Hilfe immer mehr in Anspruch
genommen; bei den letztwilligen Beftimmungen galt er
in Gemeinschaft mit Niemer als der wirklichc Heraus-
geber, dem nicht nur, selbstverständlich nach sehr präzisen
Verfügungen des Meifters, eine große Freiheit der Be-
wegung in Einteilung deö Stoffes und Behandlung
des Textes zugestanden, sondern auch ein sehr an-
gemessenes Entgelt für seine Leistungen gewährt wurde.
Trotz dieser sehr lockenden Aufgabe gehörte zur
Fassung des Entschlusses, in Weimar zu bleiben, ein,
eben nur bei einem jungen Menschen begreiflicher Wage-
mut. Er besaß von Hause aus so gut wie nichts;
eine bestimmte Stellung und genau fixierte Bezüge
wurden ihm keineswegs zugewiesen. Er mußte sich
daher außer dem, was ihm durch Goethe zufloß, seinen
Lebensunterhalt selbst erwerben und tat dies kümmer-
lich genug, indem er Stunden gab, namentlich an
Ausländer, kleine Aufsätze schrieb und eine pekuniär sehr
wenig lohnende Arbeit an der Bibliothek übernahm.
Was Wunder, daß seine Braut, Johanne Bertram in
Northeim, mit der er sich in sehr jungen Jahren, noch
bevor er die Universität bezogen, verlobt hatte, beständig
auf Goethe und die Weimarer Verhältnisse stichelte,
manchmal auch geradezu schimpfte, von den ,q>auveren"
Verhältnissen des Hofes und des Ländchens verächtlich
sprach, die Ausnutzung des Geliebten, die Brachlegung
seiner Geistesgaben und seiner selbständigen Tätigkeit
durch den schlecht belohnten Dienst bei einem Höheren