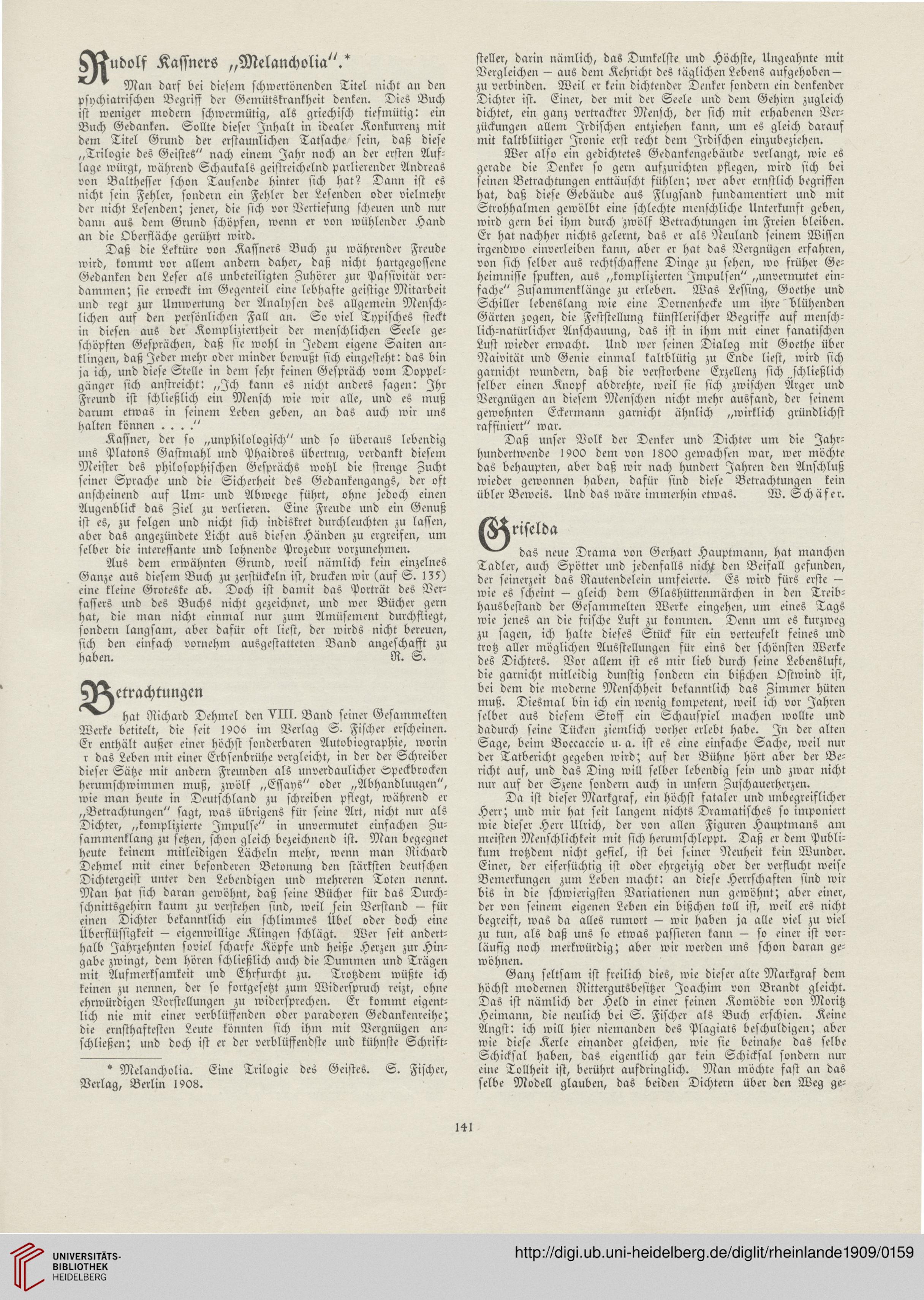udolf Kaffners „Melancholia"?
Man darf bei diesem schwertönenden Titel nicht an den
psychiatrischen Begriff dcr Gemütskrankheit denken. Dies Buch
ist weniger modern schwermütig, als gricchisch tiefmlltig: ein
Buch Gedanken. Sollte dieser Jnhalt in idealer Konkmrenz mit
dem Titel Grund der erstaunlichcn Tatsache sein, daß diese
„Trilogie des Geistes" nach cinem Jahr noch an der ersten Auf-
lage wllrgt, während Schaukals geistreichelnd parlierender Andreas
von Baltheffer schon Tausende hinter sich hat? Dann ist es
nicht sein Fehler, sondern ein Fehler der Lesenden oder vielmehr
der nicht Lesenden; jener, die sich vor Vertiefung scheuen und nur
danri aus dem Grund schöpfen, wenn er von wühlender Hand
an die Oberfläche gerührt wird.
Daß die Lektüre von Kaffners Buch zu währender Freude
wird, kommt vor allem andern daher, daß nicht hartgegoffene
Gedankcn den Leser als unbeteiligten Auhörcr zur Passivität ver-
dammen; sie erweckt im Gegenteil eine lebhafte geistige Mitarbeit
und regt zur Umwertung der Analysen des allgemein Mensch-
lichen auf den persönlichen Fall an. So vicl Typisches steckt
in diesen aus der Kompliziertheit der menschlichen Seele ge-
schöpften Gesprächen, daß sie wohl in Jedem eigene Saiten an-
klingen, daß Jeder mehr oder minder bcwußt sich eingesteht: das bin
ja ich, und diese Stclle in dem sehr feinen Gespräch vom Doppel-
gänger sich anstrcicht: „Jch kann es nicht andcrs sagen! Ihr
Freund ist schließlich ein Mensch wie wir alle, und es muß
darum etwas in seinem Leben geben, an das auch wir uns
halten können . . . ."
Kaffner, der so „unphilologisch" und so überaus lebendig
uns Platons Gastmahl und Phaidros übertrug, verdankt dicsem
Meister des philosophischen Gesprächs wvhl die strenge Zucht
seiner Sprache und die Sicherheit des Gedankengangs, der oft
anscheinend auf Um- und Abwege führt, ohne jcdoch einen
Augenblick das Aiel zu verlieren. Eine Freude und ein Genuß
ist es, zu folgen und nicht sich indiskret durchleuchten zu laffen,
aber das angezündete Licht aus diesen Händen zu ergreifen, um
selber die intereffante und lohnende Prozedur vorzunehmen.
Aus dem erwähnten Grund, weil nämlich kein einzelnes
Ganze aus diesem Buch zu zerstückeln ist, drucken wir (auf S. I Z5)
eine kleine Groteske ab. Doch ist damit das Porträt des Der-
faffers und dcs Buchs nicht gezcichnet, und wer Bücher gern
hat, die man nicht einmal nur zum Amüsement durchfliegt,
sondern langsam, aber dafür oft liest, der wirds nicht bereucn,
sich den einfach vornehm ausgestatteten Band angcschafft zu
haben. R. S.
etrachtungen
hat Richard Dehmcl den ^III. Band seiner Gesammelten
Werke betitelt, die seit IS0ö im Verlag S. Fischer erscheinen.
Cr enthält außer einer höchst sonderbaren Autobiographie, worin
r das Lebcn mit eincr Crbsenbrühe vergleicht, in der der Schreibcr
dieser Sätze mit andern Freunden als unverdaulicher Speckbrocken
herumschwimmen muß, zwölf „Cffays" oder „Abhandluugen",
wie man heute in Deutschland zu schreiben pflegt, während er
„Bctrachtungen" sagt, was übrigens für seine Art, nicht nur als
Dichter, „kompliziertc Jmpulse" in unvermutct cinfachen Au-
sammenklang zu sctzen, schon gleich bezeichnend ist. Man begcgnet
hcute kcinem mitlcidigen Lächeln mehr, wenn man Richard
Dehmel mit ciner besonderen Betonung den stärksten dcutschen
Dichtergeist unter den Lebendigen und mehreren Totcn nennt.
Man hat sich daran gcwöhnt, daß seine Bücher für das Durch-
schnittsgehirn kaum zu verstehen sind, wcil scin Verstand — für
eincn Dichter bekanntlich ein schlimmes Übel odcr doch eine
Übcrflüssigkeit — cigenwilligc Klingen schlägt. Wer seit andert-
halb Jahrzehnten sovicl scharfe Köpfe und heiße Herzen zur Hin-
gabe zwingt, dem hören schließlich auch die Dummen und Trägen
init Aufmerksamkeit und Ehrfurcht zu. Trohdem wüßte ich
keinen zu nennen, der so fortgesetzt zum Widerspruch reizt, ohne
ehrwürdigen Vorstellungen zu widersprechen. Cr kommt eigent-
lich nie mit einer verblüffenden oder paradoren Gedankenrcihe;
die ernsthaftesten Leute könnten sich ihm mit Vergnügen an-
schließen; und doch ist er der verblüffendste und kühnste Schrift-
" Melancholia. Cine Trilogie des Geistes. S. Fischer,
Verlag, Berlin 1-08.
steller, darin nämlich, das Dunkelste und Höchste, Ungeahnte mit
Vergleichen — aus dem Kehricht des täglichen Lebens aufgehoben —
zu verbinden. Weil er kein dichtender Denker sondern ein denkender
Dichter ist. Einer, der mit der Secle und dem Gehirn zugleich
dichtet, ein ganz vertracktcr Mensch, der sich mit erhabenen Ver-
zückungen allcm Irdischen entziehen kann, um es gleich darauf
mit kaltblütiger Jronie erst recht dem Irdischen einzubeziehen.
Wer also ein gedichtetes Gedankengebäude verlangt, wie es
gerade die Denker so gern aufzurichten pflegen, wird sich bei
seinen Betrachtungen enttäuscht fühlen; wer aber ernstlich begriffen
hat, daß diese Gebäude aus Flugsand fundamentiert und mit
Strohhalmen gewölbt eine schlechte mcnschliche Unterkunft geben,
wird gern bei ihm durch zwölf Betrachtungen im Freien bleiben.
Er hat nachher nichts gelernt, das er als Neuland seinem Wiffen
irgendwo einverleiben kann, aber er hat das Vergnügen erfahren,
von sich selber aus rechtschaffene Dinge zu sehen, wo früher Ge-
heimnisse spukten, aus „komplizierten Impulsen" „unvermutet ein-
fache" Zusammenklänge zu erleben. Was Lessing, Gocthe und
Schiller lebenslang wie eine Dornenhecke um ihre blühenden
Gärten zogen, die Feststellung künstlerischer Begriffe aus mensch-
lich-natürlicher Anschauung, das ist in ihm mit einer fanatischen
Lust wieder erwacht. Und wer seinen Dialog mit Goethe über
Naivität und Genie cinmal kaltblütig zu Cnde liest, wird sich
garnicht wundern, daß die verstorbene Cxzellenz sich schlicßlich
selber einen Knopf abdrchte, weil sie sich zwischen Arger und
Vergnügen an diesem Menschen nicht mehr aussand, der seinem
gcwohnten Eckermann garnicht ähnlich „wirklich gründlichst
raffiniert" war.
Daß unser Volk der Denker und Dichter um die Jahr-
hundertwende IY00 dem von 1800 gewachsen war, wer möchte
das behaupten, aber daß wir nach hundert Iahren den Anschluß
wieder gewonnen haben, dafür sind diese Betrachtungen kein
übler Beweis. Und das wäre immerhin ctwas. W. Schäfer.
riselda
das neue Drama «on Gerhart Hauptmann, hat manchen
Tadler, auch Spöttcr und jedenfalls nich^t den Bcifall gefundcn,
der seinerzeit das Rautcndelein umfeierte. Es wird fürs erste —
wie es scheint — gleich dem Glashüttenmärchen in den Treib-
hausbestand der Gesammelten Werke eingehen, um eines Tags
wie jenes an die frische Luft zu kommen. Denn um es kurzweg
zu sagen, ich halte dieses Stück für ein verteufelt feines und
kotz aller möglichen Ausstellungen sür eins der schönsten Werke
des Dichters. Dor allem ist es mir lieb durch seine Lebensluft,
die garnicht mitleidig dunstig sondern ein bißchen Ostwind ist,
bei dem die moderne Menschheit bekanntlich das Aimmer hüten
muß. Diesmal bin ich cin wenig kompetent, weil ich vor Iahren
selber aus diesem Stoff ein Schauspiel machen wollte und
dadurch seine Tücken ziemlich vorher erlebt habe. In der alten
Sage, beim Boccaecio m a. ist es eine einfache Sache, weil nur
der Tatbericht gegeben wird; auf der Bühne hört aber der Be-
richt auf, und das Ding will selber lebendig sein und zwar nicht
nur auf der Szene sondern auch in unsern Auschauerherzen.
Da ist dieser Markgraf, ein höchst fataler und unbegreiflicher
Herr; und mir hat seit langem nichts Dramatisches so imponiert
wie dieser Herr Ulrich, der von allen Figuren Hauptmans am
meisten Menschlichkcit mit sich herumschleppt. Daß er dem Publi-
kum trotzdem nicht gefiel, ist bei seiner Neuheit kein Wunder.
Einer, der eifersüchtig ist oder ehrgcizig oder der verflucht weise
Bemerkungen zum Leben macht: an diese Herrschaften sind wir
bis in die schwierigsten Variationen nun gewöhnt; aber einer,
der von seinem eigenen Lebcn ein bißchen toll ist, weil ers nicht
begreift, was da alles rumort — wir haben ja alle viel zu viel
zu tun, als daß uns so ctwas passicren kann — so einer ist »or-
läufig noch merkwürdig; aber wir werden uns schon daran ge-
wöhnen.
Ganz seltsam ist freilich dies, wie dieser alte Markgraf dem
höchst modernen Nittergutsbesitzer Ioachim von Brandt gleicht.
Das ist nämlich der Held in einer feinen Komödie von Moritz
Heimann, die neulich bci S. Fischer als Buch erschien. Keine
Angst: ich will hier nicmanden des Plagiats beschuldigen; aber
wie diese Kerle cinander gleichen, wie sie beinahe das selbe
Schicksal haben, das eigentlich gar kein Schicksal sondern nur
cine Tollheit ist, berührt aufdringlich. Man möchte fast an das
selbe Modell glauben, das beiden Dichtern über den Weg ge-
Man darf bei diesem schwertönenden Titel nicht an den
psychiatrischen Begriff dcr Gemütskrankheit denken. Dies Buch
ist weniger modern schwermütig, als gricchisch tiefmlltig: ein
Buch Gedanken. Sollte dieser Jnhalt in idealer Konkmrenz mit
dem Titel Grund der erstaunlichcn Tatsache sein, daß diese
„Trilogie des Geistes" nach cinem Jahr noch an der ersten Auf-
lage wllrgt, während Schaukals geistreichelnd parlierender Andreas
von Baltheffer schon Tausende hinter sich hat? Dann ist es
nicht sein Fehler, sondern ein Fehler der Lesenden oder vielmehr
der nicht Lesenden; jener, die sich vor Vertiefung scheuen und nur
danri aus dem Grund schöpfen, wenn er von wühlender Hand
an die Oberfläche gerührt wird.
Daß die Lektüre von Kaffners Buch zu währender Freude
wird, kommt vor allem andern daher, daß nicht hartgegoffene
Gedankcn den Leser als unbeteiligten Auhörcr zur Passivität ver-
dammen; sie erweckt im Gegenteil eine lebhafte geistige Mitarbeit
und regt zur Umwertung der Analysen des allgemein Mensch-
lichen auf den persönlichen Fall an. So vicl Typisches steckt
in diesen aus der Kompliziertheit der menschlichen Seele ge-
schöpften Gesprächen, daß sie wohl in Jedem eigene Saiten an-
klingen, daß Jeder mehr oder minder bcwußt sich eingesteht: das bin
ja ich, und diese Stclle in dem sehr feinen Gespräch vom Doppel-
gänger sich anstrcicht: „Jch kann es nicht andcrs sagen! Ihr
Freund ist schließlich ein Mensch wie wir alle, und es muß
darum etwas in seinem Leben geben, an das auch wir uns
halten können . . . ."
Kaffner, der so „unphilologisch" und so überaus lebendig
uns Platons Gastmahl und Phaidros übertrug, verdankt dicsem
Meister des philosophischen Gesprächs wvhl die strenge Zucht
seiner Sprache und die Sicherheit des Gedankengangs, der oft
anscheinend auf Um- und Abwege führt, ohne jcdoch einen
Augenblick das Aiel zu verlieren. Eine Freude und ein Genuß
ist es, zu folgen und nicht sich indiskret durchleuchten zu laffen,
aber das angezündete Licht aus diesen Händen zu ergreifen, um
selber die intereffante und lohnende Prozedur vorzunehmen.
Aus dem erwähnten Grund, weil nämlich kein einzelnes
Ganze aus diesem Buch zu zerstückeln ist, drucken wir (auf S. I Z5)
eine kleine Groteske ab. Doch ist damit das Porträt des Der-
faffers und dcs Buchs nicht gezcichnet, und wer Bücher gern
hat, die man nicht einmal nur zum Amüsement durchfliegt,
sondern langsam, aber dafür oft liest, der wirds nicht bereucn,
sich den einfach vornehm ausgestatteten Band angcschafft zu
haben. R. S.
etrachtungen
hat Richard Dehmcl den ^III. Band seiner Gesammelten
Werke betitelt, die seit IS0ö im Verlag S. Fischer erscheinen.
Cr enthält außer einer höchst sonderbaren Autobiographie, worin
r das Lebcn mit eincr Crbsenbrühe vergleicht, in der der Schreibcr
dieser Sätze mit andern Freunden als unverdaulicher Speckbrocken
herumschwimmen muß, zwölf „Cffays" oder „Abhandluugen",
wie man heute in Deutschland zu schreiben pflegt, während er
„Bctrachtungen" sagt, was übrigens für seine Art, nicht nur als
Dichter, „kompliziertc Jmpulse" in unvermutct cinfachen Au-
sammenklang zu sctzen, schon gleich bezeichnend ist. Man begcgnet
hcute kcinem mitlcidigen Lächeln mehr, wenn man Richard
Dehmel mit ciner besonderen Betonung den stärksten dcutschen
Dichtergeist unter den Lebendigen und mehreren Totcn nennt.
Man hat sich daran gcwöhnt, daß seine Bücher für das Durch-
schnittsgehirn kaum zu verstehen sind, wcil scin Verstand — für
eincn Dichter bekanntlich ein schlimmes Übel odcr doch eine
Übcrflüssigkeit — cigenwilligc Klingen schlägt. Wer seit andert-
halb Jahrzehnten sovicl scharfe Köpfe und heiße Herzen zur Hin-
gabe zwingt, dem hören schließlich auch die Dummen und Trägen
init Aufmerksamkeit und Ehrfurcht zu. Trohdem wüßte ich
keinen zu nennen, der so fortgesetzt zum Widerspruch reizt, ohne
ehrwürdigen Vorstellungen zu widersprechen. Cr kommt eigent-
lich nie mit einer verblüffenden oder paradoren Gedankenrcihe;
die ernsthaftesten Leute könnten sich ihm mit Vergnügen an-
schließen; und doch ist er der verblüffendste und kühnste Schrift-
" Melancholia. Cine Trilogie des Geistes. S. Fischer,
Verlag, Berlin 1-08.
steller, darin nämlich, das Dunkelste und Höchste, Ungeahnte mit
Vergleichen — aus dem Kehricht des täglichen Lebens aufgehoben —
zu verbinden. Weil er kein dichtender Denker sondern ein denkender
Dichter ist. Einer, der mit der Secle und dem Gehirn zugleich
dichtet, ein ganz vertracktcr Mensch, der sich mit erhabenen Ver-
zückungen allcm Irdischen entziehen kann, um es gleich darauf
mit kaltblütiger Jronie erst recht dem Irdischen einzubeziehen.
Wer also ein gedichtetes Gedankengebäude verlangt, wie es
gerade die Denker so gern aufzurichten pflegen, wird sich bei
seinen Betrachtungen enttäuscht fühlen; wer aber ernstlich begriffen
hat, daß diese Gebäude aus Flugsand fundamentiert und mit
Strohhalmen gewölbt eine schlechte mcnschliche Unterkunft geben,
wird gern bei ihm durch zwölf Betrachtungen im Freien bleiben.
Er hat nachher nichts gelernt, das er als Neuland seinem Wiffen
irgendwo einverleiben kann, aber er hat das Vergnügen erfahren,
von sich selber aus rechtschaffene Dinge zu sehen, wo früher Ge-
heimnisse spukten, aus „komplizierten Impulsen" „unvermutet ein-
fache" Zusammenklänge zu erleben. Was Lessing, Gocthe und
Schiller lebenslang wie eine Dornenhecke um ihre blühenden
Gärten zogen, die Feststellung künstlerischer Begriffe aus mensch-
lich-natürlicher Anschauung, das ist in ihm mit einer fanatischen
Lust wieder erwacht. Und wer seinen Dialog mit Goethe über
Naivität und Genie cinmal kaltblütig zu Cnde liest, wird sich
garnicht wundern, daß die verstorbene Cxzellenz sich schlicßlich
selber einen Knopf abdrchte, weil sie sich zwischen Arger und
Vergnügen an diesem Menschen nicht mehr aussand, der seinem
gcwohnten Eckermann garnicht ähnlich „wirklich gründlichst
raffiniert" war.
Daß unser Volk der Denker und Dichter um die Jahr-
hundertwende IY00 dem von 1800 gewachsen war, wer möchte
das behaupten, aber daß wir nach hundert Iahren den Anschluß
wieder gewonnen haben, dafür sind diese Betrachtungen kein
übler Beweis. Und das wäre immerhin ctwas. W. Schäfer.
riselda
das neue Drama «on Gerhart Hauptmann, hat manchen
Tadler, auch Spöttcr und jedenfalls nich^t den Bcifall gefundcn,
der seinerzeit das Rautcndelein umfeierte. Es wird fürs erste —
wie es scheint — gleich dem Glashüttenmärchen in den Treib-
hausbestand der Gesammelten Werke eingehen, um eines Tags
wie jenes an die frische Luft zu kommen. Denn um es kurzweg
zu sagen, ich halte dieses Stück für ein verteufelt feines und
kotz aller möglichen Ausstellungen sür eins der schönsten Werke
des Dichters. Dor allem ist es mir lieb durch seine Lebensluft,
die garnicht mitleidig dunstig sondern ein bißchen Ostwind ist,
bei dem die moderne Menschheit bekanntlich das Aimmer hüten
muß. Diesmal bin ich cin wenig kompetent, weil ich vor Iahren
selber aus diesem Stoff ein Schauspiel machen wollte und
dadurch seine Tücken ziemlich vorher erlebt habe. In der alten
Sage, beim Boccaecio m a. ist es eine einfache Sache, weil nur
der Tatbericht gegeben wird; auf der Bühne hört aber der Be-
richt auf, und das Ding will selber lebendig sein und zwar nicht
nur auf der Szene sondern auch in unsern Auschauerherzen.
Da ist dieser Markgraf, ein höchst fataler und unbegreiflicher
Herr; und mir hat seit langem nichts Dramatisches so imponiert
wie dieser Herr Ulrich, der von allen Figuren Hauptmans am
meisten Menschlichkcit mit sich herumschleppt. Daß er dem Publi-
kum trotzdem nicht gefiel, ist bei seiner Neuheit kein Wunder.
Einer, der eifersüchtig ist oder ehrgcizig oder der verflucht weise
Bemerkungen zum Leben macht: an diese Herrschaften sind wir
bis in die schwierigsten Variationen nun gewöhnt; aber einer,
der von seinem eigenen Lebcn ein bißchen toll ist, weil ers nicht
begreift, was da alles rumort — wir haben ja alle viel zu viel
zu tun, als daß uns so ctwas passicren kann — so einer ist »or-
läufig noch merkwürdig; aber wir werden uns schon daran ge-
wöhnen.
Ganz seltsam ist freilich dies, wie dieser alte Markgraf dem
höchst modernen Nittergutsbesitzer Ioachim von Brandt gleicht.
Das ist nämlich der Held in einer feinen Komödie von Moritz
Heimann, die neulich bci S. Fischer als Buch erschien. Keine
Angst: ich will hier nicmanden des Plagiats beschuldigen; aber
wie diese Kerle cinander gleichen, wie sie beinahe das selbe
Schicksal haben, das eigentlich gar kein Schicksal sondern nur
cine Tollheit ist, berührt aufdringlich. Man möchte fast an das
selbe Modell glauben, das beiden Dichtern über den Weg ge-