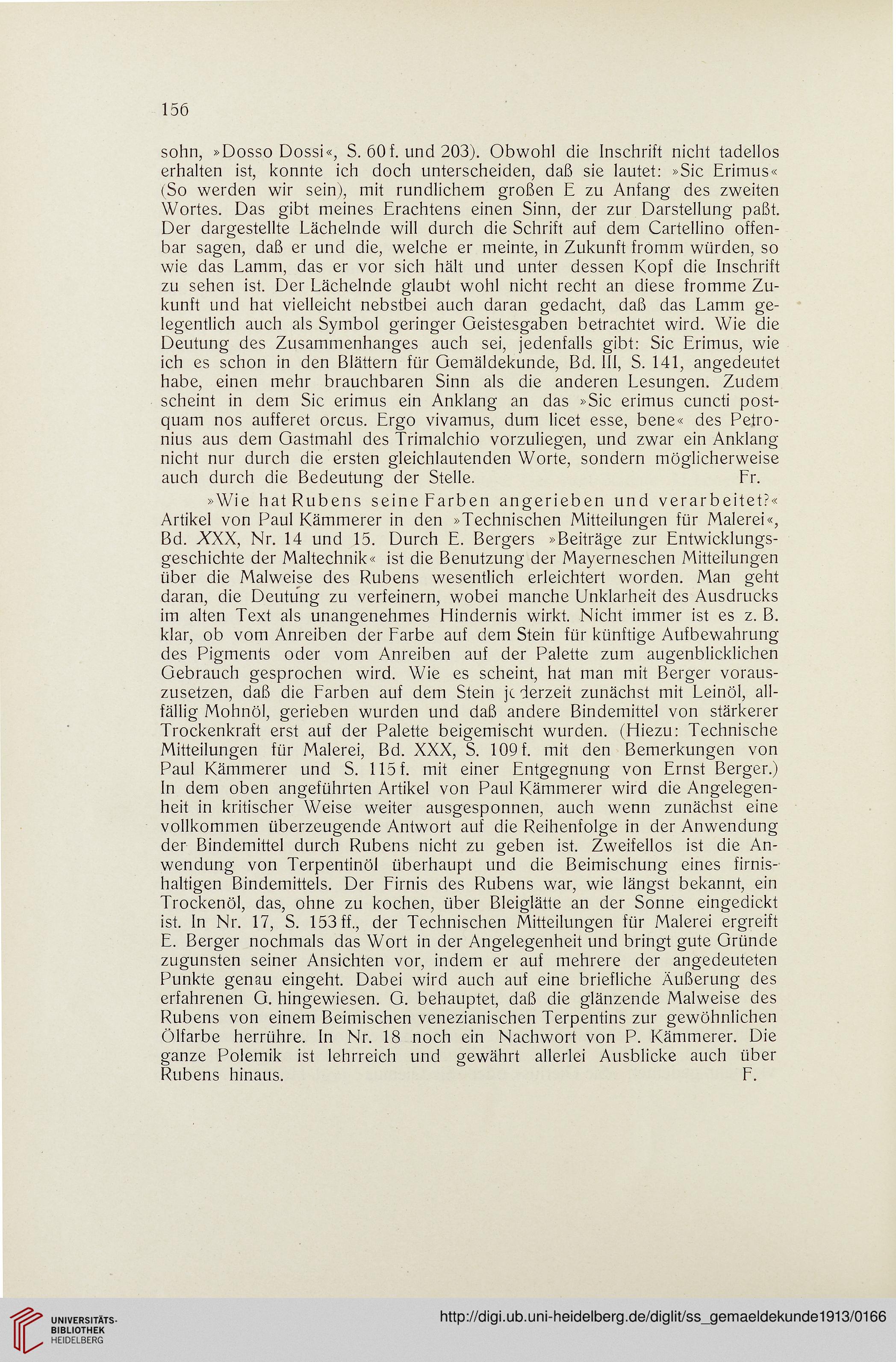156
sohn, »DossoDossi«, S. 60f. und 203). Obwoh! die Inschrift nicht tadellos
erhatten ist, konnte ich doch unterscheiden, daß sie iautet: »Sic Erimus«
(So werden wir sein), mit rundiichem großen E zu Anfang des zweiten
Wortes. Das gibt meines Erachtens einen Sinn, der zur Darstellung paßt.
Der dargestellte Lächeinde wi!) durch die Schrift auf dem Cartellino offen-
bar sagen, daß er und die, weiche er meinte, in Zukunft fromm würden, so
wie das Lamm, das er vor sich häit und unter dessen Kopf die inschrift
zu sehen ist. Der Lächelnde glaubt wohl nicht recht an diese fromme Zu-
kunft und hat vielleicht nebstbei auch daran gedacht, daß das Lamm ge-
legentlich auch als Symbol geringer Geistesgaben betrachtet wird. Wie die
Deutung des Zusammenhanges auch sei, jedenfalls gibt: Sic Erimus, wie
ich es schon in den Blättern für Gemäldekunde, Bd. 111, S. 141, angedeutet
habe, einen mehr brauchbaren Sinn als die anderen Lesungen. Zudem
scheint in dem Sic erimus ein Anklang an das »Sic erimus cuncti post-
quam nos aufferet orcus. Ergo vivamus, dum licet esse, bene« des Petro-
nius aus dem Gastmahl des Trimalchio vorzuliegen, und zwar ein Anklang
nicht nur durch die ersten gleichlautenden Worte, sondern möglicherweise
auch durch die Bedeutung der Stelle. Er.
»Wie hat Rubens seine Farben angerieben und verarbeitet?«
Artikel von Paul Kämmerer in den »Technischen Mitteilungen für Malerei«,
Bd. XXX, Nr. 14 und 15. Durch E. Bergers »Beiträge zur Entwicklungs-
geschichte der Maltechnik« ist die Benutzung der Mayerneschen Mitteilungen
über die Malweise des Rubens wesentlich erleichtert worden. Man geht
daran, die Deutung zu verfeinern, wobei manche Unklarheit des Ausdrucks
im alten Text als unangenehmes Hindernis wirkt. Nicht immer ist es z. B.
klar, ob vom Anreiben der Farbe auf dem Stein für künftige Aufbewahrung
des Pigments oder vom Anreiben auf der Palette zum augenblicklichen
Gebrauch gesprochen wird. Wie es scheint, hat man mit Berger voraus-
zusetzen, daß die Farben auf dem Stein j( derzeit zunächst mit Leinöl, all-
fällig Mohnöl, gerieben wurden und daß andere Bindemittel von stärkerer
Trockenkraft erst auf der Palette beigemischt wurden. (Hiezu: Technische
Mitteilungen für Malerei, Bd. XXX, S. 109f. mit den Bemerkungen von
Paul Kämmerer und S. 115f. mit einer Entgegnung von Ernst Berger.)
ln dem oben angeführten Artikel von Paul Kämmerer wird die Angelegen-
heit in kritischer Weise weiter ausgesponnen, auch wenn zunächst eine
vollkommen überzeugende Antwort auf die Reihenfolge in der Anwendung
der Bindemittel durch Rubens nicht zu geben ist. Zweifellos ist die An-
wendung von Terpentinöl überhaupt und die Beimischung eines firnis-
haltigen Bindemittels. Der Firnis des Rubens war, wie längst bekannt, ein
Trockenöl, das, ohne zu kochen, über Bleiglätte an der Sonne eingedickt
ist. ln Nr. 17, S. 153 ff., der Technischen Mitteilungen für Malerei ergreift
E. Berger nochmals das Wort in der Angelegenheit und bringt gute Gründe
zugunsten seiner Ansichten vor, indem er auf mehrere der angedeuteten
Punkte genau eingeht. Dabei wird auch auf eine briefliche Äußerung des
erfahrenen G. hingewiesen. G. behauptet, daß die glänzende Malweise des
Rubens von einem Beimischen venezianischen Terpentins zur gewöhnlichen
Ölfarbe herrühre, ln Nr. 18 noch ein Nachwort von P. Kämmerer. Die
ganze Polemik ist lehrreich und gewährt allerlei Ausblicke auch über
Rubens hinaus. E.
sohn, »DossoDossi«, S. 60f. und 203). Obwoh! die Inschrift nicht tadellos
erhatten ist, konnte ich doch unterscheiden, daß sie iautet: »Sic Erimus«
(So werden wir sein), mit rundiichem großen E zu Anfang des zweiten
Wortes. Das gibt meines Erachtens einen Sinn, der zur Darstellung paßt.
Der dargestellte Lächeinde wi!) durch die Schrift auf dem Cartellino offen-
bar sagen, daß er und die, weiche er meinte, in Zukunft fromm würden, so
wie das Lamm, das er vor sich häit und unter dessen Kopf die inschrift
zu sehen ist. Der Lächelnde glaubt wohl nicht recht an diese fromme Zu-
kunft und hat vielleicht nebstbei auch daran gedacht, daß das Lamm ge-
legentlich auch als Symbol geringer Geistesgaben betrachtet wird. Wie die
Deutung des Zusammenhanges auch sei, jedenfalls gibt: Sic Erimus, wie
ich es schon in den Blättern für Gemäldekunde, Bd. 111, S. 141, angedeutet
habe, einen mehr brauchbaren Sinn als die anderen Lesungen. Zudem
scheint in dem Sic erimus ein Anklang an das »Sic erimus cuncti post-
quam nos aufferet orcus. Ergo vivamus, dum licet esse, bene« des Petro-
nius aus dem Gastmahl des Trimalchio vorzuliegen, und zwar ein Anklang
nicht nur durch die ersten gleichlautenden Worte, sondern möglicherweise
auch durch die Bedeutung der Stelle. Er.
»Wie hat Rubens seine Farben angerieben und verarbeitet?«
Artikel von Paul Kämmerer in den »Technischen Mitteilungen für Malerei«,
Bd. XXX, Nr. 14 und 15. Durch E. Bergers »Beiträge zur Entwicklungs-
geschichte der Maltechnik« ist die Benutzung der Mayerneschen Mitteilungen
über die Malweise des Rubens wesentlich erleichtert worden. Man geht
daran, die Deutung zu verfeinern, wobei manche Unklarheit des Ausdrucks
im alten Text als unangenehmes Hindernis wirkt. Nicht immer ist es z. B.
klar, ob vom Anreiben der Farbe auf dem Stein für künftige Aufbewahrung
des Pigments oder vom Anreiben auf der Palette zum augenblicklichen
Gebrauch gesprochen wird. Wie es scheint, hat man mit Berger voraus-
zusetzen, daß die Farben auf dem Stein j( derzeit zunächst mit Leinöl, all-
fällig Mohnöl, gerieben wurden und daß andere Bindemittel von stärkerer
Trockenkraft erst auf der Palette beigemischt wurden. (Hiezu: Technische
Mitteilungen für Malerei, Bd. XXX, S. 109f. mit den Bemerkungen von
Paul Kämmerer und S. 115f. mit einer Entgegnung von Ernst Berger.)
ln dem oben angeführten Artikel von Paul Kämmerer wird die Angelegen-
heit in kritischer Weise weiter ausgesponnen, auch wenn zunächst eine
vollkommen überzeugende Antwort auf die Reihenfolge in der Anwendung
der Bindemittel durch Rubens nicht zu geben ist. Zweifellos ist die An-
wendung von Terpentinöl überhaupt und die Beimischung eines firnis-
haltigen Bindemittels. Der Firnis des Rubens war, wie längst bekannt, ein
Trockenöl, das, ohne zu kochen, über Bleiglätte an der Sonne eingedickt
ist. ln Nr. 17, S. 153 ff., der Technischen Mitteilungen für Malerei ergreift
E. Berger nochmals das Wort in der Angelegenheit und bringt gute Gründe
zugunsten seiner Ansichten vor, indem er auf mehrere der angedeuteten
Punkte genau eingeht. Dabei wird auch auf eine briefliche Äußerung des
erfahrenen G. hingewiesen. G. behauptet, daß die glänzende Malweise des
Rubens von einem Beimischen venezianischen Terpentins zur gewöhnlichen
Ölfarbe herrühre, ln Nr. 18 noch ein Nachwort von P. Kämmerer. Die
ganze Polemik ist lehrreich und gewährt allerlei Ausblicke auch über
Rubens hinaus. E.