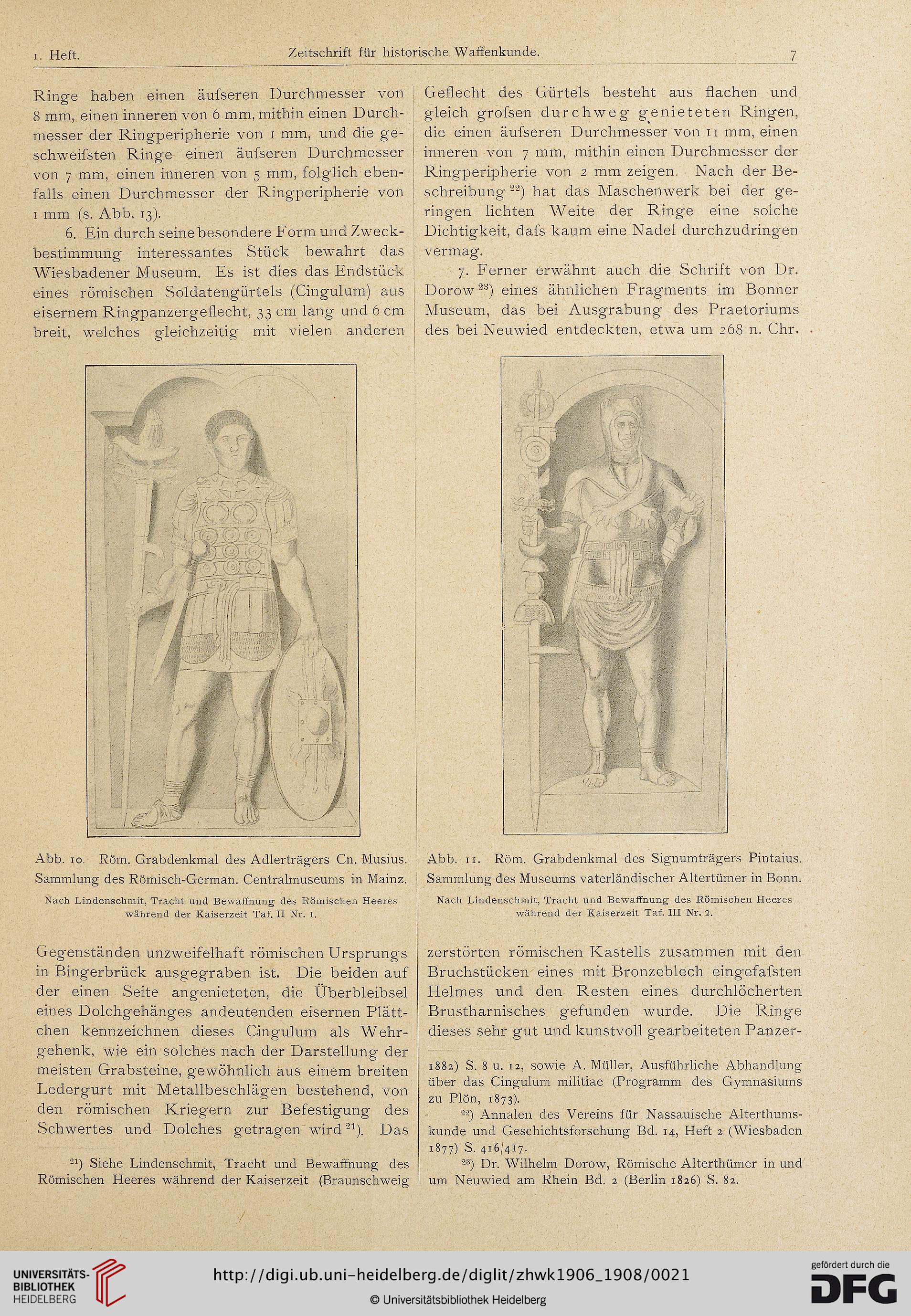i. Heft.
Zeitschrift für historische Waffenkunde,
7
Ringe haben einen äufseren Durchmesser von
8 mm, einen inneren von 6 mm, mithin einen Durch-
messer der Ringperipherie von i mm, und die ge-
schweifsten Ringe einen äufseren Durchmesser
von 7 mm, einen inneren von 5 mm, folglich eben-
falls einen Durchmesser der Ringperipherie von
1 mm (s. Abb. 13).
6. Ein durch seine besondere Form und Zweck-
bestimmung' interessantes Stück bewahrt das
Wiesbadener Museum. Es ist dies das Endstück
eines römischen Soldatengürtels (Cingulum) aus
eisernem Ringpanzergeilecht, 33 cm lang und 6 cm
breit, welches gleichzeitig mit vielen anderen
Abb. io. Röm. Grabdenkmal des Adlerträgers Cn. Musius.
Sammlung des Römisch-German. Centralmuseums in Mainz.
Nach Lindenschmit, Tracht und Bewaffnung des Römischen Heeres
während der Kaiserzeit Tat. II Nr. l.
Gegenständen unzweifelhaft römischen Ursprungs
in Bingerbrück ausgegraben ist. Die beiden auf
der einen Seite angenieteten, die Überbleibsel
eines Dolchgehänges andeutenden eisernen Plätt-
chen kennzeichnen dieses Cingulum als Wehr-
gehenk, wie ein solches nach der Darstellung der
meisten Grabsteine, gewöhnlich aus einem breiten
Ledergurt mit Metallbeschlägen bestehend, von
den römischen Kriegern zur Befestigung des
Schwertes und Dolches getragen wird 21). Das
-1) Siehe Lindenschmit, Tracht und Bewaffnung des
Römischen Heeres während der Kaiserzeit (Braunschweig
Geflecht des Gürtels besteht aus flachen und
gleich grofsen durchweg' genieteten Ringen,
die einen äufseren Durchmesser von 11 mm, einen
inneren von 7 mm, mithin einen Durchmesser der
Ringperipherie von 2 mm zeigen. Nach der Be-
schreibung 22) hat das Maschenwerk bei der ge-
ringen lichten Weite der Ringe eine solche
Dichtigkeit, dafs kaum eine Nadel durchzudringen
vermag.
7. Ferner erwähnt auch die Schrift von Dr.
Dorow2y) eines ähnlichen Fragments im Bonner
Museum, das bei Ausgrabung des Praetoriums
des bei Neuwied entdeckten, etwa um 268 n. Chr.
Abb. 11. Röm. Grabdenkmal des Signumträgers Pintaius.
Sammlung des Museums vaterländischer Altertümer in Bonn.
Nach Lindenschmit, Tracht und Bewaffnung des Römischen Heeres
während der Kaiserzeit Taf. III Nr. 2.
zerstörten römischen Kastells zusammen mit den
Bruchstücken eines mit Bronzeblech eingefafsten
Helmes und den Resten eines durchlöcherten
Brustharnisches gefunden wurde. Die Ringe
dieses sehr gut und kunstvoll gearbeiteten Panzer-
1882) S. 8 u. 12, sowie A. Müller, Ausführliche Abhandlung
über das Cingulum militiae (Programm des Gymnasiums
zu Plön, 1873).
--) Annalen des Vereins für Nassauische Alterthums-
kunde und Geschichtsforschung Bd. 14, Heft 2 (Wiesbaden
1877) S. 416/417.
23) Dr. Wilhelm Dorow, Römische Alterthtimer in und
um Neuwied am Rhein Bd. 2 (Berlin 1826) S. 82.
Zeitschrift für historische Waffenkunde,
7
Ringe haben einen äufseren Durchmesser von
8 mm, einen inneren von 6 mm, mithin einen Durch-
messer der Ringperipherie von i mm, und die ge-
schweifsten Ringe einen äufseren Durchmesser
von 7 mm, einen inneren von 5 mm, folglich eben-
falls einen Durchmesser der Ringperipherie von
1 mm (s. Abb. 13).
6. Ein durch seine besondere Form und Zweck-
bestimmung' interessantes Stück bewahrt das
Wiesbadener Museum. Es ist dies das Endstück
eines römischen Soldatengürtels (Cingulum) aus
eisernem Ringpanzergeilecht, 33 cm lang und 6 cm
breit, welches gleichzeitig mit vielen anderen
Abb. io. Röm. Grabdenkmal des Adlerträgers Cn. Musius.
Sammlung des Römisch-German. Centralmuseums in Mainz.
Nach Lindenschmit, Tracht und Bewaffnung des Römischen Heeres
während der Kaiserzeit Tat. II Nr. l.
Gegenständen unzweifelhaft römischen Ursprungs
in Bingerbrück ausgegraben ist. Die beiden auf
der einen Seite angenieteten, die Überbleibsel
eines Dolchgehänges andeutenden eisernen Plätt-
chen kennzeichnen dieses Cingulum als Wehr-
gehenk, wie ein solches nach der Darstellung der
meisten Grabsteine, gewöhnlich aus einem breiten
Ledergurt mit Metallbeschlägen bestehend, von
den römischen Kriegern zur Befestigung des
Schwertes und Dolches getragen wird 21). Das
-1) Siehe Lindenschmit, Tracht und Bewaffnung des
Römischen Heeres während der Kaiserzeit (Braunschweig
Geflecht des Gürtels besteht aus flachen und
gleich grofsen durchweg' genieteten Ringen,
die einen äufseren Durchmesser von 11 mm, einen
inneren von 7 mm, mithin einen Durchmesser der
Ringperipherie von 2 mm zeigen. Nach der Be-
schreibung 22) hat das Maschenwerk bei der ge-
ringen lichten Weite der Ringe eine solche
Dichtigkeit, dafs kaum eine Nadel durchzudringen
vermag.
7. Ferner erwähnt auch die Schrift von Dr.
Dorow2y) eines ähnlichen Fragments im Bonner
Museum, das bei Ausgrabung des Praetoriums
des bei Neuwied entdeckten, etwa um 268 n. Chr.
Abb. 11. Röm. Grabdenkmal des Signumträgers Pintaius.
Sammlung des Museums vaterländischer Altertümer in Bonn.
Nach Lindenschmit, Tracht und Bewaffnung des Römischen Heeres
während der Kaiserzeit Taf. III Nr. 2.
zerstörten römischen Kastells zusammen mit den
Bruchstücken eines mit Bronzeblech eingefafsten
Helmes und den Resten eines durchlöcherten
Brustharnisches gefunden wurde. Die Ringe
dieses sehr gut und kunstvoll gearbeiteten Panzer-
1882) S. 8 u. 12, sowie A. Müller, Ausführliche Abhandlung
über das Cingulum militiae (Programm des Gymnasiums
zu Plön, 1873).
--) Annalen des Vereins für Nassauische Alterthums-
kunde und Geschichtsforschung Bd. 14, Heft 2 (Wiesbaden
1877) S. 416/417.
23) Dr. Wilhelm Dorow, Römische Alterthtimer in und
um Neuwied am Rhein Bd. 2 (Berlin 1826) S. 82.