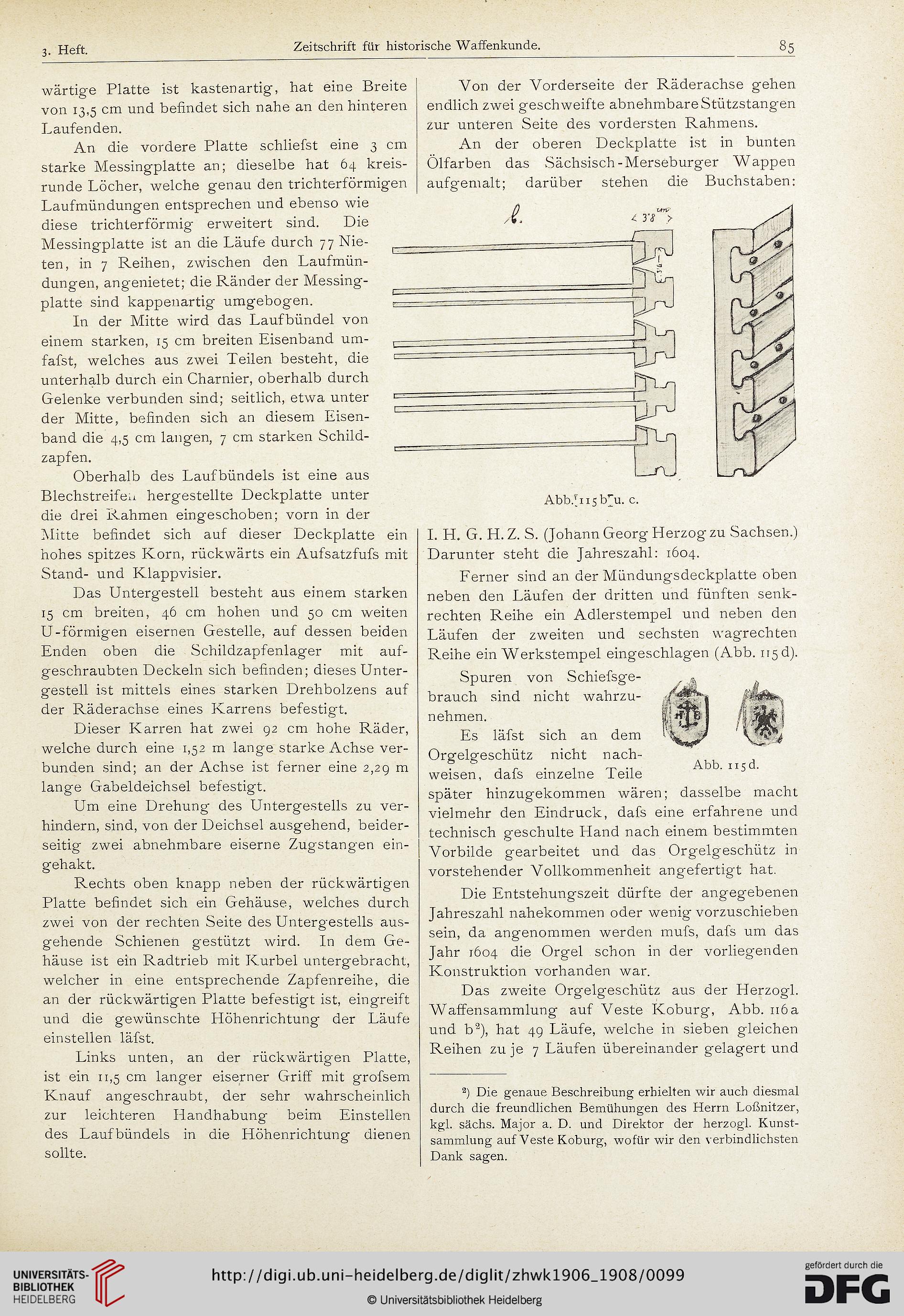3. Heft.
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
85
wärtige Platte ist kastenartig, hat eine Breite
von 13,5 cm und befindet sich nahe an den hinteren
Laufenden.
An die vordere Platte schliefst eine 3 cm
starke Messingplatte an; dieselbe hat 64 kreis-
runde Löcher, welche genau den trichterförmigen
Laufmündungen entsprechen und ebenso wie
diese trichterförmig erweitert sind. Die
Messingplatte ist an die Läufe durch 77 Nie-
ten, in 7 Reihen, zwischen den Laufmün-
dungen, angenietet; die Ränder der Messing-
platte sind kappenartig umgebogen.
In der Mitte wird das Laufbündel von
einem starken, 15 cm breiten Eisenband um-
fafst, welches aus zwei Teilen besteht, die
unterhalb durch ein Charnier, oberhalb durch
Gelenke verbunden sind; seitlich, etwa unter
der Mitte, befinden sich an diesem Eisen-
band die 4,5 cm langen, 7 cm starken Schild-
zapfen.
Oberhalb des Laufbündels ist eine aus
Blechstreifen hergestellte Deckplatte unter
die drei Rahmen eingeschoben; vorn in der
Mitte befindet sich auf dieser Deckplatte ein
hohes spitzes Korn, rückwärts ein Aufsatzfufs mit
Stand- und Klappvisier.
Das Untergestell besteht aus einem starken
15 cm breiten, 46 cm hohen und 50 cm weiten
U-förmigen eisernen Gestelle, auf dessen beiden
Enden oben die Schildzapfenlager mit auf-
geschraubten Deckeln sich befinden; dieses Unter-
gestell ist mittels eines starken Drehbolzens auf
der Räderachse eines Karrens befestigt.
Dieser Karren hat zwei 92 cm hohe Räder,
welche durch eine 1,52 m lange starke Achse ver-
bunden sind; an der Achse ist ferner eine 2,29 m
lange Gabeldeichsel befestigt.
Um eine Drehung des Untergestells zu ver-
hindern, sind, von der Deichsel ausgehend, beider-
seitig zwei abnehmbare eiserne Zugstangen ein-
gehakt.
Rechts oben knapp neben der rückwärtigen
Platte befindet sich ein Gehäuse, welches durch
zwei von der rechten Seite des Untergestells aus-
gehende Schienen gestützt wird. In dem Ge-
häuse ist ein Radtrieb mit Kurbel untergebracht,
welcher in eine entsprechende Zapfenreihe, die
an der rückwärtigen Platte befestigt ist, eingreift
und die gewünschte Höhenrichtung der Läufe
einstellen läfst.
Links unten, an der rückwärtigen Platte,
ist ein 11,5 cm langer eiserner Griff mit grofsem
Knauf angeschraubt, der sehr wahrscheinlich
zur leichteren Handhabung beim Einstellen
des Laufbündels in die Höhenrichtung dienen
sollte.
Von der Vorderseite der Räderachse gehen
endlich zwei geschweifte abnehmbare Stützstangen
zur unteren Seite des vordersten Rahmens.
An der oberen Deckplatte ist in bunten
Ölfarben das Sächsisch-Merseburger Wappen
aufgemalt; darüber stehen die Buchstaben:
A. i 3‘f">
I. H. G. H. Z. S. (Johann Georg Herzog zu Sachsen.)
Darunter steht die Jahreszahl: 1604.
Ferner sind an der Mündungsdeckplatte oben
neben den Läufen der dritten und fünften senk-
rechten Reihe ein Adlerstempel und neben den
Läufen der zweiten und sechsten wagrechten
Reihe ein Werkstempel eingeschlagen (Abb. 115 d).
Spuren von Schiefsge-
brauch sind nicht wahrzu-
nehmen.
Es läfst sich an dem
Orgelgeschütz nicht nach-
weisen, dafs einzelne Teile
später hinzugekommen wären; dasselbe macht
vielmehr den Eindruck, dafs eine erfahrene und
technisch geschulte Hand nach einem bestimmten
Vorbilde gearbeitet und das Orgelgeschütz in
vorstehender Vollkommenheit ang-efertigt hat.
Die Entstehungszeit dürfte der angegebenen
Jahreszahl nahekommen oder wenig vorzuschieben
sein, da angenommen werden mufs, dafs um das
Jahr 1604 die Orgel schon in der vorliegenden
Konstruktion vorhanden war.
Das zweite Orgelgeschütz aus der Herzogi.
Waffensammlung auf Veste Koburg, Abb. 116 a
und b2), hat 49 Läufe, welche in sieben gleichen
Reihen zu je 7 Läufen übereinander gelagert und
2) Die genaue Beschreibung erhielten wir auch diesmal
durch die freundlichen Bemühungen des Herrn Loßnitzer,
kgl. sächs. Major a. D. und Direktor der herzogl. Kunst-
sammlung auf Veste Koburg, wofür wir den verbindlichsten
Dank sagen.
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
85
wärtige Platte ist kastenartig, hat eine Breite
von 13,5 cm und befindet sich nahe an den hinteren
Laufenden.
An die vordere Platte schliefst eine 3 cm
starke Messingplatte an; dieselbe hat 64 kreis-
runde Löcher, welche genau den trichterförmigen
Laufmündungen entsprechen und ebenso wie
diese trichterförmig erweitert sind. Die
Messingplatte ist an die Läufe durch 77 Nie-
ten, in 7 Reihen, zwischen den Laufmün-
dungen, angenietet; die Ränder der Messing-
platte sind kappenartig umgebogen.
In der Mitte wird das Laufbündel von
einem starken, 15 cm breiten Eisenband um-
fafst, welches aus zwei Teilen besteht, die
unterhalb durch ein Charnier, oberhalb durch
Gelenke verbunden sind; seitlich, etwa unter
der Mitte, befinden sich an diesem Eisen-
band die 4,5 cm langen, 7 cm starken Schild-
zapfen.
Oberhalb des Laufbündels ist eine aus
Blechstreifen hergestellte Deckplatte unter
die drei Rahmen eingeschoben; vorn in der
Mitte befindet sich auf dieser Deckplatte ein
hohes spitzes Korn, rückwärts ein Aufsatzfufs mit
Stand- und Klappvisier.
Das Untergestell besteht aus einem starken
15 cm breiten, 46 cm hohen und 50 cm weiten
U-förmigen eisernen Gestelle, auf dessen beiden
Enden oben die Schildzapfenlager mit auf-
geschraubten Deckeln sich befinden; dieses Unter-
gestell ist mittels eines starken Drehbolzens auf
der Räderachse eines Karrens befestigt.
Dieser Karren hat zwei 92 cm hohe Räder,
welche durch eine 1,52 m lange starke Achse ver-
bunden sind; an der Achse ist ferner eine 2,29 m
lange Gabeldeichsel befestigt.
Um eine Drehung des Untergestells zu ver-
hindern, sind, von der Deichsel ausgehend, beider-
seitig zwei abnehmbare eiserne Zugstangen ein-
gehakt.
Rechts oben knapp neben der rückwärtigen
Platte befindet sich ein Gehäuse, welches durch
zwei von der rechten Seite des Untergestells aus-
gehende Schienen gestützt wird. In dem Ge-
häuse ist ein Radtrieb mit Kurbel untergebracht,
welcher in eine entsprechende Zapfenreihe, die
an der rückwärtigen Platte befestigt ist, eingreift
und die gewünschte Höhenrichtung der Läufe
einstellen läfst.
Links unten, an der rückwärtigen Platte,
ist ein 11,5 cm langer eiserner Griff mit grofsem
Knauf angeschraubt, der sehr wahrscheinlich
zur leichteren Handhabung beim Einstellen
des Laufbündels in die Höhenrichtung dienen
sollte.
Von der Vorderseite der Räderachse gehen
endlich zwei geschweifte abnehmbare Stützstangen
zur unteren Seite des vordersten Rahmens.
An der oberen Deckplatte ist in bunten
Ölfarben das Sächsisch-Merseburger Wappen
aufgemalt; darüber stehen die Buchstaben:
A. i 3‘f">
I. H. G. H. Z. S. (Johann Georg Herzog zu Sachsen.)
Darunter steht die Jahreszahl: 1604.
Ferner sind an der Mündungsdeckplatte oben
neben den Läufen der dritten und fünften senk-
rechten Reihe ein Adlerstempel und neben den
Läufen der zweiten und sechsten wagrechten
Reihe ein Werkstempel eingeschlagen (Abb. 115 d).
Spuren von Schiefsge-
brauch sind nicht wahrzu-
nehmen.
Es läfst sich an dem
Orgelgeschütz nicht nach-
weisen, dafs einzelne Teile
später hinzugekommen wären; dasselbe macht
vielmehr den Eindruck, dafs eine erfahrene und
technisch geschulte Hand nach einem bestimmten
Vorbilde gearbeitet und das Orgelgeschütz in
vorstehender Vollkommenheit ang-efertigt hat.
Die Entstehungszeit dürfte der angegebenen
Jahreszahl nahekommen oder wenig vorzuschieben
sein, da angenommen werden mufs, dafs um das
Jahr 1604 die Orgel schon in der vorliegenden
Konstruktion vorhanden war.
Das zweite Orgelgeschütz aus der Herzogi.
Waffensammlung auf Veste Koburg, Abb. 116 a
und b2), hat 49 Läufe, welche in sieben gleichen
Reihen zu je 7 Läufen übereinander gelagert und
2) Die genaue Beschreibung erhielten wir auch diesmal
durch die freundlichen Bemühungen des Herrn Loßnitzer,
kgl. sächs. Major a. D. und Direktor der herzogl. Kunst-
sammlung auf Veste Koburg, wofür wir den verbindlichsten
Dank sagen.