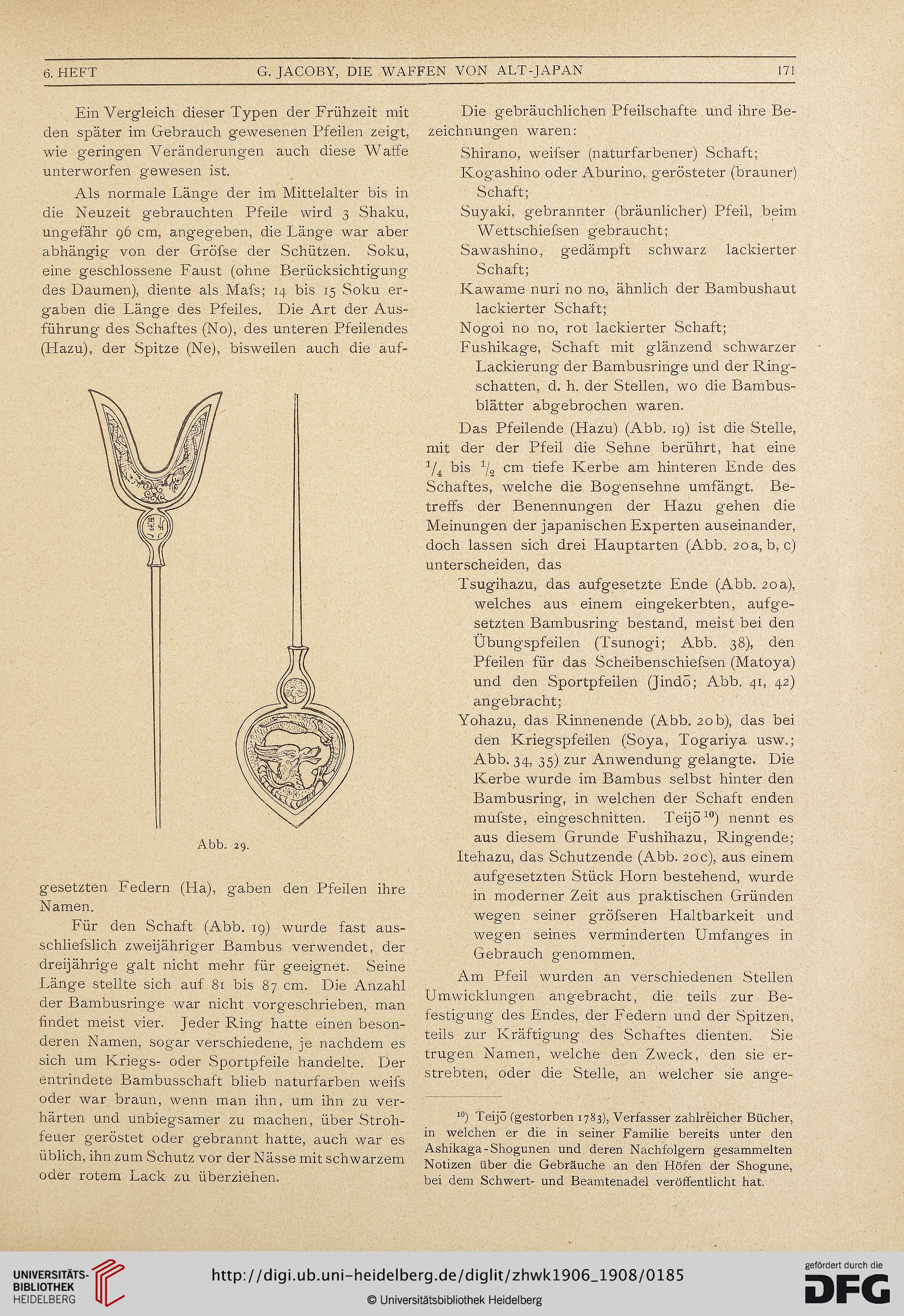6. HEFT
G. JACOBY, DIE WAFFEN VON ALT-JAPAN
171
Ein Vergleich dieser Typen der Frühzeit mit
den später im Gebrauch gewesenen Pfeilen zeigt,
wie geringen Veränderungen auch diese Waffe
unterworfen gewesen ist.
Als normale Länge der im Mittelalter bis in
die Neuzeit gebrauchten Pfeile wird 3 Shaku,
ungefähr 96 cm, angegeben, die Länge war aber
abhängig' von der Gröfse der Schützen. Soku,
eine geschlossene Faust (ohne P>erücksichtigung
des Daumen), diente als Mafs; 14 bis 15 Soku er-
gaben die Länge des Pfeiles. Die Art der Aus-
führung des Schaftes (No), des unteren Pfeilendes
(Hazu), der Spitze (Ne), bisweilen auch die auf-
gesetzten Federn (Ha), gaben den Pfeilen ihre
Namen.
Für den Schaft (Abb. 19) wurde fast aus-
schliefslich zweijähriger Bambus verwendet, der
dreijährige galt nicht mehr für geeignet. Seine
Länge stellte sich auf 81 bis 87 cm. Die Anzahl
der Bambusringe war nicht vorgeschrieben, man
findet meist vier. Jeder Ring hatte einen beson-
deren Namen, sogar verschiedene, je nachdem es
sich um Kriegs- oder Sportpfeile handelte. Der
entrindete Bambusschaft blieb naturfarben weifs
oder war braun, wenn man ihn, um ihn zu ver-
härten und unbiegsamer zu machen, über Stroh-
feuer geröstet oder gebrannt hatte, auch war es
üblich, ihn zum Schutz vor der Nässe mit schwarzem
oder rotem Lack zu überziehen.
Die gebräuchlichen Pfeilschafte und ihre Be-
zeichnungen waren:
Shirano, weifser (naturfarbener) Schaft;
Kog'ashino oder Aburino, gerösteter (brauner)
Schaft;
Suyaki, gebrannter (bräunlicher) Pfeil, beim
Wettschiefsen gebraucht;
Sawashino, gedämpft schwarz lackierter
Schaft;
Kawame nuri no 110, ähnlich der Bambushaut
lackierter Schaft;
Nogoi no no, rot lackierter Schaft;
Fushikage, Schaft mit glänzend schwarzer
Lackierung der Bambusringe und der Ring--
schatten, d. h. der Stellen, wo die Bambus-
blätter abgebrochen waren.
Das Pfeilende (Hazu) (Abb. 19) ist die Stelle,
mit der der Pfeil die Sehne berührt, hat eine
1/4 bis 1:/2 cm tiefe Kerbe am hinteren Ende des
Schaftes, welche die Bogensehne umfängt. Be-
treffs der Benennungen der Hazu gehen die
Meinungen der japanischen Experten auseinander,
doch lassen sich drei Hauptarten (Abb. 20 a, b,c)
unterscheiden, das
Tsugihazu, das aufgesetzte Ende (Abb. 20 a),
welches aus einem eingekerbten, aufge-
setzten Bambusring bestand, meist bei den
Übungspfeilen (Tsunog'i; Abb. 38), den
Pfeilen für das Scheibenschiefsen (Matoya)
und den Sportpfeilen (Jindö; Abb. 41, 42)
angebracht;
Yohazu, das Rinnenende (Abb. 20 b), das bei
den Kriegspfeilen (Soya, Togariya usw.;
Abb. 34, 35) zur Anwendung- gelangte. Die
Kerbe wurde im Bambus selbst hinter den
Bambusring, in welchen der Schaft enden
mufste, eingeschnitten. Teijö10) nennt es
aus diesem Grunde Fushihazu, Ringende;
Itehazu, das Schützende (Abb. 20 c), aus einem
aufg'esetzten Stück Horn bestehend, wurde
in moderner Zeit aus praktischen Gründen
wegen seiner gröfseren Haltbarkeit und
wegen seines verminderten Umfanges in
Gebrauch genommen.
Am Pfeil wurden an verschiedenen Stellen
Umwicklungen angebracht, die teils zur Be-
festigung des Endes, der Federn und der Spitzen,
teils zur Kräftigung des Schaftes dienten. Sie
trugen Namen, welche den Zweck, den sie er-
strebten, oder die Stelle, an welcher sie ange-
10) Teijö (gestorben 1783), Verfasser zahlreicher Bücher,
in welchen er die in seiner Familie bereits unter den
Ashikaga-Shogunen und deren Nachfolgern gesammelten
Notizen über die Gebräuche an den Höfen der Shogune,
bei dem Schwert- und Beamtenadel veröffentlicht hat.
G. JACOBY, DIE WAFFEN VON ALT-JAPAN
171
Ein Vergleich dieser Typen der Frühzeit mit
den später im Gebrauch gewesenen Pfeilen zeigt,
wie geringen Veränderungen auch diese Waffe
unterworfen gewesen ist.
Als normale Länge der im Mittelalter bis in
die Neuzeit gebrauchten Pfeile wird 3 Shaku,
ungefähr 96 cm, angegeben, die Länge war aber
abhängig' von der Gröfse der Schützen. Soku,
eine geschlossene Faust (ohne P>erücksichtigung
des Daumen), diente als Mafs; 14 bis 15 Soku er-
gaben die Länge des Pfeiles. Die Art der Aus-
führung des Schaftes (No), des unteren Pfeilendes
(Hazu), der Spitze (Ne), bisweilen auch die auf-
gesetzten Federn (Ha), gaben den Pfeilen ihre
Namen.
Für den Schaft (Abb. 19) wurde fast aus-
schliefslich zweijähriger Bambus verwendet, der
dreijährige galt nicht mehr für geeignet. Seine
Länge stellte sich auf 81 bis 87 cm. Die Anzahl
der Bambusringe war nicht vorgeschrieben, man
findet meist vier. Jeder Ring hatte einen beson-
deren Namen, sogar verschiedene, je nachdem es
sich um Kriegs- oder Sportpfeile handelte. Der
entrindete Bambusschaft blieb naturfarben weifs
oder war braun, wenn man ihn, um ihn zu ver-
härten und unbiegsamer zu machen, über Stroh-
feuer geröstet oder gebrannt hatte, auch war es
üblich, ihn zum Schutz vor der Nässe mit schwarzem
oder rotem Lack zu überziehen.
Die gebräuchlichen Pfeilschafte und ihre Be-
zeichnungen waren:
Shirano, weifser (naturfarbener) Schaft;
Kog'ashino oder Aburino, gerösteter (brauner)
Schaft;
Suyaki, gebrannter (bräunlicher) Pfeil, beim
Wettschiefsen gebraucht;
Sawashino, gedämpft schwarz lackierter
Schaft;
Kawame nuri no 110, ähnlich der Bambushaut
lackierter Schaft;
Nogoi no no, rot lackierter Schaft;
Fushikage, Schaft mit glänzend schwarzer
Lackierung der Bambusringe und der Ring--
schatten, d. h. der Stellen, wo die Bambus-
blätter abgebrochen waren.
Das Pfeilende (Hazu) (Abb. 19) ist die Stelle,
mit der der Pfeil die Sehne berührt, hat eine
1/4 bis 1:/2 cm tiefe Kerbe am hinteren Ende des
Schaftes, welche die Bogensehne umfängt. Be-
treffs der Benennungen der Hazu gehen die
Meinungen der japanischen Experten auseinander,
doch lassen sich drei Hauptarten (Abb. 20 a, b,c)
unterscheiden, das
Tsugihazu, das aufgesetzte Ende (Abb. 20 a),
welches aus einem eingekerbten, aufge-
setzten Bambusring bestand, meist bei den
Übungspfeilen (Tsunog'i; Abb. 38), den
Pfeilen für das Scheibenschiefsen (Matoya)
und den Sportpfeilen (Jindö; Abb. 41, 42)
angebracht;
Yohazu, das Rinnenende (Abb. 20 b), das bei
den Kriegspfeilen (Soya, Togariya usw.;
Abb. 34, 35) zur Anwendung- gelangte. Die
Kerbe wurde im Bambus selbst hinter den
Bambusring, in welchen der Schaft enden
mufste, eingeschnitten. Teijö10) nennt es
aus diesem Grunde Fushihazu, Ringende;
Itehazu, das Schützende (Abb. 20 c), aus einem
aufg'esetzten Stück Horn bestehend, wurde
in moderner Zeit aus praktischen Gründen
wegen seiner gröfseren Haltbarkeit und
wegen seines verminderten Umfanges in
Gebrauch genommen.
Am Pfeil wurden an verschiedenen Stellen
Umwicklungen angebracht, die teils zur Be-
festigung des Endes, der Federn und der Spitzen,
teils zur Kräftigung des Schaftes dienten. Sie
trugen Namen, welche den Zweck, den sie er-
strebten, oder die Stelle, an welcher sie ange-
10) Teijö (gestorben 1783), Verfasser zahlreicher Bücher,
in welchen er die in seiner Familie bereits unter den
Ashikaga-Shogunen und deren Nachfolgern gesammelten
Notizen über die Gebräuche an den Höfen der Shogune,
bei dem Schwert- und Beamtenadel veröffentlicht hat.